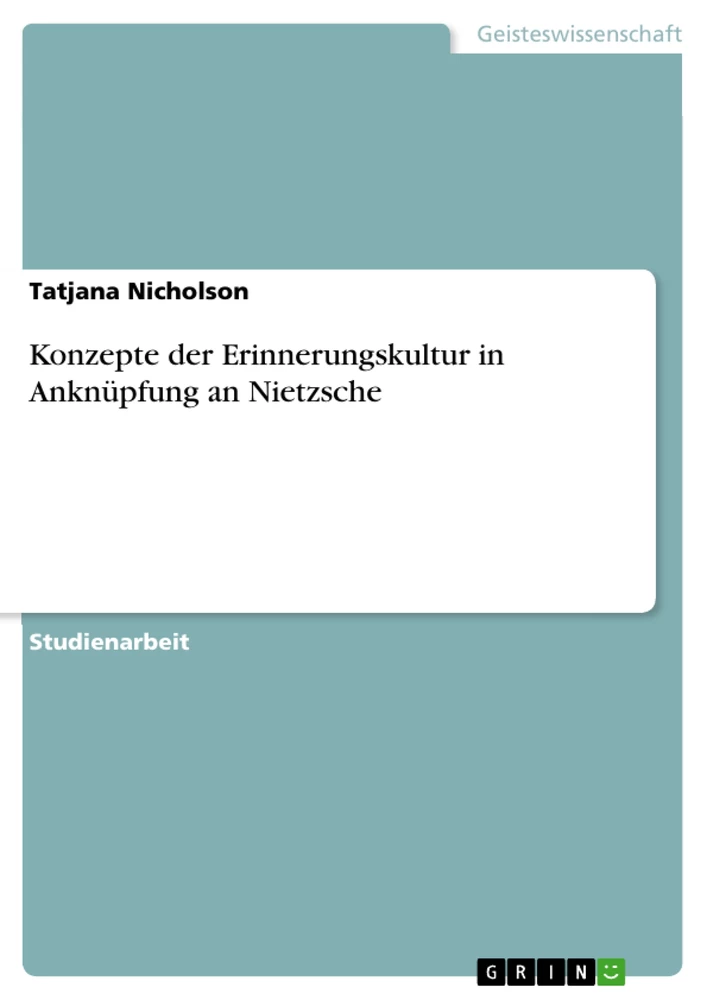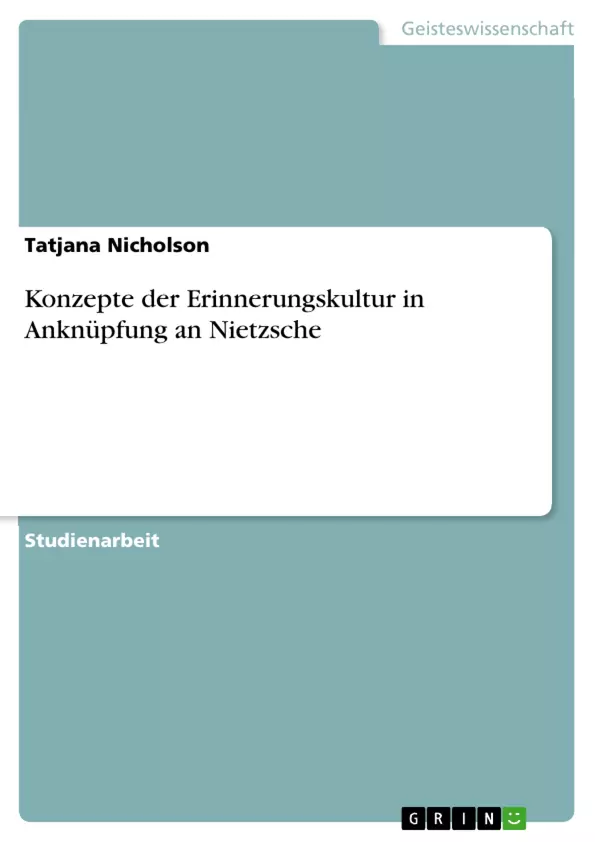Welche Bedeutung(en) hat der Begriff Erinnerungskultur? Weshalb wird das Phänomen wiederholt thematisiert – ist das Thema ein neues im alten Gewand? Welche – angewandten - Konzepte von Erinnerungskultur(en) existieren und inwiefern sind diese, in Anknüpfung an Nietzsche, von „Nutzen“ beziehungsweise „Nachteil“ für das „Leben“? Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung dieser Fragen durch eine medienkulturwissenschaftliche Analyse mit Fokus auf der soziokulturellen, aber auch der historischen und politischen Dimension von Erinnerungskultur. Diese Analyse basiert auf der philosophisch-hermeneutischen Methode der Untersuchung angewandter Konzepte von Erinnerungskultur mit Schwerpunkt auf Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Erinnern und Vergessen
- 2. Konzepte von Erinnerungskultur in Anknüpfung an Nietzsche: Definition von „Historie im Dienst des Lebens“
- 2.1 Versuch einer Herleitung und Definition des Begriffs „Erinnerungskultur“
- 2.2 Erinnerungskultur und die Konstruktion von Wirklichkeit bei Nietzsche
- 2.3 Konzepte von Erinnerungskultur am Beispiel des öffentlichen Umgangs mit dem Genozid an den Armeniern in der Türkei und dem Holocaust/der Shoah in Deutschland
- 2.3.1 Erinnerung als Konzept: Deutsche Erinnerungskultur - vom Holocaust zum „Yolocaust“?
- 2.3.2 Vergessen als Konzept: Der öffentliche Umgang mit dem Genozid an den Armeniern im 1. Weltkrieg
- 3. Schlussteil: Zusammenfassung, Kommentierung, Ausblick
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Konzepte der Erinnerungskultur, insbesondere im Kontext von Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Ziel ist die Beantwortung der Frage nach dem Nutzen und Nachteil solcher Konzepte für das gesellschaftliche Leben, unter Berücksichtigung der historischen, politischen und soziokulturellen Dimensionen. Die Analyse erfolgt medien- und kulturwissenschaftlich, basierend auf der philosophisch-hermeneutischen Methode.
- Der Begriff der Erinnerungskultur und seine Definition im Kontext von Nietzsches Geschichtskritik.
- Der Konflikt zwischen dem Anspruch auf historische Objektivität und der subjektiven Konstruktion von Wirklichkeit durch Erinnerungskultur.
- Die Rolle von Erinnerung und Vergessen in der Gestaltung von kollektivem Gedächtnis und kultureller Identität.
- Die Analyse von angewandten Konzepten der Erinnerungskultur anhand des Umgangs mit dem Holocaust und dem Genozid an den Armeniern.
- Die Untersuchung des Wandels von Nutzen und Nachteil der Erinnerungskultur im Laufe der Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Erinnern und Vergessen: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat Nietzsches über die Notwendigkeit des Vergessens und führt in die Dialektik von Erinnern und Vergessen ein. Sie erläutert die Entstehung des Begriffs „Erinnerungskultur“ und seinen Bezug zur sozialen Gedächtnisforschung. Nietzsche, Halbwachs und Warburg werden als Gründerväter dieser Forschung genannt. Die Arbeit stellt die Forschungsfragen nach der Bedeutung des Begriffs, seiner Aktualität und dem Nutzen bzw. Nachteil angewandter Konzepte im Kontext Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ in den Vordergrund. Die methodische Herangehensweise – eine medien- und kulturwissenschaftliche Analyse mit Fokus auf soziokulturellen, historischen und politischen Dimensionen – wird beschrieben. Die zentrale Frage nach dem mehrdimensionalen „Nutzen und Nachteil“ von Erinnerungskultur für Individuum und Gesellschaft im (medien-) kulturwissenschaftlichen, historischen und ethischen Kontext wird formuliert. Die Arbeit untersucht, wie sich dieser Nutzen und Nachteil durch globale und interne Einflüsse wandeln kann, und welche Veränderungen im Selbstverständnis von Gruppen und Gesellschaften dabei auftreten. Es wird die Frage gestellt, inwieweit Selektion von Erinnerungen Wirklichkeit konstruiert und ob von „Nutzen und Nachteil“ überhaupt gesprochen werden kann oder ob es sich um einen ständig neu verhandelten Perspektivenwechsel handelt.
2. Konzepte von Erinnerungskultur in Anknüpfung an Nietzsche: Definition von „Historie im Dienst des Lebens“: Dieses Kapitel untersucht den Begriff „Erinnerungskultur“ im Kontext von Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Da der Begriff aus der Postmoderne stammt, werden „Konzepte“ hier als „Begriffe“ verstanden. Nietzsches Kritik am Authentizitätsanspruch der Historiker seiner Zeit wird beleuchtet, wobei seine Beobachtungen auch heute noch für Gedächtnisforschung und Geschichtswissenschaft relevant sind. Der Begriff „Historie“ wird im kulturwissenschaftlichen Sinne als „Vorstufe“ zur Erinnerungskultur interpretiert, deren Inhalte sich aus dem kollektiven Gedächtnis speisen. Erinnerungskultur wird als Aneignung und Gebrauch der Vergangenheit durch eine Gruppe definiert, die durch Transformation die Vergangenheit prägt und beeinflusst. Nietzsches Begriff von „Leben“ umfasst nicht nur friedliches Zusammenleben, sondern auch eine ethische Vorstellung von plastischer Gestaltung. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse von praktischen Anwendungen der Erinnerungskultur.
Schlüsselwörter
Erinnerungskultur, kollektives Gedächtnis, Nietzsche, Historie, Leben, Vergessen, Identität, Geschichtswissenschaft, Holocaust, Genozid an den Armeniern, Wirklichkeitskonstruktion, Nutzen und Nachteil, medien- und kulturwissenschaftliche Analyse, philosophisch-hermeneutische Methode.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konzepte der Erinnerungskultur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Konzepte der Erinnerungskultur, insbesondere im Kontext von Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“. Sie analysiert den Nutzen und Nachteil solcher Konzepte für das gesellschaftliche Leben unter Berücksichtigung historischer, politischer und soziokultureller Dimensionen. Die Analyse erfolgt medien- und kulturwissenschaftlich, basierend auf der philosophisch-hermeneutischen Methode.
Welche zentralen Fragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition des Begriffs „Erinnerungskultur“, dem Konflikt zwischen historischer Objektivität und subjektiver Wirklichkeitskonstruktion, der Rolle von Erinnern und Vergessen in der Gestaltung kollektiver Identität, der Analyse von Erinnerungskultur am Beispiel des Holocaust und des Genozids an den Armeniern sowie dem Wandel von Nutzen und Nachteil der Erinnerungskultur im Laufe der Zeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zu Konzepten der Erinnerungskultur im Kontext Nietzsches, einen Schlussteil mit Zusammenfassung und Ausblick sowie ein Literaturverzeichnis. Das Hauptkapitel analysiert den Begriff „Erinnerungskultur“ anhand von Nietzsches Geschichtskritik, untersucht den Begriff „Historie“ als Vorstufe zur Erinnerungskultur und beleuchtet den Einfluss von Erinnerungskultur auf die Gestaltung von Wirklichkeit und Identität.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den Umgang mit dem Holocaust in Deutschland und dem Genozid an den Armeniern in der Türkei als praktische Beispiele für angewandte Konzepte der Erinnerungskultur. Es wird untersucht, wie Erinnerung und Vergessen in diesen Kontexten die Konstruktion von kollektiver Identität und gesellschaftlichem Umgang mit der Vergangenheit beeinflussen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine medien- und kulturwissenschaftliche Analysemethode mit Fokus auf soziokulturellen, historischen und politischen Dimensionen. Die philosophisch-hermeneutische Methode dient als Grundlage der Interpretation.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Erinnerungskultur, kollektives Gedächtnis, Nietzsche, Historie, Leben, Vergessen, Identität, Geschichtswissenschaft, Holocaust, Genozid an den Armeniern, Wirklichkeitskonstruktion, Nutzen und Nachteil, medien- und kulturwissenschaftliche Analyse, philosophisch-hermeneutische Methode.
Welche Rolle spielt Nietzsche in dieser Arbeit?
Nietzsches Werk „Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben“ bildet den zentralen theoretischen Bezugsrahmen. Seine Kritik am Authentizitätsanspruch der Historiker und seine Konzeption von „Historie im Dienst des Lebens“ dienen als Grundlage für die Analyse von Erinnerungskultur.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Der Schlussteil der Arbeit, der in der Zusammenfassung fehlt, würde hier die zentralen Schlussfolgerungen und den Ausblick detailliert beschreiben.)
- Arbeit zitieren
- Tatjana Nicholson (Autor:in), 2019, Konzepte der Erinnerungskultur in Anknüpfung an Nietzsche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245814