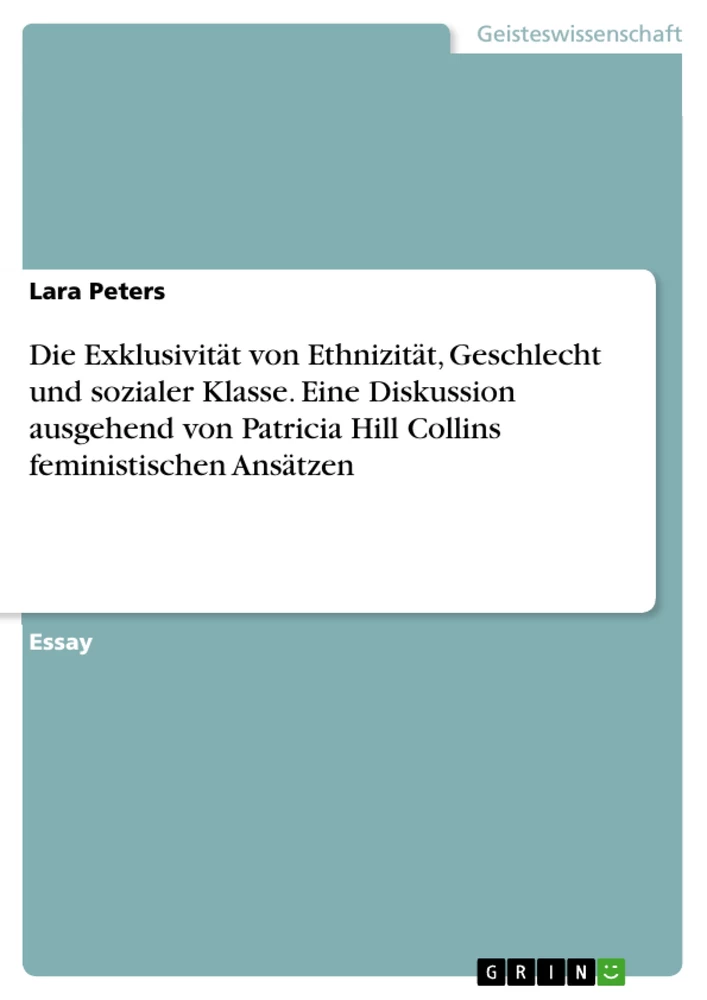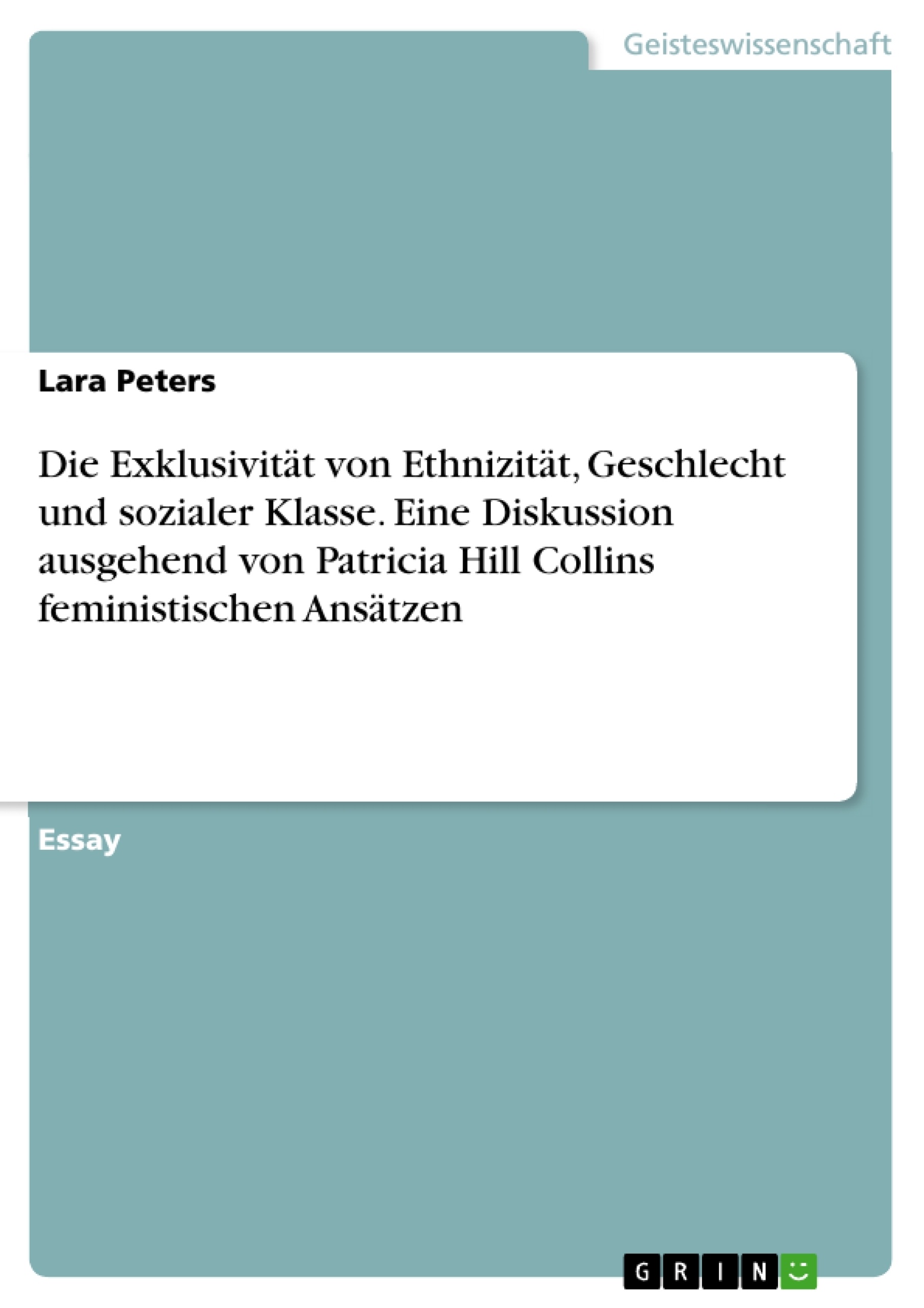Wie exklusiv wirken Ethnie, Geschlecht und soziale Klasse? Es wird angenommen, dass diese Kriterien zwar stark exklusiv wirken können, die wahre Schwierigkeit jedoch darin liegt, wie die Gesellschaft sie ausspielt. Um den Diskurs näher zu untersuchen, wird der Aufsatz "Pushing the Boundaries or Business as Usual" aus dem Jahr 2007 von Patricia Hill Collins reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- Ethnizität, Geschlecht und soziale Klasse als Faktoren der Exklusion
- Patricia Hill Collins' feministische Ansätze: Die „logic of segmentation“
- Hierarchie
- Soziale Praktiken
- Gemeinsamkeit innerhalb der Gruppe
- Abgrenzung und Ressourcenverteilung
- Die Bedeutung der Inklusion in der wissenschaftlichen Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Ethnizität, Geschlecht und sozialer Klasse auf Exklusion und Segmentierung in der Gesellschaft. Sie analysiert, wie diese Kategorien von der Gesellschaft zur Ausgrenzung von Menschen instrumentalisiert werden und wie tiefgreifend diese Prozesse wirken.
- Die „logic of segmentation“ nach Patricia Hill Collins
- Die Rolle von Hierarchie, sozialen Praktiken und der Zuschreibung gemeinsamer Merkmale
- Die Bedeutung der Abgrenzung und Ressourcenverteilung innerhalb von Gruppen
- Die Bedeutung der Inklusion in der wissenschaftlichen Forschung
- Die Integration von Gender-Perspektiven in die sozialwissenschaftliche Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
- Ethnizität, Geschlecht und soziale Klasse als Faktoren der Exklusion: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Ethnizität, Geschlecht und sozialer Klasse als Instrumente der Ausgrenzung in der Gesellschaft und zeigt, wie diese Kategorien zur Segmentierung beitragen.
- Patricia Hill Collins' feministische Ansätze: Die „logic of segmentation“: Dieser Abschnitt stellt die vier grundlegenden Annahmen der „logic of segmentation“ nach Patricia Hill Collins vor. Es wird erläutert, wie diese Annahmen auf die Kategorien Ethnizität, soziale Klasse und Geschlecht angewendet werden können.
- Die Bedeutung der Inklusion in der wissenschaftlichen Forschung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Inklusion von Gender-Perspektiven in der sozialwissenschaftlichen Forschung, um ein umfassenderes Verständnis von gesellschaftlichen Strukturen und Problematiken zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Ethnizität, Geschlecht und soziale Klasse, "logic of segmentation", Exklusion, Segmentierung, Hierarchie, soziale Praktiken, Abgrenzung, Ressourcenverteilung, Inklusion, wissenschaftliche Forschung, Gender-Perspektiven, gesellschaftliche Strukturen, Problematiken.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Patricia Hill Collins unter der „logic of segmentation“?
Es handelt sich um ein Konzept, das beschreibt, wie Hierarchie, soziale Praktiken und Abgrenzung zur Segmentierung und Exklusion in der Gesellschaft führen.
Welche drei Faktoren der Exklusion werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit fokussiert sich auf die Wechselwirkung von Ethnizität, Geschlecht und sozialer Klasse.
Wie instrumentalisiert die Gesellschaft diese Kategorien?
Die Kategorien werden genutzt, um Ressourcen ungleich zu verteilen und Menschen innerhalb hierarchischer Strukturen auszugrenzen.
Warum ist Inklusion in der wissenschaftlichen Forschung wichtig?
Die Integration von Gender-Perspektiven und anderen Faktoren ermöglicht ein umfassenderes Verständnis gesellschaftlicher Strukturen und Problematiken.
Welcher Text von Patricia Hill Collins dient als Grundlage?
Die Diskussion geht von ihrem Aufsatz „Pushing the Boundaries or Business as Usual“ aus dem Jahr 2007 aus.
- Quote paper
- Lara Peters (Author), 2019, Die Exklusivität von Ethnizität, Geschlecht und sozialer Klasse. Eine Diskussion ausgehend von Patricia Hill Collins feministischen Ansätzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245818