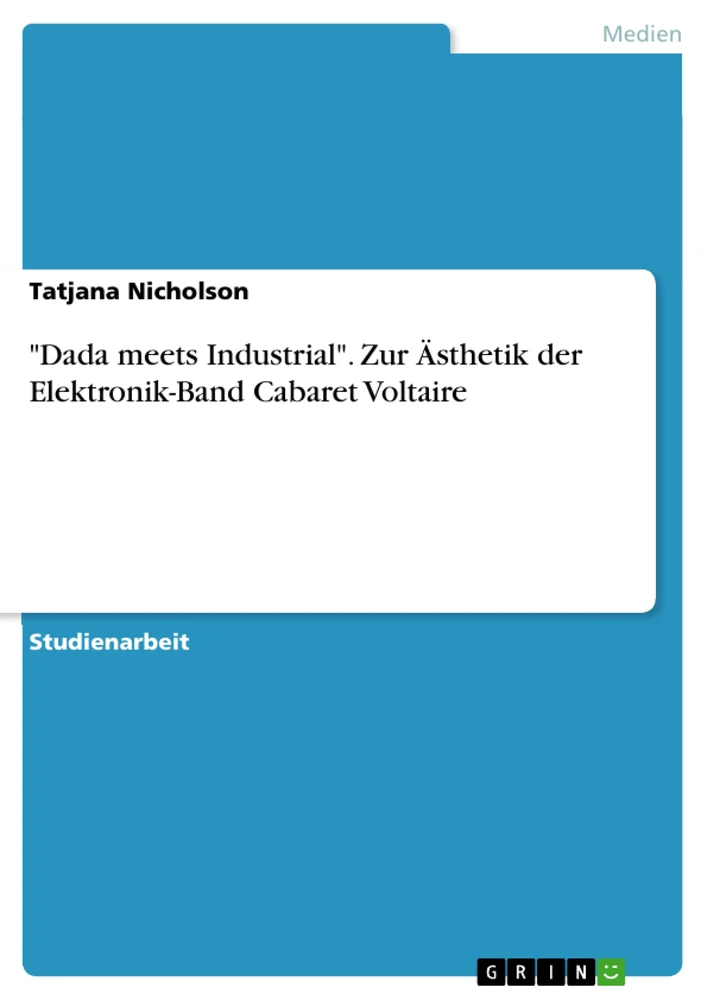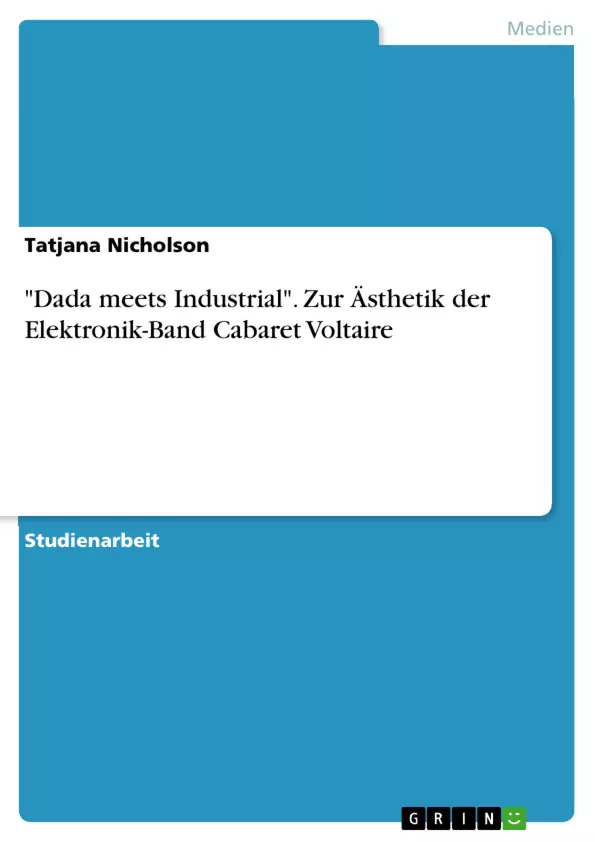In dieser Arbeit wird die Ästhetik bzw. die Medienästhetik des audiovisuellen Werks der Band „Cabaret Voltaire“ im Kontext ihrer soziokulturellen Dimension untersucht. Der Begriff „Ästhetik“ wird phänomenologisch im Sinne von Informations- und Rezeptionsästhetik verwendet, weil es sich bei dem zu analysierenden Forschungsgegenstand um eine Erscheinung der Postmoderne, nämlich musikalische „Medien-Kunst“ bzw. Pop-Musik handelt. Die von Cabaret Voltaire zur Erzeugung des Mediums Musik verwendeten technischen Medien werden entsprechend als ästhetische Phänomene erfasst und einzelmedienübergreifend untersucht.
Das Ziel dieser Arbeit ist, durch die Analyse der besonderen (medien-)ästhetischen Merkmale dieser Band und ihres musikalischen Werks herauszufinden, wie diese (Medien-)Ästhetik als soziales und künstlerisches „Produkt“ ihrer Zeit, i.e. die Phase der 3. Industriellen Revolution3 bzw. des Elektronikzeitalters, wahrgenommen wurde.
Folgende Frage soll beantwortet werden: ist die audiovisuelle Medienästhetik des musikalischen Werks von Cabaret Voltaire ein Ausdruck kritischer Reflexion der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit, und womöglich auch im heutigen digitalen Zeitalter noch relevant, oder – mit Shakespeare gesprochen – „Viel Lärm Um Nichts“?
Die Elektronik-Band „Cabaret Voltaire“ aus der nordenglischen Industriestadt Sheffield war von 1975 bis 1993 aktiv und wird aufgrund ihres experimentellen musikalischen Stils, der sich unter Einsatz von Kommunikationselektronik-Geräten entwickelte, als „Industrial Band“ bezeichnet. Cabaret Voltaire gelten als einflussreichste Mitbegründer des Genres der „Indusrial Music“ in Nordengland, das sich in den späten 70er Jahren in Sheffield und London entwickelte. Der Name der Band bezieht sich auf den gleichnamigen Gründungsort der Dada-Bewegung in Zürich und markiert damit eine enge Verbindung zur Avantgarde-Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, deren Ästhetik und Philosophie das musikalische bzw. multimediale Werk Cabaret Voltaires deutlich prägte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Dada meets Industrial“: zur Ästhetik der Elektronik-Band Cabaret Voltaire.
- „Industrial Music for Industrial People“ - Begriffserklärungen und kontextuelle Analyse der „First Wave“ 1973-1981.
- Intermedialitäten im Werk von Cabaret Voltaire durch Einflüsse aus Avantgarde-Kunst, Literatur der Postmoderne und Musique concrète: Dadaismus, William S. Burroughs und John Cage.
- Produktion und Rezeption: Die Medien-Ästhetik im audiovisuellen Werk der „Noise-Art-Terrorists“ Cabaret Voltaire
- Schlussteil: Zusammenfassung, Kommentierung, Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die (Medien-)Ästhetik des audiovisuellen Werks der Elektronik-Band Cabaret Voltaire im Kontext ihrer soziokulturellen Dimension und analysiert, wie diese Ästhetik als Ausdruck kritischer Reflexion der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit wahrgenommen wurde.
- Die Entstehung und Entwicklung von „Industrial Music“ im Kontext der 3. Industriellen Revolution.
- Intermediale Einflüsse von Avantgarde-Kunst, Literatur der Postmoderne und Musique concrète auf das Werk von Cabaret Voltaire.
- Die Rolle der Medienästhetik in der Produktion und Rezeption des musikalischen Werks von Cabaret Voltaire.
- Die Bedeutung von Bild, Text und Klang in der multimedialen Gestaltung des Werks von Cabaret Voltaire.
- Die Relevanz der audiovisuellen Medienästhetik von Cabaret Voltaire im heutigen digitalen Zeitalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 beleuchtet die soziokulturellen und historiographischen Kontexte, die zur Entstehung und Entwicklung von „Industrial Music“ führten. Die Entstehung der „First Wave“ des Genres in Sheffield und London wird anhand von wichtigen Einflüssen und Schlüsselpersonen analysiert.
Kapitel 2.2 untersucht die intermedialen Einflüsse auf das audiovisuelle Werk von Cabaret Voltaire. Hierbei werden die Einflüsse aus Dadaismus, der Literatur der Postmoderne und Musique concrète, insbesondere von William S. Burroughs und John Cage, analysiert und in Beziehung zum Werk der Band gesetzt.
Kapitel 2.3 analysiert die Produktion und Rezeption des musikalischen Werks von Cabaret Voltaire im Kontext seiner Medienästhetik. Anhand des Musikstücks „Nag Nag Nag“ wird gezeigt, wie Bild, Text und Klang multimedial zusammenwirken und welche medienästhetischen Interpretationsmöglichkeiten sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Industrial Music, Cabaret Voltaire, Medienästhetik, Avantgarde-Kunst, Dadaismus, William S. Burroughs, John Cage, Postmoderne, Musique concrète, Produktion, Rezeption, Multimedia, Sound-Technologie, 3. Industrielle Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Wer war die Band Cabaret Voltaire?
Cabaret Voltaire war eine einflussreiche Elektronik-Band aus Sheffield, die von 1975 bis 1993 aktiv war und als Mitbegründer des "Industrial Music"-Genres gilt.
Welchen Bezug hat der Bandname zur Kunstgeschichte?
Der Name bezieht sich auf das "Cabaret Voltaire" in Zürich, den Gründungsort der Dada-Bewegung, was die enge Verbindung der Band zur Avantgarde-Kunst unterstreicht.
Welche literarischen und künstlerischen Einflüsse prägten die Band?
Neben dem Dadaismus waren vor allem die Literatur der Postmoderne (insbesondere William S. Burroughs), die Musique concrète und Künstler wie John Cage prägend für ihr Werk.
Was wird unter der "Medienästhetik" von Cabaret Voltaire verstanden?
Es handelt sich um das Zusammenwirken von Bild, Text und Klang unter Einsatz von Kommunikationselektronik, das als kritische Reflexion der 3. Industriellen Revolution wahrgenommen wurde.
Ist das Werk von Cabaret Voltaire heute noch relevant?
Die Arbeit untersucht, ob ihre audiovisuelle Ästhetik auch im heutigen digitalen Zeitalter noch als Ausdruck kritischer gesellschaftlicher Reflexion Bestand hat.
- Arbeit zitieren
- Tatjana Nicholson (Autor:in), 2018, "Dada meets Industrial". Zur Ästhetik der Elektronik-Band Cabaret Voltaire, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245827