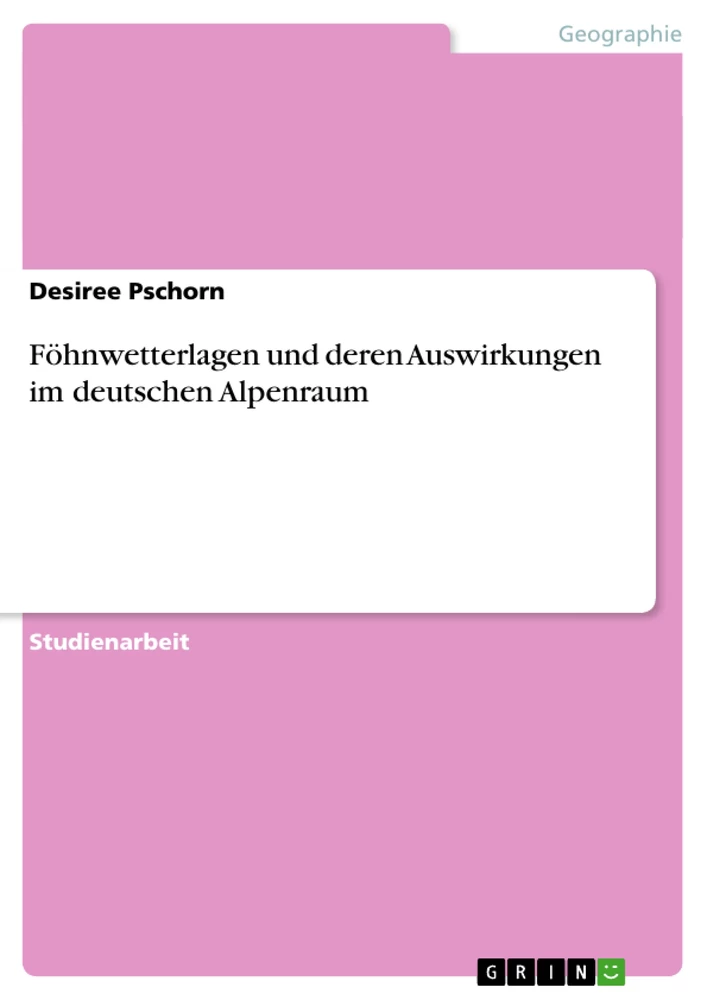Wenn man charakteristische Phänomene der Alpen diskutieren will, ist es notwenig den Alpenraum zu definieren bzw. einzugrenzen. Früher verstand man nämlich unter dem Begriff „Alpen“ nur die Hochweiden, später wurde er auf das ganze Gebirge ausgedehnt. Schon aus diesem Grund bedarf es einer Abgrenzung. Die Alpen stellen heute das größte innereuropäische Gebirge dar. Sie erstrecken sich über rund 181.500 km2 und sieben Staaten haben Anteil an ihnen: Österreich, Schweiz, Frankreich, Fürstentum Lichtenstein, Italien, Slowenien und Deutschland (VEIT 2002:14).
Diese Ausarbeitung soll sich auf den deutschen Alpenraum beschränken und somit auf den bayerischen Teil der Alpen und des Alpenvorlandes.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Alpen im europäischen Klimaraum
- 2.1. Wettergeschehen
- 2.2. Wetterlagen
- 2.3. Typische Wetterlagen im Alpenraum
- 3. Föhnwetterlagen und Föhnentstehung
- 3.1. Definitionen von Föhn
- 3.2. Typische Föhnwetterlagen als Voraussetzung für Föhn
- 3.2.1. Das westeuropäische Tiefdruckgebiet
- 3.3. Die Entstehung des Alpensüdföhns
- 4. Die Alpen als thermische Barriere
- 4.1. Die thermodynamische Föhntheorie
- 4.2. Die antizyklonale Föhntheorie
- 5. Die Alpen als mechanische Barriere
- 6. Die Auswirkungen der Föhnwetterlagen
- 6.1. Physischgeographische Auswirkungen
- 6.1.1. Auswirkungen auf das Klima
- 6.1.2. Auswirkungen auf das Relief
- 6.2. Anthropogeographische Auswirkungen
- 6.2.1. Auswirkungen auf die Vegetation
- 6.2.2. Auswirkungen auf die Tiere
- 6.2.3. Auswirkungen auf den Menschen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit Föhnwetterlagen und deren Auswirkungen im deutschen Alpenraum. Ziel ist es, die Entstehung des Föhns, seine verschiedenen Definitionen und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Klima, das Relief, die Vegetation, die Tierwelt und den Menschen zu untersuchen.
- Definition und Entstehung des Föhns
- Die Alpen als thermische und mechanische Barriere
- Typische Wetterlagen im Alpenraum
- Physisch-geographische Auswirkungen von Föhnwetterlagen
- Anthropogeographische Auswirkungen von Föhnwetterlagen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert den Alpenraum und grenzt den Fokus der Arbeit auf den bayerischen Teil der Alpen und des Alpenvorlandes ein. Sie begründet die Notwendigkeit einer Abgrenzung des Begriffs "Alpen" und legt den Schwerpunkt auf die Untersuchung des Föhns in diesem spezifischen Gebiet.
2. Die Alpen im europäischen Klimaraum: Dieses Kapitel beschreibt das Klima der Alpen als Ergebnis der Interaktion von großräumigen Wettersystemen (Islandtief, Azorenhoch, sibirisches Kältehoch) und deren reliefbedingten Modifikationen. Es analysiert den Einfluss dieser Druckgebilde auf die unterschiedlichen Luftzirkulationen und ihre Auswirkungen auf das Wettergeschehen in den Alpen, unterscheidet zwischen zonaler und meridionaler Zirkulation und erklärt deren Einfluss auf die Wintertemperaturen. Schließlich werden charakteristische Wetterlagen des Alpenraums eingeführt.
3. Föhnwetterlagen und Föhnentstehung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Föhn, diskutiert die Herausforderungen bei der Definition (insbesondere den Begriff "Fallwind") und analysiert die Voraussetzungen für die Entstehung von Föhnwetterlagen. Es betont die Rolle von großräumigen Luftdruckverteilungen und der Interaktion der Luftströmung mit dem Gebirge als Strömungshindernis, wobei der Luftanstieg auf der Luvseite und der Druckfall auf der Leeseite detailliert erklärt werden.
4. Die Alpen als thermische Barriere: Dieses Kapitel erörtert die thermodynamische Föhntheorie und die antizyklonale Föhntheorie, wobei der Fokus auf den physikalischen Prozessen liegt, die zur Entstehung des Föhns beitragen. Es analysiert die Temperatur- und Feuchteänderungen der Luftmassen während des Aufstiegs und Abstiegs über das Gebirge.
5. Die Alpen als mechanische Barriere: Dieses Kapitel betrachtet die Alpen als mechanische Barriere für Luftströmungen und analysiert die Auswirkungen dieser mechanischen Blockade auf die Entstehung des Föhns. Der Schwerpunkt liegt auf den dynamischen Prozessen, die durch die Interaktion der Luftströmung mit der Gebirgslandschaft ausgelöst werden.
6. Die Auswirkungen der Föhnwetterlagen: Dieses Kapitel untersucht umfassend die Auswirkungen von Föhnwetterlagen, sowohl physisch-geographisch als auch anthropogeographisch. Es analysiert die Auswirkungen auf das Klima und das Relief sowie auf die Vegetation, die Tierwelt und den Menschen. Die Auswirkungen werden jeweils detailliert beschrieben und erklärt.
Schlüsselwörter
Föhn, Alpen, Wetterlagen, Klima, Relief, Vegetation, Tierwelt, Mensch, Druckgebilde, Luftzirkulation, thermodynamische Föhntheorie, antizyklonale Föhntheorie, physikalische Prozesse, anthropogeographische Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Föhnwetterlagen und deren Auswirkungen im deutschen Alpenraum"
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit Föhnwetterlagen und ihren Auswirkungen im deutschen Alpenraum. Sie untersucht die Entstehung des Föhns, verschiedene Definitionen des Begriffs, die Rolle der Alpen als thermische und mechanische Barriere, typische Wetterlagen im Alpenraum und die physisch-geographischen sowie anthropogeographischen Auswirkungen von Föhnwetterlagen auf Klima, Relief, Vegetation, Tierwelt und den Menschen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) definiert den Untersuchungsraum und den Fokus auf den bayerischen Alpenraum. Kapitel 2 beschreibt das Klima der Alpen im europäischen Kontext, Kapitel 3 behandelt Definitionen und Entstehung des Föhns. Kapitel 4 und 5 befassen sich mit den Alpen als thermische bzw. mechanische Barriere. Kapitel 6 analysiert die Auswirkungen von Föhnwetterlagen, und Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Theorien zur Föhnentstehung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die thermodynamische Föhntheorie und die antizyklonale Föhntheorie, die die physikalischen Prozesse der Föhnentstehung erklären. Die thermodynamische Theorie konzentriert sich auf die Temperatur- und Feuchteänderungen der Luftmassen während des Aufstiegs und Abstiegs über das Gebirge, während die antizyklonale Theorie den Einfluss großräumiger Druckverhältnisse betont.
Welche Auswirkungen von Föhnwetterlagen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl physisch-geographische als auch anthropogeographische Auswirkungen. Zu den physisch-geographischen Auswirkungen gehören die Einflüsse auf das Klima und das Relief. Zu den anthropogeographischen Auswirkungen gehören die Einflüsse auf die Vegetation, die Tierwelt und den Menschen.
Welche Rolle spielen die Alpen bei der Föhnentstehung?
Die Alpen spielen eine entscheidende Rolle als sowohl thermische als auch mechanische Barriere. Als thermische Barriere beeinflussen sie die Temperatur und Feuchte der Luftmassen durch adiabatische Prozesse. Als mechanische Barriere zwingen sie die Luftmassen zum Aufsteigen, was zur Wolkenbildung und Niederschlag auf der Luvseite und zum Abstieg und Erwärmung der Luft auf der Leeseite führt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Föhn, Alpen, Wetterlagen, Klima, Relief, Vegetation, Tierwelt, Mensch, Druckgebilde, Luftzirkulation, thermodynamische Föhntheorie, antizyklonale Föhntheorie, physikalische Prozesse und anthropogeographische Auswirkungen.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Unterkapiteln ist im HTML-Dokument enthalten, das die Grundlage dieser FAQs bildet.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit den Themen Klima, Meteorologie und Geographie im Alpenraum befasst. Sie ist besonders relevant für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit Föhnwetterlagen und deren Auswirkungen befassen.
- Arbeit zitieren
- Desiree Pschorn (Autor:in), 2007, Föhnwetterlagen und deren Auswirkungen im deutschen Alpenraum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124661