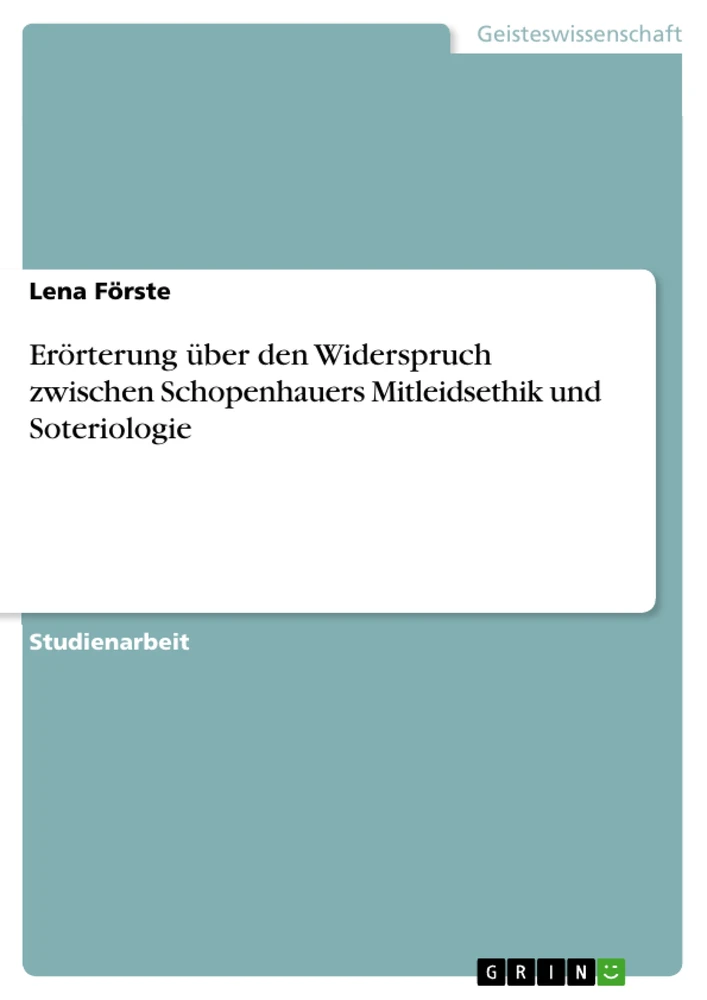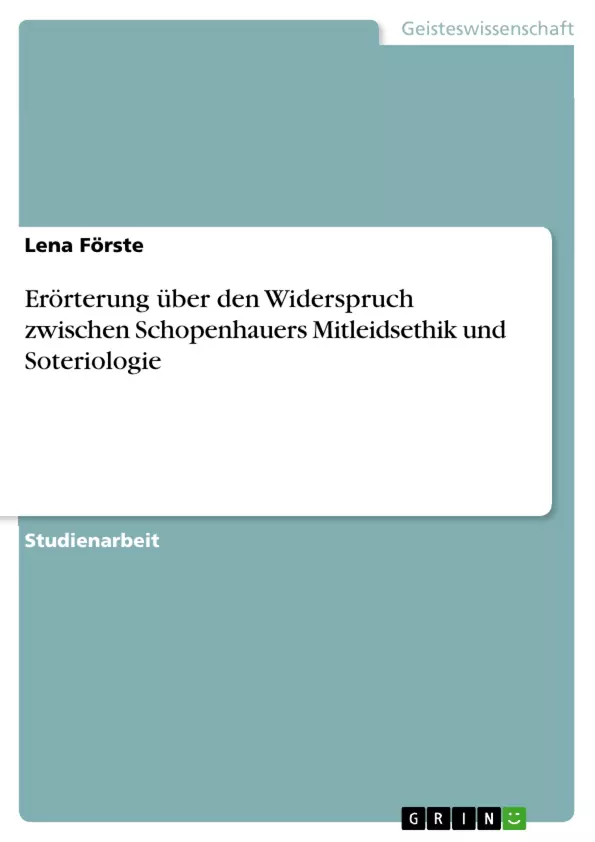Der erste Teil dieser Arbeit soll der Klärung einiger wichtiger Begriffe sowie Grundlagen der schopenhauerschen Philosophie dienen. Dazu gehört zunächst ein kurzer Einblick in Schopenhauers Willensmetaphysik. Schopenhauer hat an seine Philosophie den Anspruch, dass ihr ein einziger, einheitlicher Gedanke zu Grunde liegen soll. Entsprechend baut er sowohl seine Erlösungslehre als auch seine Ethik auf seiner Metaphysik auf und ohne zunächst die Grundlagen dieser Metaphysik zu erläutern, kann Schopenhauers Mitleidsethik nicht entsprechend erklärt werden. Anschließend an diesen Teil werden sowohl die Mitleidsethik, also auch die Erlösungslehre Schopenhauers dargestellt. Dabei wird außerdem ein Einblick in den Zusammenhang der beiden Lehren untereinander gegeben sowie der Zusammenhang mit der Metaphysik dargestellt. Weiterhin werden in diesem bis dahin darstellenden Teil vermeintliche Schwachstellen in Schopenhauers Philosophie angemerkt, jedoch nicht weiter ausgeführt. Sie sollen dem Leser vielmehr die Möglichkeit geben, diese Anmerkungen zu überdenken oder sich anderweitig damit zu beschäftigen. Anschließend daran soll die Frage diskutiert werden, inwiefern sich Mitleidsethik und Verneinung des Willens widersprechen oder ob sie miteinander vereinbart werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schopenhauers Willensmetaphysik
- Schopenhauers Mitleidsethik
- Das Leben als Leid und die Verneinung des Willens
- Kritische Stellungnahme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den vermeintlichen Widerspruch zwischen Schopenhauers Mitleidsethik und seiner Lehre von der Verneinung des Willens. Sie analysiert die zentralen Elemente von Schopenhauers Philosophie, insbesondere seine Willensmetaphysik, seine Mitleidsethik und seine Erlösungslehre. Ziel ist es, die Argumentation Schopenhauers zu verstehen und zu beurteilen, inwiefern sich seine Ethik mit seiner Soteriologie in Einklang bringen lässt.
- Schopenhauers Willensmetaphysik als Grundlage seiner Ethik
- Schopenhauers Mitleidsethik und die Rolle des Leids
- Die Verneinung des Willens als Weg zur Erlösung vom Leid
- Der vermeintliche Widerspruch zwischen Mitleidsethik und Soteriologie
- Kritik und Einordnung der Argumentation Schopenhauers
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Schopenhauers pessimistische Sicht auf die Welt als Ausgangspunkt dar und führt die Problematik des vermeintlichen Widerspruchs zwischen seiner Mitleidsethik und Soteriologie ein. Sie erläutert die Methode und die Quellen der Arbeit.
- Schopenhauers Willensmetaphysik: Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge von Schopenhauers Willensmetaphysik, die seinen Überlegungen zur Ethik und Soteriologie zugrunde liegen. Es erklärt die Konzepte des Willens als Wesen der Welt und der Vorstellung als Medium der menschlichen Erkenntnis.
- Schopenhauers Mitleidsethik: Dieses Kapitel untersucht Schopenhauers Mitleidsethik und begründet sie aus seiner Willensmetaphysik. Es erklärt, warum Schopenhauer das Leid als Fundament seiner Ethik begreift und warum mitleidige Handlungen moralisch sind.
- Das Leben als Leid und die Verneinung des Willens: Dieses Kapitel behandelt Schopenhauers Soteriologie und erklärt, warum er die Verneinung des Willens als einzigen Weg zur vollständigen Erlösung vom Leid betrachtet. Es geht auf die Frage ein, wie sich die Verneinung des Willens mit der Mitleidsethik vereinbaren lässt.
Schlüsselwörter
Schopenhauers Philosophie, Willensmetaphysik, Mitleidsethik, Soteriologie, Verneinung des Willens, Leid, Erlösung, Moral, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Schopenhauers Mitleidsethik?
Sie besagt, dass wahre Moral aus dem Mitleid entspringt, da wir im anderen dasselbe leidende Wesen erkennen, das wir selbst sind (Überwindung des Individuationsprinzips).
Was versteht Schopenhauer unter der "Verneinung des Willens"?
Es ist die soteriologische (erlösende) Einsicht, den blinden Lebenswillen aufzugeben, um dem ewigen Kreislauf aus Leiden und Begehren zu entkommen.
Wo liegt der Widerspruch zwischen Ethik und Soteriologie?
Der Widerspruch besteht darin, dass die Ethik das Mitleid mit anderen fordert, während die Soteriologie die totale Abkehr von der Welt und allen Bindungen (Verneinung) anstrebt.
Wie begründet Schopenhauer das Leben als Leid?
Da der Wille niemals dauerhaft befriedigt werden kann, führt jedes erfüllte Streben nur zu neuer Langeweile oder neuem Begehren, was eine endlose Kette von Mangel und Leid bedeutet.
Welche Rolle spielt die Willensmetaphysik in seiner Philosophie?
Sie ist das Fundament: Der Wille ist das "Ding an sich", das Wesen der Welt, während alles Sichtbare nur dessen Erscheinung (Vorstellung) ist.
- Citar trabajo
- Master of Education Lena Förste (Autor), 2014, Erörterung über den Widerspruch zwischen Schopenhauers Mitleidsethik und Soteriologie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1246713