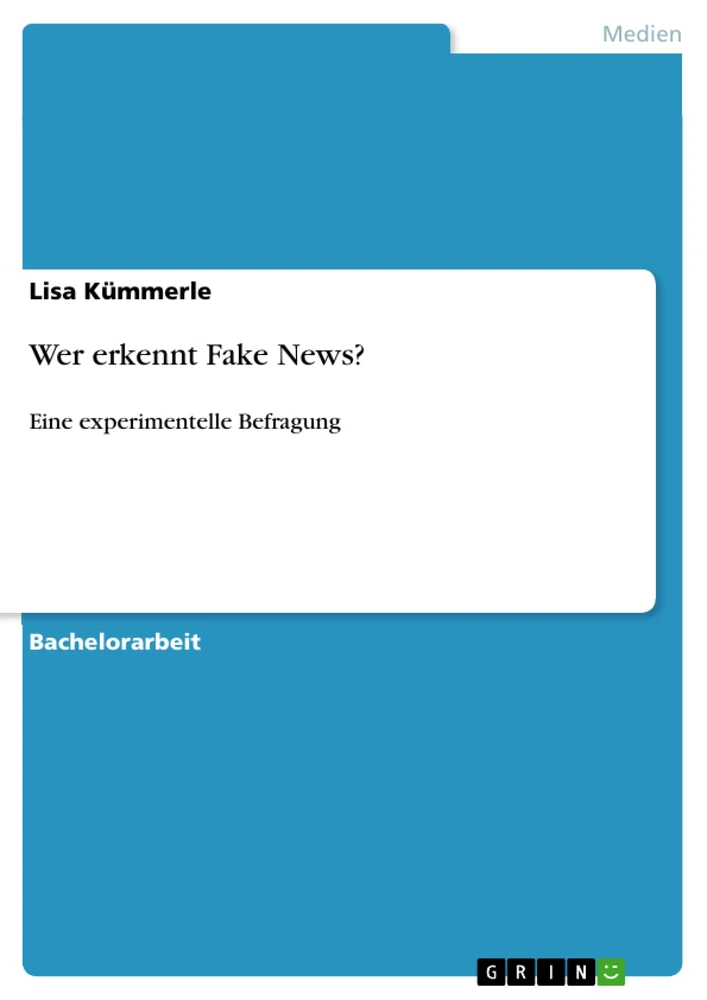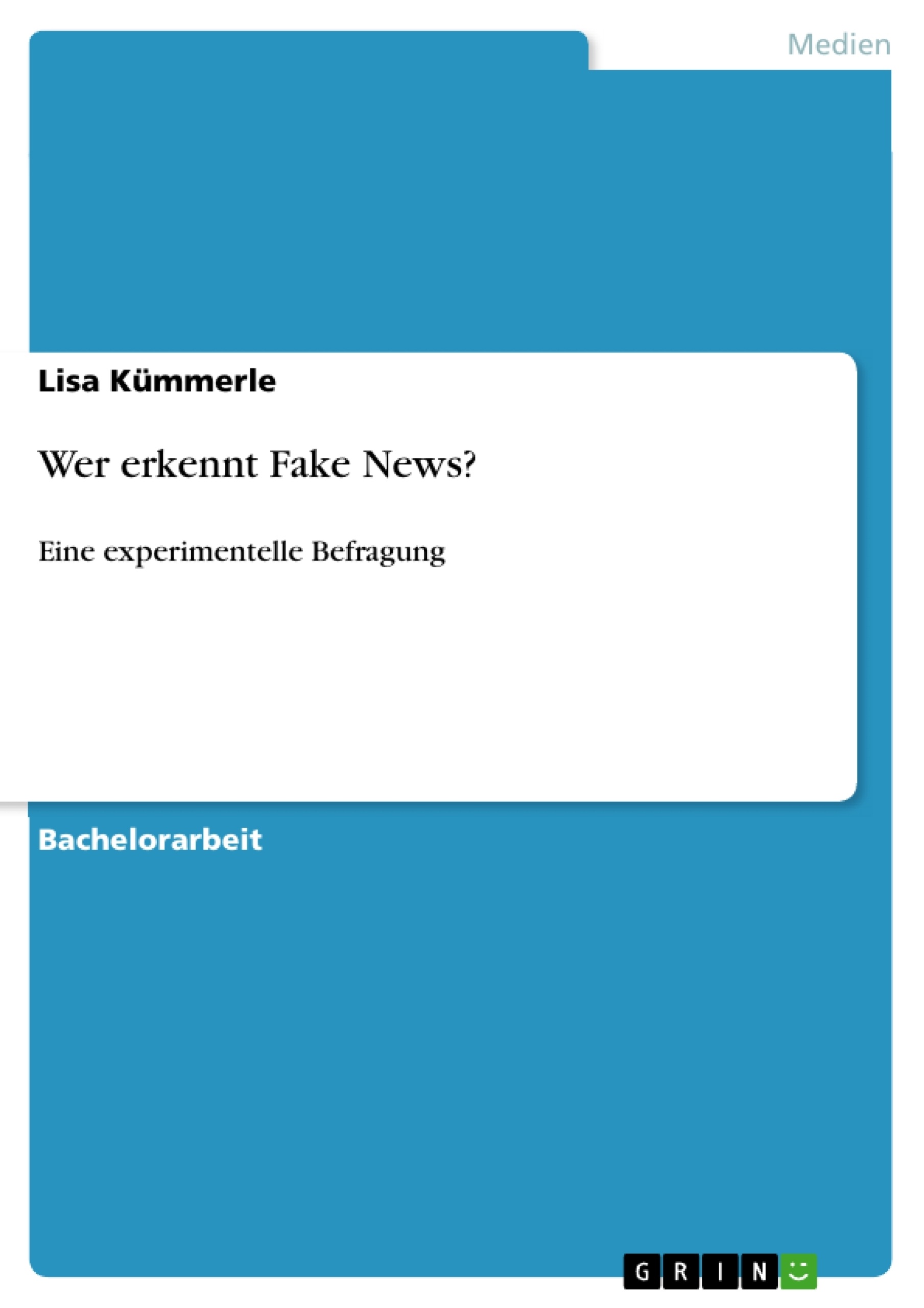Fake News bzw. Desinformationen sind spätestens seit dem US-Wahlkampf 2016 medial präsent und den Bürgern ein Begriff. Auch in Deutschland werden Fake News verbreitet und rezipiert. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird zunächst ein Überblick über bisherige Forschung zum Thema Fake News gegeben und deren Definition, Verbreitung, politische Hintergründe und Wirkung dargestellt. Mittels einer quantitativen experimentellen Befragung wird anschließend untersucht, wer Fake News erkennt und in welchem Zusammenhang dies mit bestimmten Merkmalen steht. Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich Zusammenhänge zwischen dem Erkennen von Fake News und dem Geschlecht, dem Einkommen, einer mit der politischen Orientierung meinungskonformen Darstellung der Nachricht und der internen Self-Efficacy der Probanden finden lassen. Nicht belegt werden können Zusammenhänge mit dem Alter, der Einstellung gegenüber etablierten Medien, der Bildung, der politischen Orientierung an sich, der externen Self-Efficacy und der Mediennutzung zu Informationszwecken der Probanden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bisherige Forschung zu Fake News.
- 2.1. Der Begriff „Fake News“.
- 2.2. Fake News und die Krise der etablierten Medien......
- 2.3. Verbreitung von Fake News ..........\li>
- 2.3.1. Die Rolle des Rechten Milieus bei der Verbreitung von Fake News
- 2.4. Wirkung von Fake News .........
- 2.5. Wer erkennt eigentlich Fake News? - Bisherige Forschung, Forschungsfrage und Hypothesen....
- 2.6. Politische Orientierung: Das Links- Rechts- Schema
- 3. Methode...
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Abhängige Variable: Fake News erkennen.
- 4.2. Hypothese 1: Zusammenhang mit der Einstellung gegenüber Medien
- 4.3. Hypothese 2: Zusammenhang mit Alter und Geschlecht.
- 4.4. Hypothese 3: Zusammenhang mit dem Bildungsabschluss
- 4.5. Zusammenhang mit dem Einkommen …..\li>
- 4.6. Zusammenhang mit Social Media und Online-Nachrichtennutzung
- 4.7. Zusammenhang mit der politischen Orientierung
- 4.8. Zusammenhang mit der politischen Meinungskonformität der Nachricht .
- 4.9. Zusammenhang mit der Self-Efficacy.
- 5. Schlussbetrachtung.…......
- 6. Diskussion .......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Frage, wer Fake News erkennt. Die Studie befasst sich mit dem Phänomen der Desinformation und analysiert, welche Faktoren das Erkennen von Fake News beeinflussen können.
- Definition und Verbreitung von Fake News
- Die Rolle von etablierten Medien im Kontext von Fake News
- Die Wirkung von Fake News auf die öffentliche Meinung
- Faktoren, die das Erkennen von Fake News beeinflussen, wie z.B. Geschlecht, Alter, Bildung, politische Orientierung und Mediennutzung
- Die Bedeutung von Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy) für die Identifizierung von Fake News
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Die Einleitung stellt das Thema Fake News vor und erläutert dessen Relevanz im Kontext der heutigen medialen Landschaft. Sie stellt die Forschungsfrage und die zentralen Hypothesen der Arbeit vor.
- Kapitel 2: Bisherige Forschung zu Fake News - Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zum Thema Fake News. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt, die Verbreitung von Fake News analysiert und deren Wirkung auf die Gesellschaft beleuchtet.
- Kapitel 3: Methode - Das Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Forschungsarbeit, einschließlich der Stichprobengröße, der verwendeten Datenerhebungsmethoden und der verwendeten statistischen Analysen.
- Kapitel 4: Ergebnisse - Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung. Es werden die Zusammenhänge zwischen dem Erkennen von Fake News und verschiedenen demografischen und soziokulturellen Faktoren analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche der Arbeit sind Fake News, Desinformation, Medienkrise, Politische Orientierung, Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy), experimentelle Befragung, quantitativ, mediale Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren beeinflussen das Erkennen von Fake News?
Die Forschung zeigt Zusammenhänge mit dem Geschlecht, dem Einkommen, der persönlichen Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy) und der Übereinstimmung der Nachricht mit der eigenen politischen Meinung.
Spielt das Alter eine Rolle beim Identifizieren von Desinformation?
In der vorliegenden Studie konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter der Probanden und ihrer Fähigkeit, Fake News zu erkennen, belegt werden.
Was bedeutet „politische Meinungskonformität“ im Kontext von Fake News?
Menschen neigen dazu, Nachrichten eher als wahr einzustufen, wenn diese ihr eigenes Weltbild oder ihre politische Orientierung bestätigen, was das Erkennen von Falschmeldungen erschwert.
Welchen Einfluss hat die „Self-Efficacy“ auf den Umgang mit Medien?
Personen mit einer hohen internen Selbstwirksamkeit trauen sich eher zu, Informationen kritisch zu hinterfragen und Fake News erfolgreich zu entlarven.
Wie wirken Fake News auf die Gesellschaft?
Fake News können die öffentliche Meinung manipulieren, das Vertrauen in etablierte Medien untergraben und politische Polarisierungen verstärken, insbesondere in sozialen Netzwerken.
- Quote paper
- Lisa Kümmerle (Author), 2019, Wer erkennt Fake News?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247317