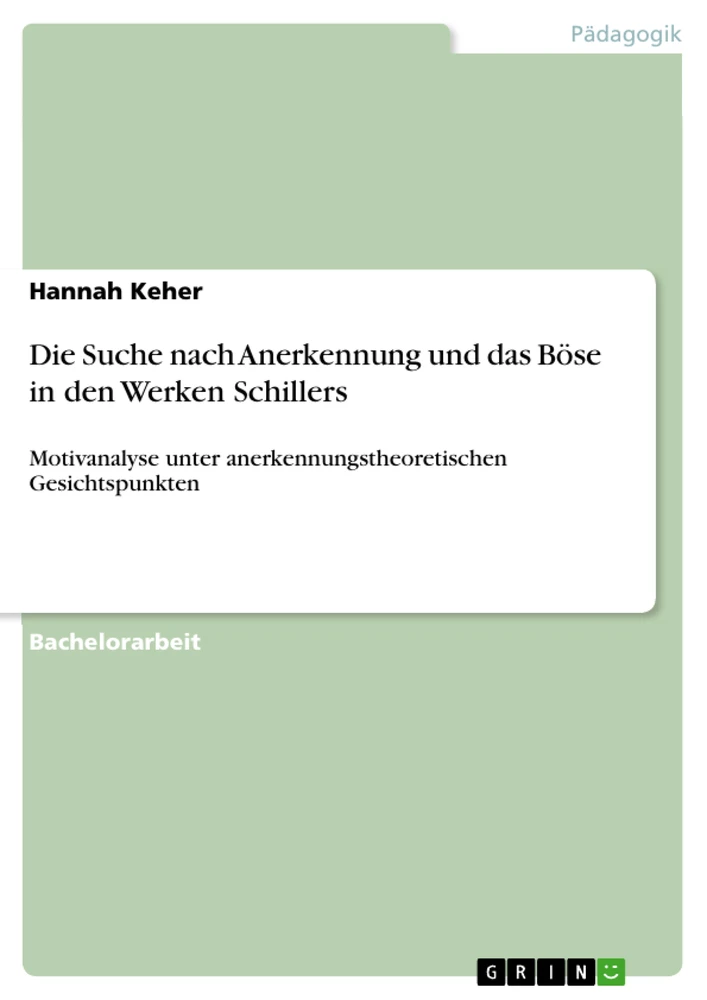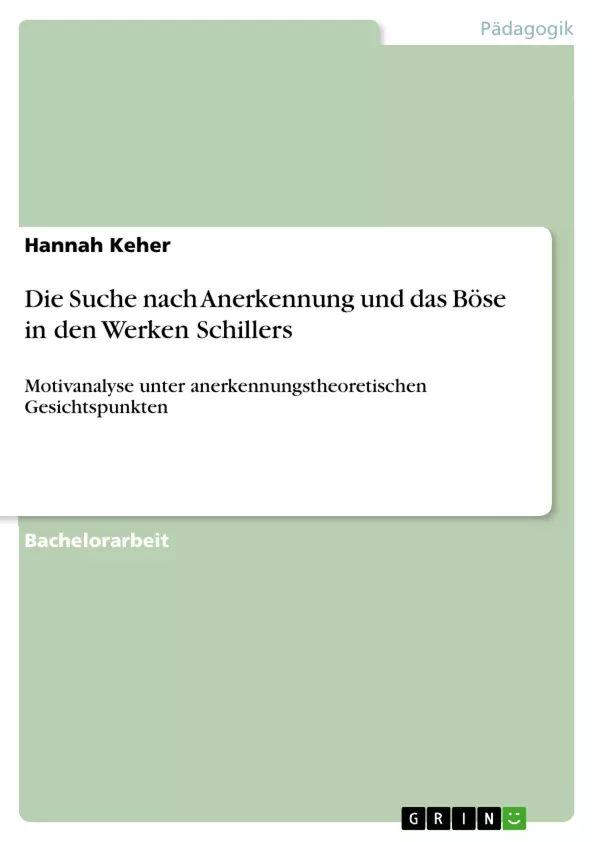Die folgende Arbeit setzt sich mit den Auswirkungen fehlender Anerkennung auf die Persönlichkeit und die Taten literarischer Figuren in den Werken „Die Räuber“ und „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ von Schiller auseinander. Viele Schriften, die im Zeitalter der Aufklärung entstanden sind, beschäftigen sich mit Verbrechen. Auch in den behandelten Texten ist der Bruch von Regeln ein zentrales Thema.
Im Zentrum des Interesses steht die Untersuchung, was einen Menschen dazu treibt, unmoralisch zu handeln und anderen Personen psychischen oder physischen Schaden zuzufügen. Dabei geht es weniger um die Verbrechen an sich, sondern um die Faktoren, die zu diesen geführt haben. Um ein umfassenderes Verständnis für das unmoralische Handeln der einzelnen Protagonisten zu schaffen, wird deren Verhalten auf Grundlage bestehender Anerkennungstheorien untersucht und verglichen. Wesentlich dabei ist, dass es nicht nur eine Form des Bösen gibt und nicht nur bestimmte Personen dazu fähig sind. Schiller beschreibt in seinen Werken vier außerordentliche Menschen, deren Taten von vielen Faktoren abhängen, die sich im Umfang dieser Arbeit nicht ergründen lassen. Allen wird jedoch Anerkennung entzogen oder verwehrt, weshalb dieser Aspekt in der folgenden Arbeit genauer untersucht wird.
Folgend wird der Frage nachgegangen in welchem Ausmaß die bösen Taten der behandelten Figuren in den Werken Schillers durch fehlende Anerkennung bedingt werden und welche Prozesse dabei eine Rolle spielen. Die These lautet, dass der Mensch nicht böse geboren wird, sondern sein Charakter durch die äußeren Zustände geformt wird. Anerkennung, sowohl von außen als auch gegenüber der eigenen Person, ist ein Grundbedürfnis und ein Teil der positiven Selbstwahrnehmung. Fehlt diese oder wird sie dem Menschen entzogen, kann sich das äußerst negativ auf den die persönliche Wahrnehmung und die Handlungen der Betroffenen auswirken. Ein Leben, das sich an die gesellschaftlichen Erwartungen richtet, ist dabei noch nicht ausreichend, um wertgeschätzt zu werden. Im Fall der vorliegenden Texte lässt sich gut erkennen, dass sowohl Außenseiterfiguren als auch beliebte Gesellschaftsmitglieder Opfer ungerechter Behandlungen seitens der Gesellschaft werden können. Ablehnung kann aus vielen Gründen geschehen und je nach Persönlichkeit und gemachten Erfahrungen, unterschiedlich aufgefasst und verarbeitet werden. Deshalb wird nicht davon ausgegangen, dass Ablehnung in jedem Fall böse Handlungen bedingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Anerkennung und des Bösen
- Anerkennungsmodelle
- Honneth
- Charles Taylor
- Das Böse im philosophischen Diskurs
- Rousseau
- Susan Neiman
- Anerkennungsmodelle in den Werken
- Anerkennung als Teil der Identitätsgewähr
- Anerkennung durch Gleichheit vor dem Gesetz
- Anerkennung durch Liebesbeziehungen
- Anerkennung durch Solidarität
- Das Böse in den Werken
- Formen des Bösen in den Charakteren
- Franz und Spiegelberg
- Christian und Karl
- Franz und Christian
- Karl und Franz
- Das Böse als Resultat fehlender Anerkennung
- Das Böse im Kampf um Anerkennung
- Resultat
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen fehlender Anerkennung auf die Persönlichkeit und die Taten literarischer Figuren in den Werken „Die Räuber“ und „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ von Schiller. Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass äußere Umstände wie fehlende Anerkennung Menschen zu bösen Taten treiben können und jede Person zu negativen Handlungen bereit ist, wenn die Zeit und die Umstände dies begünstigen.
- Die Auswirkungen von fehlender Anerkennung auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Die Verbindung zwischen Anerkennung und moralischem Handeln
- Die Rolle von gesellschaftlichen Erwartungen bei der Entstehung von Ungerechtigkeit
- Die Analyse von literarischen Figuren unter anerkennungstheoretischen Gesichtspunkten
- Die Frage nach der Fähigkeit des Menschen zur Verübung von bösen Taten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und stellt die Forschungsfrage sowie die These der Arbeit vor.
Im Kapitel „Grundlagen der Anerkennung und des Bösen“ werden verschiedene Anerkennungstheorien, insbesondere von Axel Honneth und Charles Taylor, vorgestellt. Weiterhin wird ein Einblick in den philosophischen Diskurs des Bösen gegeben, wobei auf die Ansichten von Rousseau und Susan Neiman eingegangen wird.
Das Kapitel „Anerkennungsmodelle in den Werken“ widmet sich der Anwendung der besprochenen Anerkennungstheorien auf die Werke Schillers. Es wird untersucht, wie verschiedene Formen der Anerkennung in den Werken dargestellt werden und wie diese mit der Identität der Figuren zusammenhängen.
Das Kapitel „Das Böse in den Werken“ analysiert die bösen Taten der Figuren in den Werken Schillers unter dem Gesichtspunkt fehlender Anerkennung. Es werden verschiedene Formen des Bösen, sowie die Motivationen und Hintergründe der Figuren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Anerkennung, Böses, Identitätsbildung, moralische Handlung, literarische Analyse, Schiller, „Die Räuber“, „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, Honneth, Taylor, Rousseau, Neiman.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Anerkennung und das Böse bei Schiller zusammen?
Die Arbeit zeigt auf, dass der Entzug von Anerkennung literarische Figuren wie Karl Moor oder den „Verbrecher aus verlorener Ehre“ zu unmoralischen und bösen Taten treiben kann.
Wird der Mensch laut dieser Analyse böse geboren?
Nein, die These lautet, dass der Charakter durch äußere Zustände geformt wird. Böse Taten sind oft ein Resultat fehlender Wertschätzung durch die Gesellschaft.
Welche Anerkennungsmodelle werden untersucht?
Es werden primär die Theorien von Axel Honneth und Charles Taylor herangezogen, um die Identitätsbildung der Protagonisten zu erklären.
Welche Werke von Schiller werden analysiert?
Die Untersuchung konzentriert sich auf das Drama „Die Räuber“ und die Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“.
Welche philosophischen Ansichten zum Bösen werden diskutiert?
Die Arbeit bezieht Positionen von Jean-Jacques Rousseau und Susan Neiman ein, um den Ursprung destruktiven Verhaltens zu beleuchten.
- Citar trabajo
- BEd Hannah Keher (Autor), 2020, Die Suche nach Anerkennung und das Böse in den Werken Schillers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247321