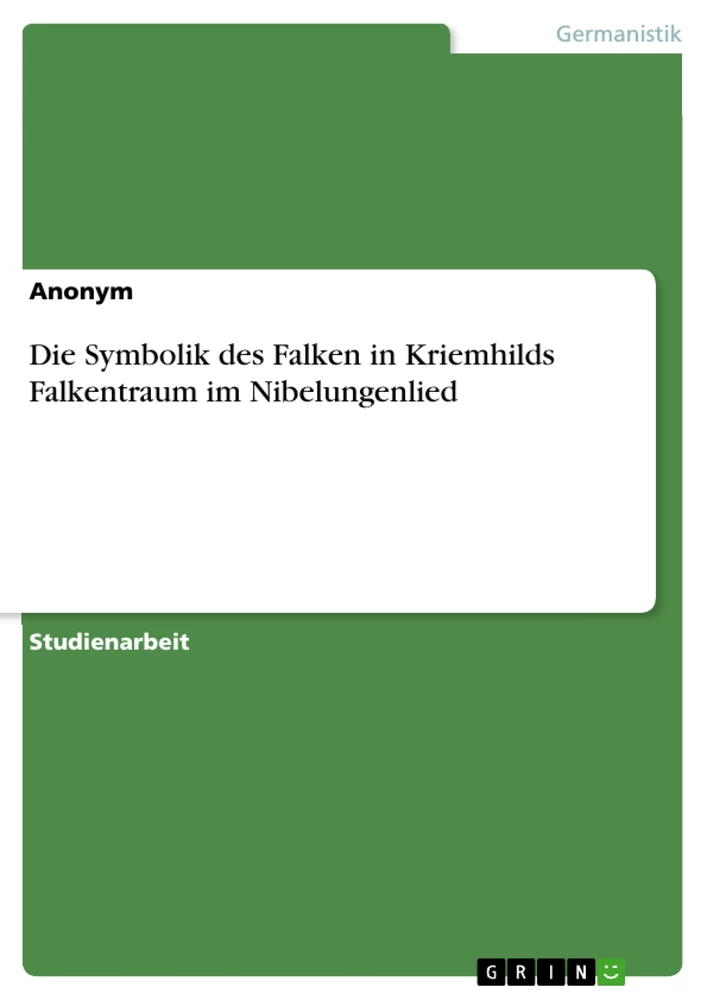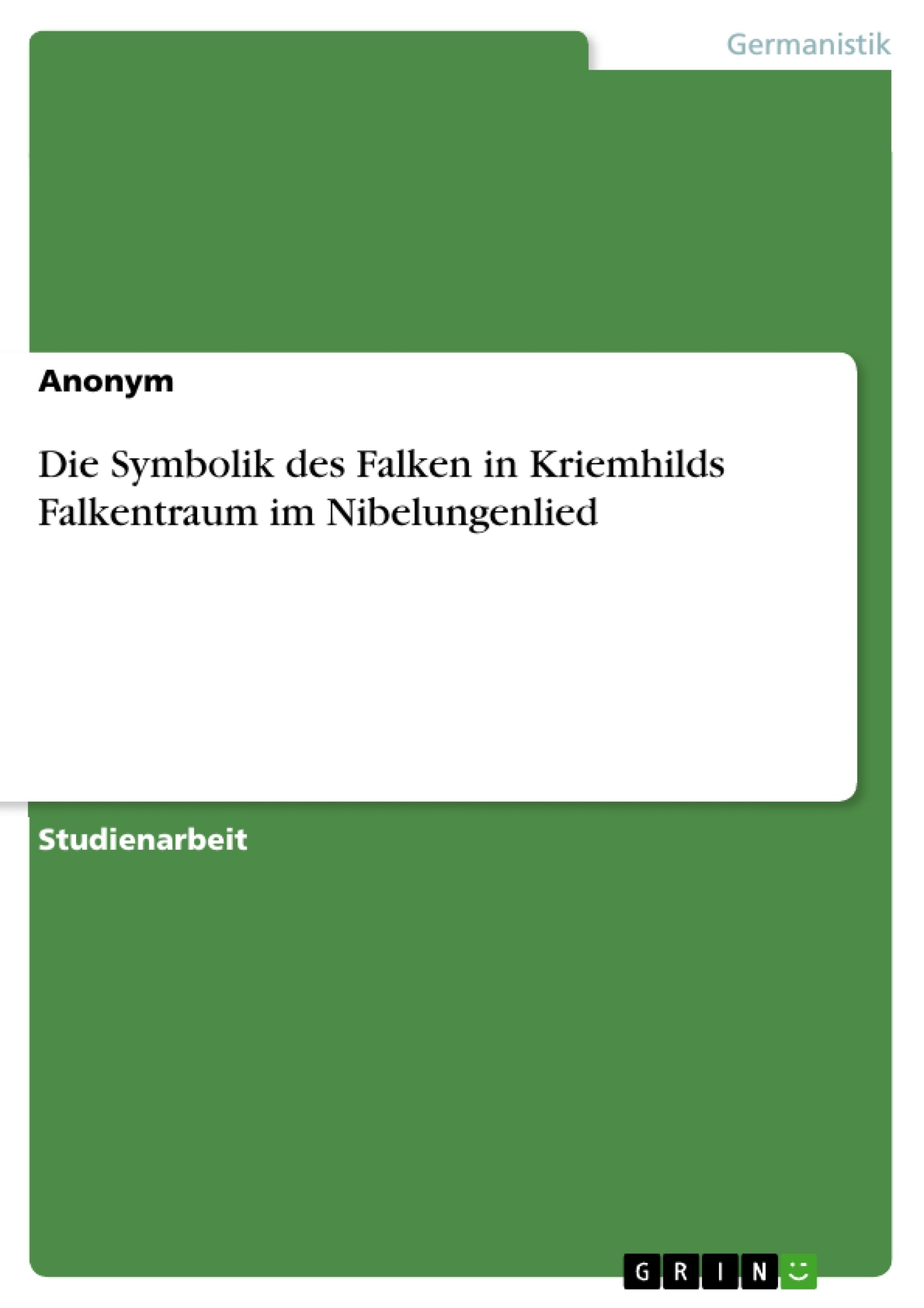Der eigentliche Falkentraum nimmt im Gesamtwerk des Nibelungenliedes gerade einmal zwei Strophen ein. Trotz der Kürze kommt ihm jedoch eine bedeutende Rolle im Nibelungenlied zu. Zum einen bildet er das erste dargestellte Handlungselement des Textes. Zum anderen nimmt er im Hinblick auf den Handlungsverlauf eine zentrale Position ein, da er Siegfrieds Tod durch die Interpretation Utes vorausdeutet.
Leitfrage dieser Arbeit ist dabei unter anderem die Bedeutung des Falken für Kriemhilds Traum. Welche Rolle spielt es, dass es sich um einen Falken handelt? Könnte man das Falkenmotiv durch ein anderes ersetzen? Welche Hintergründe hat die Wahl des Falken? Spiegelt der Falkentraum einfach das Verständnis der Zeit wider und reiht sich in zahlreiche Falkenliteratur ein oder kommt hier eine besondere Bedeutung zum Tragen? Gibt es Alleinstellungsmerkmale und wenn ja, welche? Maßgebend ist dafür nicht nur der Falke als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand, sondern vor allem der Falke in seiner dichterischen Funktion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Symbolik
- Tiersymbolik im Mittelalter
- Traumsymbolik im Mittelalter
- Symbolik des Falken in der mittelalterlichen Literatur
- Der Falke als Symbol für den Adel
- Der Falke als Symbol für den Helden
- Der Falke als Symbol für den Geliebten
- Der Falke als Symbol für Freiheit
- Symbolik des Falken in der Traumdeutung
- Kriemhilds Falkentraum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Falkentraum in Kriemhilds Traum im Nibelungenlied. Es soll die Symbolik des Falken in Kriemhilds Traum untersucht werden und dessen Bedeutung für den weiteren Verlauf der Handlung aufgezeigt werden. Die Arbeit geht dabei der Frage nach, welche Rolle der Falke in Kriemhilds Traum spielt und ob er durch ein anderes Motiv ersetzt werden könnte.
- Analyse des Falken als Symbol in der mittelalterlichen Literatur
- Untersuchung der Rolle von Träumen und ihrer Deutung im Mittelalter
- Bedeutung des Falken als Symbolträger im Falkentraum
- Interpretation des Falkentraums im Kontext der mittelalterlichen Traumdeutung
- Analyse des Falkentraums im Hinblick auf seine Einzigartigkeit und Besonderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage und die Forschungsmethodik vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Symbolik des Falken, der Tiersymbolik und der Traumsymbolik im Mittelalter. Es werden grundlegende Definitionen und die Bedeutung dieser Symbole in der mittelalterlichen Gesellschaft beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Symbolik des Falken in der mittelalterlichen Literatur und analysiert verschiedene Bedeutungen des Falken als Symbol für den Adel, den Helden, den Geliebten und die Freiheit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Symbolik, Falkentraum, Nibelungenlied, Mittelalter, Tiersymbolik, Traumsymbolik, Adel, Held, Geliebter, Freiheit, Traumdeutung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Die Symbolik des Falken in Kriemhilds Falkentraum im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247579