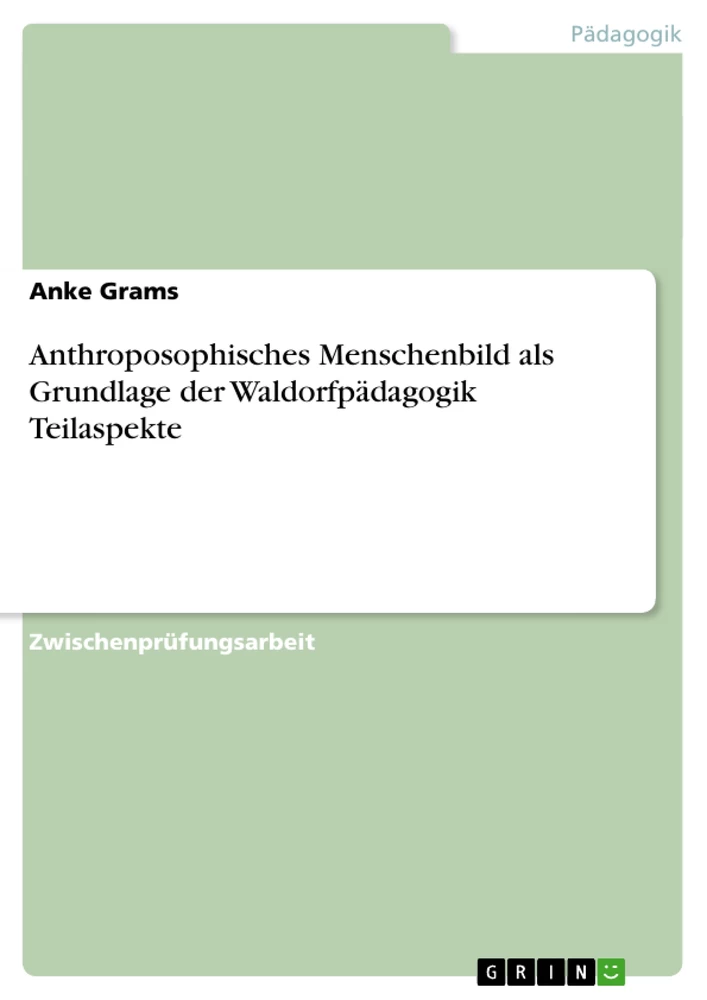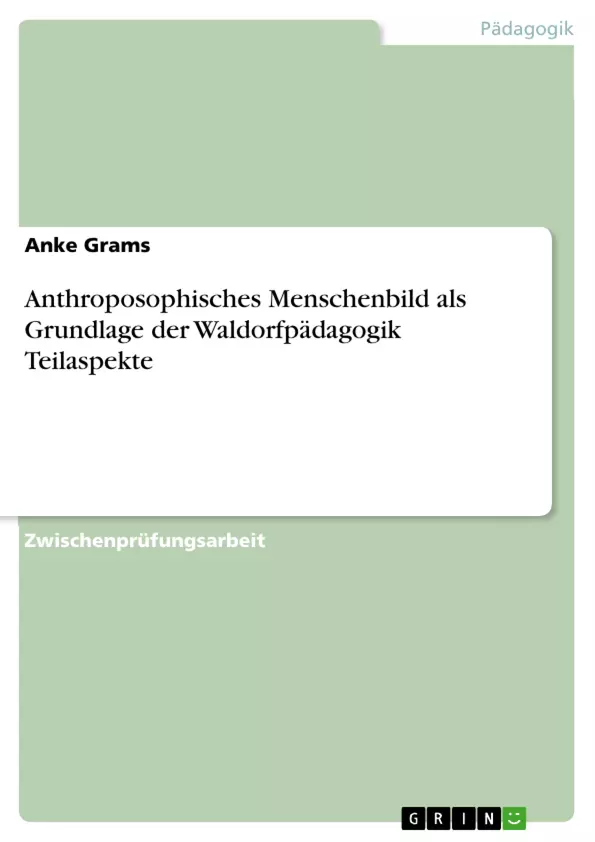Das Interesse an der von Rudolf Steiner Anfang des 19. Jahrhunderts veröffentlichten Geisteswissenschaft namens Anthroposophie und den 1919 gegründeten Waldorfschulen ist groß. Waldorfschulen, Waldorfkindergärten, anthroposophische Weiterbildungen etc. gründen und vergrößern sich stetig. Die Plätze in Waldorfschulen und –kindergärten werden bereits Jahre im voraus belegt und die Klassen sind in der Regel bis zum äußersten Maximum gefüllt (bis zu 40 SchülerInnen pro Klasse unter Umständen).
Es stellt sich die Frage, warum Schulen, die sich jeder wissenschaftlichen Untersuchung widersetzen und über dessen Konzeption daher keine wissenschaftlichen Untersuchungen und Forschungen existieren, einen derartigen Zulauf verzeichnen können.
Einer der Gründe wird sicherlich in der Darstellung der Waldorfschulen von anthroposophischer Seite begründet sein. Anthroposophie selber als Weltanschauung und Lebenseinstellung weist viele Ähnlichkeiten zu anderen esoterischen Lehren auf, welche primär im Kontrast zu der ständig zunehmenden Technisierung, Rationalität und vor allem einer als „festgefahren“ und staatlich kontrollierten sowie bestimmten Erziehung stehen.
Übersinnliche Welten, kosmische Vorbestimmung, neue Erkenntnisformen, Reinkarnations- und Karmalehre, das allgemeine Menschenbild der Anthroposophie sollen neue Zugänge zur Wirklichkeit und dem Sinn des Lebens eröffnen. Praktisch umgesetzt soll dies in den anthroposophischen Einrichtungen sein, ohne die Anthroposophie selber zum Thema zu machen. Es soll eine Alternative zu den öffentlichen und stattlichen Einrichtungen geschaffen werden.
Dass Waldorfschulen sich selber nicht als Weltanschauungsschulen sehen, sondern die Anthroposophie lediglich als „..das pädagogische Werkzeug, mit dem in der Waldorfschule gearbeitet wird“1 ist mehr als umstritten. Die klare Verneinung von seiten Rudolf Steiners und der anthroposophischen Bewegung zur Frage der Waldorfschule als Weltanschauungsschule, bezeichnet Johannes Kiersch als „weitverbreitete Torheit, einen Unterricht für möglich zu halten, der nicht weltanschauungsbildend wirkt.“2
Zwar wird wie erwähnt die Anthroposophie selber nicht thematisiert, doch die anthroposophische Weltanschauung dient als Grundlage auch für den Lehrplan der Waldorfschulen und gestaltet somit den gesamten Unterricht.
Literatur über Anthroposophie und deren Leitthemen besteht größtenteils aus Arbeiten, welche sich vorwiegend paraphrasierend an den Texten Steiners orientieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beschreibung und Abgrenzung vorliegender Arbeit
- Der Mensch und seine Entwicklung in der Anthroposophie
- Aufbau der menschlichen Person
- Die Entwicklung des Menschen
- Die Entwicklung des Menschen in Bezug auf die Erziehung in der Waldorfpädagogik
- Die menschlichen Temperamente – Aspekte aus Steiners Temperamenten- und Charakterlehre
- Die Rolle des Lehrers in der Waldorfschule
- Aspekte des Lehrplanes in der Waldorfschule
- Deutsch in der Waldorfschule
- Kunst in der Waldorfschule
- Abschließend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Teilaspekte des anthroposophischen Menschenbildes als Grundlage der Waldorfpädagogik. Ziel ist es, einen Einblick in die relevanten Konzepte der Anthroposophie zu geben und deren Einfluss auf den Lehrplan der Waldorfschulen aufzuzeigen. Dies geschieht durch die Betrachtung ausgewählter Elemente des anthroposophischen Menschenbildes und deren Implikationen für die Erziehung.
- Der Aufbau der menschlichen Person nach Steiner
- Die Entwicklung des Menschen in der Anthroposophie
- Der anthroposophische Lehrplan und seine Umsetzung in der Waldorfpädagogik
- Die Rolle des Lehrers in der Waldorfschule
- Steiners Temperamentenlehre und ihre Bedeutung für die Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet das große Interesse an Waldorfschulen und Anthroposophie und stellt die Frage nach den Gründen für deren Popularität. Sie diskutiert die Schwierigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Anthroposophie aufgrund des Mangels an wissenschaftlichen Untersuchungen und der Tendenz zu verehrenden oder ablehnenden, oft unkritischen Darstellungen in der bestehenden Literatur.
Beschreibung und Abgrenzung vorliegender Arbeit: Aufgrund des begrenzten Umfangs konzentriert sich die Arbeit auf Teilaspekte der Anthroposophie, die sich auf die Erziehung und den Lehrplan der Waldorfschulen beziehen. Sie wählt einige Grundzüge des anthroposophischen Menschenbildes aus, darunter den Aufbau der menschlichen Person, deren Entwicklung und Auszüge aus Steiners Temperamentenlehre, um einen Einblick in die anthroposophische Grundlage der Waldorfpädagogik zu ermöglichen.
Der Mensch und seine Entwicklung in der Anthroposophie: Dieses Kapitel beschreibt Steiners dreigliedriges Menschenbild aus physischem, Äther- und Astralleib sowie dem Ich. Es erläutert die jeweiligen Eigenschaften und Funktionen dieser Leiber und deren Zusammenspiel, wobei Steiner's kosmologisches und deterministisches Menschenbild hervorgehoben wird. Die Ausführungen basieren auf Zitaten und Interpretationen aus den Schriften Rudolf Steiners. Die Kapitel untergliederung (4.1-4.4) wird hier zu einer Gesamtbetrachtung zusammengefasst.
Die Rolle des Lehrers in der Waldorfschule: (Da der bereitgestellte Text keinen expliziten Abschnitt zu diesem Thema aufweist, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden. Die Information müsste aus dem vollständigen Text entnommen werden.)
Aspekte des Lehrplanes in der Waldorfschule: Dieses Kapitel (wie im bereitgestellten Text erkennbar) fokussiert auf den Lehrplan der Waldorfschule und untersucht exemplarisch die Fächer Deutsch und Kunst. Es würde im vollständigen Text die spezifischen Ansätze und Methoden dieser Fächer im Kontext der anthroposophischen Pädagogik untersuchen. Die Zusammenfassung der Unterkapitel 6.1 und 6.2 wird hier zu einer Gesamtbetrachtung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, Menschenbild, Leibesgliederung (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich), Lehrplan, Erziehung, Temperamentenlehre, kosmologisches Menschenbild, deterministisches Menschenbild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Teilaspekte des anthroposophischen Menschenbildes als Grundlage der Waldorfpädagogik. Das Ziel ist es, einen Einblick in die relevanten Konzepte der Anthroposophie zu geben und deren Einfluss auf den Lehrplan der Waldorfschulen aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Aufbau der menschlichen Person nach Steiner, die Entwicklung des Menschen in der Anthroposophie, den anthroposophischen Lehrplan und seine Umsetzung in der Waldorfpädagogik, die Rolle des Lehrers in der Waldorfschule und Steiners Temperamentenlehre und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Exemplarisch werden die Fächer Deutsch und Kunst im Waldorflehrplan betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Beschreibung und Abgrenzung der Arbeit, ein Kapitel zum Menschen und seiner Entwicklung in der Anthroposophie, ein Kapitel zur Rolle des Lehrers in der Waldorfschule, ein Kapitel zu Aspekten des Lehrplans (Deutsch und Kunst) und eine Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist das anthroposophische Menschenbild nach Steiner, das in der Arbeit behandelt wird?
Die Arbeit beschreibt Steiners dreigliedriges Menschenbild aus physischem, Äther- und Astralleib sowie dem Ich. Es werden die Eigenschaften und Funktionen dieser Leiber und deren Zusammenspiel erläutert, wobei Steiners kosmologisches und deterministisches Menschenbild hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielt der Lehrer in der Waldorfschule?
Der bereitgestellte Textauszug enthält keine explizite Beschreibung der Rolle des Lehrers. Diese Information muss dem vollständigen Text entnommen werden.
Wie werden Deutsch und Kunst im Waldorflehrplan behandelt?
Der Textauszug zeigt lediglich, dass die Arbeit die spezifischen Ansätze und Methoden der Fächer Deutsch und Kunst im Kontext der anthroposophischen Pädagogik untersucht. Details sind dem vollständigen Text zu entnehmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anthroposophie, Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner, Menschenbild, Leibesgliederung (physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich), Lehrplan, Erziehung, Temperamentenlehre, kosmologisches Menschenbild, deterministisches Menschenbild.
Welche Herausforderungen werden bei der Auseinandersetzung mit Anthroposophie angesprochen?
Die Arbeit spricht die Schwierigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Anthroposophie an, die durch den Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen und die Tendenz zu verehrenden oder ablehnenden, oft unkritischen Darstellungen in der bestehenden Literatur bedingt ist.
- Quote paper
- Anke Grams (Author), 2000, Anthroposophisches Menschenbild als Grundlage der Waldorfpädagogik Teilaspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12483