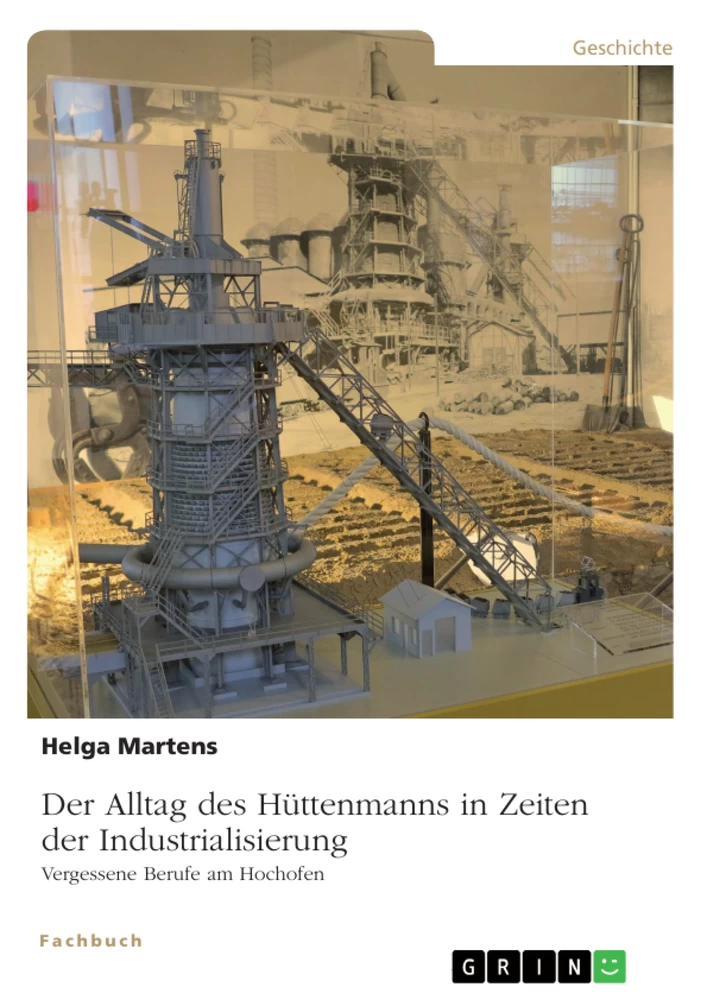Das Hüttenwesen hat weltweit eine jahrtausendalte Geschichte, das Herauslösen von Metallen aus Erzen und deren Verarbeitung ebenso, die weitere Technisierung machte die Industrialisierung erst möglich. Während dieser Entwicklung entstanden aus den unterschiedlichen Tätigkeiten am und um den Hochofen viele Berufe. Alle waren voneinander abhängig und man musste solidarisch zusammenarbeiten. Fehler in der Produktion konnten erhebliche Auswirkungen haben. Die Arbeiten waren insgesamt gefährlich und bargen große gesundheitliche Gefahren. Trotzdem war "man" stolz darauf, in einem solchen Betrieb arbeiten zu können.
Die Beschreibung der einzelnen beruflichen Tätigkeiten, aber auch die damals herrschenden Rahmenbedingungen, sind Bestandteil des Buches. Es soll einen Beitrag dazu leisten, dass diese Berufe nicht in Vergessenheit geraten. Schon heute können nur wenige mit Begriffen wie Gichter, Cowperwärter, Stopfmassenmischer oder Türenverkleber etwas verbinden. Zeitzeugen, die etwas über die Solidarität in der Arbeitswelt, der davon abhängigen Lebenswelt und den Einflüssen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen berichten können, gibt es kaum noch.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das Hüttenwesen
- Wie Lohnarbeit entstand
- Entwicklung der Lohnarbeit in der Region untere Trave
- Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen
- Einfluss von Gewerkschaften und politischen Gruppierungen auf die Arbeitswelt und auf das Hochofenwerk Lübeck
- Produktion und Arbeit im Hochofenwerk Lübeck
- Die Verwaltung
- Betriebsgliederung des Hochofenwerks Lübecks
- Arbeiten direkt am Hochofen
- Arbeiten in der Gießshalle
- Arbeiten in der Möllerung
- Arbeiten in der Kokerei
- Arbeiten in Hauptwerkstatt, Werkzeugmacherei und Maschinenhaus
- Arbeiten am Hafen und im Transportwesen
- Arbeiten in der Kupferhütte und der Zinkoxydanlage
- Arbeiten in Zement-, Betonwaren- und Schlackensteinfabrik
- Arbeiten ohne Aus- und Vorbildung
- Arbeiten im Hauptlabor und in den dezentralen Laboren
- Arbeiten, die von Frauen ausgeführt wurden
- Gerätschaften hatten vielfach Tiernamen
- Lohnstruktur im Betrieb
- Nachbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Quellennachweis
- Abbildungsnachweis
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsleben im Hochofenwerk Lübeck, das im frühen 20. Jahrhundert erbaut wurde. Sie beleuchtet die Entstehung der Lohnarbeit in der Region, die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Einfluss von Gewerkschaften und politischen Gruppierungen auf die Arbeitswelt. Darüber hinaus analysiert die Arbeit die verschiedenen Arbeitsbereiche im Werk, die Arbeitsbedingungen und die spezifischen Aufgaben der Beschäftigten.
- Entstehung der Lohnarbeit in der Region untere Trave
- Arbeitsbedingungen und Arbeitsleben im Hochofenwerk Lübeck
- Einfluss von Gewerkschaften und Politik auf die Arbeitswelt
- Spezialisierung und Arbeitsteilung im Hochofenwerk
- Alltagsleben und soziale Bedingungen der Arbeiter
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung des Hochofenwerks für die Industrialisierung Lübecks und schildert die Arbeitsbedingungen und das Leben der Hüttenleute. Kapitel 2 erläutert die Entwicklung des Hüttenwesens und die damit verbundene Spezialisierung der Arbeit. Kapitel 3 beleuchtet die Entstehung der Lohnarbeit im Allgemeinen und die spezifischen Gegebenheiten in der Region untere Trave. Kapitel 4 beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Arbeiterrechte in der Region. Kapitel 5 untersucht den Einfluss von Gewerkschaften und politischen Gruppierungen auf die Arbeitswelt und das Hochofenwerk Lübeck.
Schlüsselwörter (Keywords)
Hochofenwerk Lübeck, Industrialisierung, Lohnarbeit, Arbeitsbedingungen, Arbeitsteilung, Spezialisierung, Gewerkschaften, politische Gruppierungen, Hüttenleute, Arbeitsleben, Arbeitsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Berufe gab es früher am Hochofen?
Zu den heute oft vergessenen Berufen zählen Gichter, Cowperwärter, Stopfmassenmischer und Türenverkleber.
Wie waren die Arbeitsbedingungen im Hochofenwerk Lübeck?
Die Arbeit war gefährlich, körperlich extrem belastend und barg große gesundheitliche Risiken, war aber auch von großem Stolz und Solidarität geprägt.
Welchen Einfluss hatten Gewerkschaften?
Gewerkschaften und politische Gruppierungen spielten eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Lohnarbeit.
Gab es auch Frauenarbeit im Hochofenwerk?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch spezifische Tätigkeiten, die im Werk von Frauen ausgeführt wurden.
Warum hatten viele Gerätschaften Tiernamen?
Dies war Teil der spezifischen Arbeitskultur und Sprache der Hüttenleute; die Arbeit geht auf diese sprachlichen Besonderheiten ein.
- Arbeit zitieren
- Helga Martens (Autor:in), 2022, Der Alltag des Hüttenmanns in Zeiten der Industrialisierung. Vergessene Berufe am Hochofen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1248594