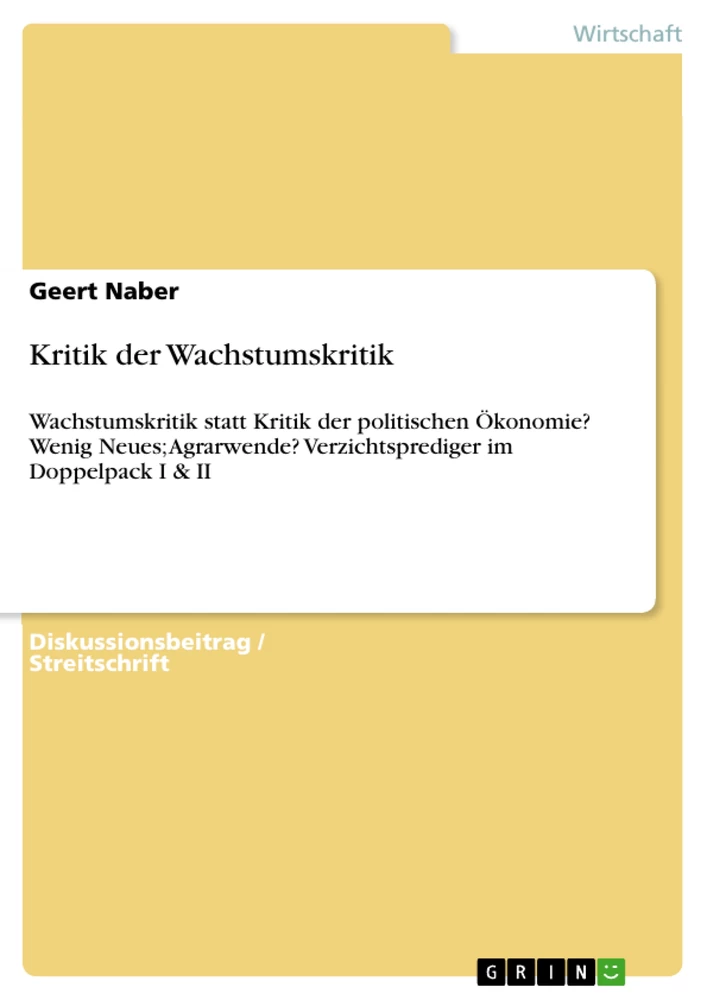Die Wachstumskritik erfährt viel Zuspruch. Aber zeigt sie wirklich wünschenswerte Wege zur Überwindung der ökologischen Krisen auf? Die hier versammelten Texte, die ihr Augenmerk insbesondere auf den Postwachstumsökonomen Niko Paech richten, haben daran Zweifel.
Inhalt
Vorwort
1. Wachstumskritik statt Kritik der politischen Ökonomie?
2. Wenig Neues
3. Agrarwende?
4. Verzichtsprediger im Doppelpack I
5. Verzichtsprediger im Doppelpack II
Vorwort
Eigentlich bot Niko Paechs „Befreiung vom Überfluss“ wenig Neues. Das vor zehn Jahren veröffentlichte Buch wiederholte vieles von dem, was ohnehin typisch war für die lange Tradition eines antimodernen Romantizismus. Trotzdem sorgte „Befreiung vom Überfluss“ für viel Aufsehen. Das Buch avancierte zum Bestseller. Und sein Autor stieg zu einem der einflussreichsten Gesichter der wachstumskritischen Szene auf. Was mich dazu bewog, einen genaueren Blick auf das Phänomen Paech zu werfen. Daraus resultierte nicht nur eine 2013 im labournet veröffentlichte Rezension von „Befreiung vom Überfluss“.1 Auch neuere Beiträge des Oldenburger Postwachstumsökonomen nahm ich unter die Lupe. Mir wurde dabei klar, warum Niko Paech bis in „die Mitte der Gesellschaft“ hinein gut ankam. Klar wurde mir jedoch ebenfalls: Seine Wachstumskritik war vielleicht flott und eingängig geschrieben, aber sie war keine emanzipatorische Kritik der kapitalistischen Moderne. Umso größer mein Erstaunen darüber, dass auch im linken Wissenschafts- und Politikdiskurs der wachstumskritische Jargon Einzug hielt. Manche redeten plötzlich wie Niko Paech daher. Andere versuchten, wachstumskritische Topoi mit linker Begrifflichkeit anzureichern.
Die Texte in dieser Broschüre dokumentieren meine Auseinandersetzung mit der Wachstumskritik. Sie sollen zeigen, dass Niko Paech alles andere als kritisch und links ist. Außerdem möchte ich mit den Texten vor Augen führen, dass postwachstumsökonomische Einschätzungen fast immer in die Irre gehen, wenn es um wichtige Themen geht. Um Themen wie Arbeit, Konsum, Geld oder, nicht zu vergessen, Landwirtschaft. Deshalb sind die Texte auch ein Plädoyer für eine Linke, die die ökologische Krise ernst nimmt, aber zugleich auf Distanz zu Niko Paech und Co. achten und statt Wachstumskritik lieber Ökonomiekritik betreiben sollte
Aber wie kann eine Ökonomiekritik auf der Höhe der Zeit aussehen? Die nachfolgenden Texte, die auch unter geertnaber.wordpress.com zu lesen sind, sprechen mehrfach die Wichtigkeit der Marx’schen Theorie an. Damit soll allerdings nicht der Eindruck erwähnt werden, dass Schmökern in den Blauen Bänden genüge, um die Welt zu begreifen und zum Besseren zu verändern. Karl Marx erklärt nicht alles. Sein Oeuvre ist unabgeschlossen, widersprüchlich und obendrein nicht einfach zu lesen. Karl Marx hat aber zweifelsohne mehr zu bieten als ein Niko Paech, der letztlich nicht mehr als eine eindimensionale und verzichtsideologisch ausgerichtete Verhaltenslehre offeriert.
1. Wachstumskritik statt Kritik der politischen Ökonomie?
Niko Paechs klägliche Abrechnung mit Karl Marx (2013)
Vor 150 Jahren erschien der erste Band von Marx’ Hauptwerk „Das Kapital“. Diesem Jubiläum ist es zu verdanken, dass momentan wieder recht viel über die Kritik der politischen Ökonomie geschrieben und diskutiert wird. Zum Beispiel in der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ Sie bringt Anfang Mai ein Heft mit mehreren Aufsätzen zum 23. Band der Marx-Engels-Werke2 heraus. Unter den Autorinnen und Autoren: Niko Paech, der in seinem Beitrag eine wachstumskritische Alternative zu Karl Marx liefern will. Denn Marx ist nach Ansicht des Oldenburger Postwachstumsökonomen weitgehend blind für die naturzerstörerischen Folgen wachsenden Wohlstands. Insbesondere wegen der für die Kritik der politischen Ökonomie fundamentalen Werttheorie: „Das Dogma der marxistischen Arbeitswertlehre, wonach allein Arbeit Wert erzeugen kann, blendet den Beitrag der ökologischen Plünderung zur Wertschöpfung aus.“3 Marx überhöhe die Arbeit und tauge deshalb nicht, um die destruktiven Mechanismen der hoch technisierten Überflussgesellschaften zu durchschauen: „Je mehr maschinelles Equipment eingesetzt wird, um menschliche Verrichtungen zu verstärken oder durch Automatisierung zu ersetzen, desto höher ist zwar rein rechnerisch die Arbeitsproduktivität, aber tatsächlich sind es in zunehmendem Maße Energieträger, Flächen, Materie sowie ökologische Assimilationskapazitäten, deren Verbrauch entstehen lässt, was dann als ‚Überschuss’ bezeichnet wird.“4 Marx sehe nur den Produktionsfaktor Arbeit und denke somit eindimensionaler als die frühbürgerliche Wirtschafslehre: „Anders als etwa die Vertreter der klassischen Nationalökonomie wie Adam Smith und David Ricardo, auf die sich Marx durchaus bezieht, erkennt er Boden und Kapital nicht als Produktionsfaktoren an.“5
Trinitarische Formel
Karl Marx hält tatsächlich nichts von der Theorie der Produktionsfaktoren. Das bedeutet aber keinesfalls, dass für die Kritik der politischen Ökonomie nur die Arbeit wichtig und produktiv wäre. Naturkraft (Boden/Rohstoffe) und Kapital (im Sinne von Produktionsmitteln) besitzen Güter produktivität. Jedoch keine Wert produktivität. Von ihr spricht die marxistische Kapitalismusanalyse lediglich dann, wenn es um den „Produktionsfaktor“ Arbeit geht: „Wertschöpfung vollzieht sich nur durch menschliche Arbeit.“6
Mit der auf den ersten Blick vielleicht pedantisch anmutenden Unterscheidung zwischen Güter- und Wertproduktivität will Marx verdinglichten Denkmustern entgegenwirken. Denkmustern also, die den Kapitalismus als einen zeitlosen, dinghaften und für immer und ewig geltenden Produktionsmechanismus betrachten. Besonders deutlich wird dieses ideologiekritische Ansinnen im dritten Band des „Kapital“, wo Marx sich mit der „trinitarischen Formel“7 auseinandersetzt: „Es handelt sich dabei um die Vorstellung, als würde die kapitalistische Produktion im Zusammenwirken von drei unabhängigen Produktionsfaktoren – Arbeit, Kapital und Boden – bestehen, die gleichermaßen zum Wert des produzierten Produkts beitragen und ihre jeweiligen Beiträge in Gestalt von Arbeitslohn, Profit bzw. Zins sowie Grundrente bezahlt bekommen. In dieser aus den kapitalistischen Verhältnissen selbst entspringenden Vorstellung, einem spontanen Bewusstsein, das Marx als ‚Religion of every day’s life’ … bezeichnet, werden die objektiven und subjektiven Produktionsbedingungen (Produktionsmittel und Boden auf der einen Seite, die menschliche Arbeit auf der anderen Seite) mit ihren spezifisch gesellschaftlichen Formbestimmungen (Produktionsmittel erhalten die Form des Kapitals, Boden die Form des Grundeigentums und Arbeit die Form der Lohnarbeit) identifiziert, wodurch die kapitalistische Produktionsweise als natürliche, unabänderliche Produktionsweise erscheint. Historisch veränderlich sind dann lediglich die Verteilungsverhältnisse zwischen den Faktoren, dass aber die Faktoren Arbeit, Kapital und Boden zusammenwirken müssen, erscheint als eine Art gesellschaftliches Naturgesetz.“8
Niko Paechs Sympathien für das Konzept der Produktionsfaktoren können nicht überraschen. In der Postwachstumsbewegung ist es nämlich gang und gäbe, die kapitalistische Produktionsweise zu naturalisieren. Es erfolgt keine grundsätzliche Kritik an Kapital, Geld und Ware, sondern ein moralisierend-oberflächliches Lamentieren über das „Wachstumsparadigma“. Entsprechend dürftig ist das, was die Postwachstumspolitiken zu bieten haben. Sie bewegen sich oft in einer Vorstellungswelt von Flora und Fauna und zielen darauf ab, in „ausgewachsenen“ Überflussgesellschaften „krankes“ Wachstum durch „gesundes“ Schrumpfen zu ersetzen. Das signalisiert, dass die vermeintlich unkonventionelle Postwachstumsbewegung oft genauso borniert denkt wie die konventionelle Wachstumspolitik: „Die ständige Polemik gegen die Fixierung auf Quantität, gegen die die Qualität ausgespielt wird, ändert nichts daran, dass Degrowth selbst sich gesellschaftliche Veränderung nur in den phantasielosen Kategorien von ‚mehr’ oder ‚weniger’ Kapitalismus vorstellen kann.“9
Arbeitswerttheorie
Aber zurück zu Marx und dessen Arbeits- und Naturverständnis. Es ist weitaus differenzierter und problemsensibler, als von Niko Paech insinuiert. Belege dafür finden sich in allen Phasen des Marxschen Oeuvres. So enthält das Frühwerk etliche Passagen, wo Arbeit und Natur aus anthropologischem Blickwinkel erörtert werden. Zum Beispiel in Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Auseinandersetzung mit der Hegel-Philosophie: „Die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun … sogleich als ein doppeltes Verhältnis – einerseits als natürliches, andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis –, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird.“10
Für Marx gehören Mensch, Arbeit und Natur offensichtlich auf das Engste zusammen, ohne allerdings dasselbe zu sein: „Arbeit umfasst aus dieser anthropologischen Perspektive ausdrücklich all das, was zur Sicherung, zur ‚Produktion’ des menschlichen Lebens notwendig ist, also weit mehr als der Umkreis der erwerbsorientierten Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen einbegreift. Zugleich werden die Menschen in diesen Formulierungen nicht einfach der Natur gegenübergestellt, sondern als selbst an die Natur gebunden reflektiert. Das bedeutet freilich keine unterschiedslose Identität zwischen den Menschen und der Natur. Es ist gerade die Kategorie der Arbeit, die sie zugleich auch unterscheidet.“11
Jedes Gemeinwesen muss, um überleben zu können, für seine materielle Reproduktion sorgen. Das geschieht, indem durch Arbeit Natur umgeformt und nutzbar gemacht wird. Die Notwendigkeit der materiellen Reproduktion kann jedoch unterschiedliche historische Formen annehmen. Eine feudale Ordnung reproduziert sich anders als die Gesellschaftsform, die Marx mittels seiner Werttheorie analytisch durchdringen will: die kapitalistische Arbeitsgesellschaft. Sie ist geprägt durch die Produktion von Waren. Das heißt, von Gütern, die auf Märkten angeboten und verkauft werden sollen. Eine kapitalistische Gesellschaft ist also eine warenproduzierende Gesellschaftlichkeit. Und diese Gesellschaftlichkeit ist, so Marx im „Kapital“, durch ein komplexes und fragwürdiges Zusammenspiel von Handeln und Strukturen gekennzeichnet: Die Menschen produzieren mittels ihrer Handlungen ihren gesellschaftlichen Zusammenhang, aber sie tun es unter den Bedingungen der Warenproduktion nicht bewusst. Vergesellschaftung vollzieht sich gleichsam hinter dem Rücken der Gesellschaftsmitglieder. Sie können die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht durchschauen und kontrollieren. Kapitalistische Warenproduktion generiert mithin eine „Gesellschaftsformation …, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozess bemeistert“.12 Die Individuen unterliegen einem sachlichen, unpersönlichen Herrschaftsverhältnis, das zu „kognitiven Dissonanzen“ führt, die reichlich Material für psychoanalytische Studien liefern : „Das Spezifische der warenproduzierenden Gesellschaft … ist, dass die Verhältnisse der Individuen als Verhältnisse von Dingen erscheinen, als das Verhältnis der Tauschwerte der Waren, die die Arbeiten ins Verhältnis setzen. Indem die Tauschwerte als Eigenschaften von Dingen, als ihr ‚Wert’ erscheinen, vollzieht sich eine fundamentale Verdinglichung des gesellschaftlichen Zusammenhangs mit weitreichenden Konsequenzen, die bis in die Psyche der Beteiligten hinein reichen. Die Warendinge werden zum Fetisch. Sie gewinnen Macht über die Individuen und ihre Verhältnisse. Sie erscheinen den Akteuren als belebt, als der Inbegriff des gesellschaftlichen Lebens.“13
Warenproduktion tangiert nicht nur die Psyche – die „innere Natur“ – der Menschen. Sie hat auch erhebliche und bisweilen äußerst destruktive Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, die „äußere Natur“ der Gesellschaftsmitglieder. Wo Warenproduktion vorherrscht, kann sich ein eigendynamischer Prozess der Kapitalverwertung entfalten. Er zielt auf „Selbstvermehrung“: aus Geld soll mehr Geld werden. Dieser selbstbezügliche Prozess ist blind gegenüber den sozialen und ökologischen Folgen seines Wirkens. Und er ist, worauf an Marx anknüpfende Analysen des gesellschaftlichen Naturverhältnisses hinweisen, ein „automatisches Subjekt“, das ökonomisch-politischem Handeln viele „Sachzwänge“ auferlegt: „Die zusehends schwindenden Ressourcen unserer Welt verlangen vom Kapital immer größere Anstrengungen, seine sich notwendig ständig erweiternde ‚Verwertung’ zu realisieren. Beide ökologischen Krisenprozesse – die Ressourcen- wie die Klimakrise – werden durch diesen Verwertungsprozess des Kapitals, das auf nationaler oder globaler Ebene wie ein automatisch nach Maximalprofit strebendes ‚Subjekt’ agiert, entscheidend befördert. Dieser ‚Weltgeist’ des Kapitals, vor dessen Imperativen sogar die mächtigsten Kapitalisten zu Kreuze kriechen müssen, gleicht somit einem schwarzen Loch, das die Ressourcen und Energieträger der Welt verschlingt, um sein wucherungsartiges Wachstum zu perpetuieren.“14
Festhalten lässt sich: Es ist nicht gerechtfertigt, Marx als einen engstirnigen Arbeits-, Technik und Wachstumsfan abzukanzeln. Bei seiner Arbeitswerttheorie handelt es sich um mehr als ein kitschig-antiquiertes Loblied auf die „produktive Arbeiterklasse“. Marx’ Wertkritik geht darüber hinaus. Sie versucht den spezifischen Charakter jener Vergesellschaftungsweise zu entschlüsseln, der die auf Warenproduktion beruhenden Gesellschaften von allen anderen Gesellschaftsformen unterscheidet. In dem Zusammenhang kommt die Wertkritik auf ein Thema zu sprechen, das kritisches Denken und Handeln auch heute noch bewegt: Warum und wie lange wollen die Menschen noch unter gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die sie zwar selbst produzieren, jedoch nicht kontrollieren können? Marx liefert dazu Analysen, die gewiss nicht frei sind von Ungereimtheiten, deren Lektüre aber – allen postwachstumsökonomischen Unkenrufen zum Trotz – nach wie vor lohnt.
Ausbeutung
Lohnt es sich auch, am Marxschen Begriff der „Ausbeutung“ fest zu halten? Oder muss dieser Begriff neu definiert werden? Wenn Marx von Ausbeutung unter Bedingungen kapitalistischer Warenproduktion spricht, dann meint er damit, dass die Produzierenden (die „Arbeitnehmer“) von ihren „Arbeitgebern“ weniger an Wert erhalten, als sie durch ihre Arbeit produzieren. Ausbeutung passiert nicht nur dort, wo prekäre Jobs vorherrschen: „Mit Ausbeutung soll nicht auf besonders niedrige Löhne oder besonders schlechte Arbeitsbedingungen hingewiesen werden. Ausbeutung bezeichnet einzig und allein den Sachverhalt, dass die Produzenten lediglich einen Teil des von ihnen produzierten Wertes erhalten – unabhängig davon, ob die Löhne hoch oder niedrig, die Arbeitsverhältnisse gut oder schlecht sind.“15 Hohe Löhne und arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen machen Ausbeutung erträglicher, beseitigen sie aber nicht. „Will man Ausbeutung abschaffen, dann geht dies nicht durch eine Reformierung der Austauschverhältnisse innerhalb des Kapitalismus, sondern nur durch die Abschaffung des Kapitalismus.“16
Für den Ausbeutungsbegriff der Marxschen Kapitalismusanalyse sind die Herrschafts- und Aneignungsverhältnisse der betrieblichen Warenproduktion zentral. Diese Blickrichtung hält Niko Paech für veraltet. Sie könne nicht den Wandel von einer frühindustriellen Arbeitsgesellschaft hin zu einer hoch automatisierten Konsumgesellschaft erfassen. Nicht Ausbeutung durch die Kapitalisten sei heutzutage das Hauptproblem. Problematischer sei die Maßlosigkeit der modernen Arbeitnehmer. Diese sind für Paech Menschen, die nicht mehr „wirklich arbeiten“, sondern nur noch für viel Geld „an Knöpfen drehen“ und das Kernstück einer „globalen Konsumentenklasse“ bilden. Deren ausbeuterischer Lebensstil werde vom Marxismus ignoriert: „Warum wird die … globale Konsumentenklasse, deren ruinöser Lebensstil inzwischen die ökologische Kapazität mehrerer Planeten verschlingt, aus marxistischer Sicht nicht auch als ‚ausbeuterisch’ bezeichnet?“17
Zweifelsohne existieren Konsummuster mit naturzerstörerischen Effekten. Beispielsweise der hohe Fleischverbrauch oder das auto- und straßenfixierte Mobilitätsverhalten. Gleichwohl gibt es gute Gründe dafür, dass viele marxistisch inspirierte Wirtschafts- und Gesellschaftsstudien nicht den Konsum in den Mittelpunkt ihrer Analysen stellen. Und dass sie für die ökologischen Krisen nicht hauptsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortlich machen: „Den übermäßigen Konsum dafür [für den Wachstumszwang] haftbar zu machen, verfehlt die tatsächlichen Zwänge, denn anders, als es uns die Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre weismachen wollen, ist der Konsum nicht der Zweck der kapitalistischen Produktion. Wäre das so, bedürfte es der Werbung nicht. Bekanntlich stand ja die von manchen Postwachstumsideologen jetzt wieder propagierte protestantische Ethik der Askese und des Verzichts an den Anfängen des Kapitalismus: Geld zu verdienen, nicht um es zu verprassen, sondern um immer mehr Geld daraus zu machen, ist seitdem der irre Selbstzweck allen Wirtschaftens. Der Kapitalismus ist damit zum Wachsen verdammt: Wenn er sie absetzen kann, produziert er Waren ohne Ende; wenn er es nicht kann, gerät er in die Krise. In diesem Prozess ist der Konsum bloßes Mittel, weil die Waren zum Zweck der Geldvermehrung ja auch verkauft werden müssen.“18
Die Überlappungen zwischen der Konsumkritik, wie sie in der Postwachstumsbewegung en vogue ist, und den Verzichtsdogmen der wirtschaftsliberalen „Klassenkämpfer von oben“ lassen sich sehr gut anhand der aktuellen Austeritätspolitiken im Bereich der Europäischen Union veranschaulichen: „Merkwürdigerweise ist die herrschende Klasse in ganz Europa gleichzeitig mit der Postwachstumsbewegung auf die Idee verfallen, dass ‚wir alle viel zu lange über unsere Verhältnisse gelebt haben’, und hat in Ländern wie Griechenland und Spanien bereits mit der Schrumpfung begonnen. Die Wachstumskritiker mögen noch so sehr zetern, dass sie gute Menschen sind, sie mögen sich noch so sehr einbilden, dass ihr im Namen der Natur geleisteter Verzicht dieser am Ende auch zugute kommt: Tatsächlich ist die selbstauferlegte Mäßigung des Proletariats die beste Verewigung der Kapitalverwertung, die alles verwüsten wird, was sich dem Gesetz der Profitmaximierung in den Weg stellt.“19
Was sagt das linke Segment der wachstumskritischen Szene zu diesen Vorwürfen? Leute wie Ulrich Brand, Markus Wissen oder Alexis Passadakis legen großen Wert auf eine Abgrenzung vom Neoliberalismus. Sie wollen keine „den Herrschenden“ nutzende Verteufelung des Massenkonsums betreiben. Sie wollen vielmehr, mittels kritischer Analysen der „imperialen Lebensweise“ (IL), Strukturen und überpersönliche Mechanismen aufdecken, die für postkoloniale Ausbeutung des „Südens“ durch den „Norden“ verantwortlich sind. Abgezielt wird auf eine grundlegende „sozial-ökologische Transformation“ in den reichen Ländern. Diese Umgestaltung soll „solidarischen Lebensweisen“ den Weg ebnen. Das klingt sympathischer als Niko Paech, sollte aber kein Grund sein, auf Kritik an den Kritikern der IL zu verzichten. Denn: Obwohl Postwachstumsökonomen à la Ulrich Brand „nicht müde werden zu betonen, dass sie Strukturen und überpersönliche Mechanismen ansprechen wollen und die Hervorhebung Einzelner und moralische Vorhaltungen an diese nicht intendiert seien, fallen sie eben doch regelmäßig in eben letztere zurück“.20 Außerdem scheint es dem postkolonialistisch geprägten Ausbeutungsbegriff an Realitätsgehalt zu mangeln. Bei einer empirisch unterlegten Analyse müssten „die pauschalen Aussagen und Behauptungen, wonach ‚unsere’ aktuelle IL extrem von den Rohstoffen und Arbeitskräfteausbeutung des ‚Südens’ abhänge, doch sehr stark relativiert werden“.21
Auch der Blick auf das Konzept IL zeigt somit: Gegenüber postwachstumsökonomischen Definitionen von Ausbeutung ist Vorsicht geboten. Es spricht einiges dafür, sich bei der Analyse und Kritik moderner Gesellschaften am klassischen Ausbeutungsbegriff der Kritik der politischen Ökonomie zu orientieren. So gibt es zwar viele Varianten des Kapitalismus, aber überall, wo Kapitalismus ist, kommt es zum „scheingerechten Tausch von Zeiteinheiten“, d.h. zur Ausbeutung von Arbeitskräften.22 Woraus folgt, dass Marx mit seinen Überlegungen zu Kapitalherrschaft und Ausbeutung „eine nach wie vor wichtige moralische und politische Frage aufgeworfen hat: Wie verhalten wir uns zu einem System, das, ganz fundamental ausgedrückt, permanent das Haben (Kapitaleigentum) gegenüber dem Tun (Arbeit) privilegiert?“.23
Die dem Kapitalismus eigentümliche Privilegierung des Kapitals generiert nicht nur mitunter geradezu skandalöse soziale Ungleichheiten, sondern auch eine Sachzwang- und Wachstumslogik, die Arbeitskräften und Natur arg zusetzt. Die Postwachstumsbewegung muss sich deshalb ernsthafter als bisher mit der gerade aufgeworfenen Frage befassen. Von Niko Paechs ökoelitärer Verachtung für die Lebens- und Konsumgewohnheiten derjenigen, die sich ausbeuten lassen müssen, sollten diejenigen, die nach einem emanzipatorischen Ausweg aus der ökologischen Krise suchen, Abstand nehmen.
Proudhon
Abstand nehmen sollte man auch von Niko Paechs Konzepten für die Zukunft. In seinem Beitrag in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ tauchen erneut die Vorschläge und Empfehlungen auf, die sich schon in etlichen früheren Publikationen des Stars der Postwachstumsbewegung finden. Zum Beispiel ein Plädoyer für die Stärkung subsistenzwirtschaftlicher Strukturen.24 Unübersehbar ist aber, dass Versorgung durch Gemeinschaftsgärten, Tauschringe oder Verschenkmärkte allenfalls in Nischen funktionieren kann. Sie wird, soll ein Rückfall in vormoderne Elendsökonomien verhindert werden, großräumige und weit verzweigte Versorgungsstrukturen nicht mal ansatzweise ersetzen können. Hinzu kommt: Tauschringe etc. weisen eine sozialkulturelle Schräglage auf. Es handelt sich um Spielwiesen für Menschen, die zumeist einen bildungsbürgerlichen Habitus aufweisen und weit entfernt sind vom Alltagsleben der „kleinen Leute“.
Besonders problematisch am Paechschen Forderungskatalog ist die Überhöhung des Regionalen. Geradezu gebetsmühlenhaft wird für Regionalökonomien „mit stark verkürzten Wertschöpfungsketten“ geworben. Das kommt gut an, denn viele Menschen sehnen sich in Zeiten einer „chaotischen Welt“ nach überschaubaren Rückzugsorten. Aber das „small is beautiful“-Gefühl birgt auch Gefahren. An ihm können Ideologien andocken, die die Heimat idealisieren und das Fremde dämonisieren: „Der [regionale] Wohlfühleffekt … basiert auch auf Ab- und Ausgrenzung und verdeckt, dass es in jeder Heimat und jeder Region unterschiedliche Klassen, patriarchalische Strukturen und rassistische Haltungen und Praktiken gibt. Auf der einen Seite die vermeintlich überschaubare Idylle des Vertrauten, das Kollektiv der Einheimischen, auf der anderen Seite das Fremde, die Globalisierung. Dabei sind niedrige Löhne, Entlassungen, die Produktion von gesundheitsgefährdenden Gütern kein Privileg ‚fremder’ Konzerne und amerikanischer Heuschrecken. Insbesondere Landschaft und Umwelt in einer Region werden im Regelfall von heimischen Unternehmen, von mittelständischen Betrieben und Agrarfabriken vor Ort, bedroht, die Flächen versiegeln und verbrauchen. Gewerbesiedlungen, Umgehungsstraßen oder Aussiedlerhöfe werden von gewählten Kommunalparlamenten beschlossen.“25
Wenn Paech das Regionale preist, kommt er auch regelmäßig auf seine Vorstellungen zur „Geldreform“ zu sprechen: „Komplementäre, parallel zum Euro einzuführende Regionalwährungen könnten Kaufkraft an die Region binden und damit von globalisierten Transaktionen abkoppeln.“26 Dem Postwachstumsökonomen schwebt mithin so etwas vor wie eine einfache Warenproduktion, in der Geld eine geringere Rolle spielt als in der Big Economy. Damit reiht er sich in den lauten und vielstimmigen Chor derjenigen ein, die eine „wirkliche“ Marktwirtschaft „ohne Banken und Konzerne“ wollen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass Paechs Regionalgeldkonzept in einem Praxistest scheitern würde: „Eine ‚einfache Warenproduktion’ als gesellschaftliches System allgemeinen Tauschs, in der das Geld bloßes Zahlungs- und Tauschmittel ist und ‚der Gesellschaft dient’, existiert nur in den Einleitungskapiteln der VWL-Bücher und in den Phantasien des bürgerlichen Alltagsverstands. Deshalb sind auch alle Versuche, das Geld zu ‚reformieren’, wie etwa durch eine Abschaffung des Zinses, nicht nur regressiv, weil sie die ‚Marktwirtschaft’ abfeiern und die Wurzel allen Übels in der Finanzsphäre verorten, sondern auch zum praktisch zum Scheitern verurteilt. Regionale Tauschzettel mögen eine Zeitlang als Parallelwährung funktionieren oder in extremen Krisensituationen, wie etwa in Argentinien zur Jahreswende 2001/2002, vorübergehend den Platz eines Ersatzgeldes einnehmen, ähnlich wie Zigaretten auf dem Schwarzmarkt der Nachkriegszeit; aus dieser Nische heraus kämen sie aber nur durch eine Verwandlung in ganz normales Geld, das nicht Mittel, sondern Selbstzweck der Produktion ist.“27
Der Wunsch nach einer einfachen Warenproduktion ist kein neuartiges Phänomen. Er hat eine lange Tradition und reicht bis in die Anfangsphase der Industrialisierung zurück. Damals wollte Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) den Kapitalismus durch eine Kleinproduzentenökonomie ersetzen. An die Stelle der „Zinsherrschaft“, die der Frühsozialist für das Böse schlechthin hielt, sollte ein nicht verleih- und verzinsbares „Arbeitsgeld“ treten. Zu dessen Förderung gründete Proudhon nicht nur eine „Volksbank“. Er schürte auch antisemitische Ressentiments, hielt er doch die Juden für die größten Profiteure der „unechten“, weil von Kapital und Zins dominierten Marktwirtschaft.
In der Kritik der politischen Ökonomie spielt die kritische Auseinandersetzung mit dem Proudhonismus eine wichtige Rolle.28 Marx vermag, mit oft scharfsinnigen Analysen, die illusionären Gedankenwelten der klassischen Geldreformer und Zinskritiker zu demontieren. Ein Grund mehr, der Marxschen Ökonomiekritik gegenüber der Gartenzwergökonomik eines Niko Paech den Vorzug zu geben. Und ein Grund mehr, das Marxsche Hauptwerk nicht einzumotten und zu musealisieren. „Das Kapital“ untersucht kapitalistische Mechanismen, die sich erst gegenwärtig so richtig entfalten. Wir können deshalb auch heute noch etwas mit dem mittlerweile 150 Jahre alten Buch anfangen. In „Das Kapital“ finden sich wichtige Anregungen für eine Kritik eines verkürzten Antikapitalismus, der bekanntlich gerade in der Postwachstumsbewegung weit verbreitet ist. Offensichtlich ist zudem: Marx’ Hauptwerk enthält zwar keine detaillierten Handlungsanweisungen für die emanzipatorische Transformation des Gegenwartskapitalismus. Aber die Kritik der politischen Ökonomie hilft, Antworten auf die Frage zu finden, „wie eine kommunistische Zivilisation sich die gesellschaftlichen Produktivkräfte auf dem Niveau von Automatisierung und Massenproduktion aneignen kann, ohne den Planeten zu ruinieren“.29
Literatur
Becker, Matthias Martin (2017): Automatisierung und Ausbeutung. Was wird aus der Arbeit im digitalen Kapitalismus? Wien: Promedia Verlag.
Berger, Michael (2003): Karl Marx: „Das Kapital“. München: Wilhelm Fink Verlag.
Bierl, Peter (2015): Nachhaltige Kritik? Geschichte und Perspektiven der Postwachstumsökonomie. In: Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie, Jg.2, Heft 2, S. 344-370.
Boris, Dieter (2017): Imperiale Lebensweise? Ein Kommentar. In: Sozialismus, Jg. 44, Heft 7/8. S. 63-65.
Ganßmann, Heiner (1999): Soziologische Theorie im Anschluss an Marx. In: Heinrich, Michael; Messner, Dirk (Hg.): Globalisierung und Perspektiven linker Politik. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot. S. 22-36.
Heinrich, Michael (2004): Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung. Stuttgart: Schmetterling Verlag.
Heinrich, Michael (2016): Grundbegriffe der Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Quante, Michael; Schweikard, David P. (Hg.). Stuttgart: J.B. Metzler. S. 173-193.
Hofmann, Werner (1969): Grundelemente der Wirtschaftsgesellschaft. Ein Leitfaden für Lehrende. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Interessengemeinschaft Robotercommunismus (2014): Unser Reichtum. 13 Thesen zur Postwachstumsbewegung. In: Jungle World vom 6. November.
Kößler, Reinhart; Wienold, Hanns (2002): Arbeit und Vergesellschaftung. Eine aktuelle Erinnerung an die klassische Gesellschaftstheorie. In: Peripherie, Jg. 22, Heft 85/86. S. 162-183.
Konicz, Tomasz (2014): Automatisches Subjekt. In: Junge Welt vom 4. April.
Lohoff, Ernst; Trenkle, Norbert (2012): Die große Entwertung. Warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Münster: Unrast-Verlag.
MEW 3: Marx, Karl; Engels, Friedrich (1845/46): Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Repräsentanten. In: Marx-Engels-Werke, Band 3. Berlin (DDR) 1983: Dietz Verlag. S. 9-530.
MEW 4: Marx, Karl (1846/47): Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“. In: Marx-Engels-Werke, Band 4. Berlin (DDR) 1972: Dietz Verlag. S. 63-182.
MEW 23: Marx, Karl (1867): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Buch 1: Der Produktionsprozess des Kapitals. Berlin (DDR) 1985: Dietz Verlag.
MEW 25: Marx, Karl (1894): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band, Buch III: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Engels, Friedrich (Hg.). Berlin (DDR) 1985: Dietz Verlag.
Naber, Geert (2017): Dreißig Jahre danach. Professor Vonderach schreibt wieder Rechtslastiges. In: Naber, Geert: Politische Texte: https://geertnaber.wordpress.com/.
Ortlieb, Claus Peter (2013): Gegen die Wand. Von der gemeinsamen Ursache der ökologischen und ökonomischen Krise. In: Konkret, Heft 11, S. 28-30.
Paech, Niko (2017): Postwachstumsökonomik. Wachstumskritische Alternativen zu Karl Marx. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“). Jg. 67, H. 19/20. S. 41-46.
2. Wenig Neues
U. Brand und M. Wissen schreiben wieder zur „Imperialen Lebensweise“
(2019)
Ulrich Brand und Markus Wissen veröffentlichten vor zwei Jahren ein Buch zur „Imperialen Lebensweise“. Es kam gut an und verkaufte sich bestens. Vielen Leserinnen und Lesern gefiel offenbar an der Publikation, dass sie die Wachstums- und Konsumzwänge in den reichen Weltregionen im Stile eines Elmar Altvater hinterfragte. Allerdings mussten sich Markus Wissen und Ulrich Brand auch Kritik gefallen lassen. Nicht zuletzt aus ihrem eigenen wissenschaftlichen und politischen Spektrum.
Was wurde kritisiert? Zum Beispiel, dass Brand und Wissen wenig zu den klassen- und arbeitsstrukturellen Verhältnissen in den reichen Ländern sagen. Dass sie sich mithin zu sehr auf den Nord-Süd-Gegensatz fixieren und gesellschaftliche Ungleichheiten in den geographischen Zentren der Imperialen Lebensweise (IL) vernachlässigen. Und dass sie deshalb, wenn es um die dortigen Nutznießer dieser Lebensweise geht, nicht genügend zwischen Lohnarbeit und Kapital differenzieren, sondern Beherrschte und Herrschende in einen Topf werfen und unterschiedslos verantwortlich machen für die neokoloniale IL.
Diese Kritik stößt bei Brand/Wissen auf offene Ohren. In der Januar-Ausgabe der WSI-Mitteilungen kündigen sie an, im Rahmen ihrer Forschungen der Klassenfrage mehr Beachtung schenken zu wollen. Ob dadurch das analytische Potenzial des IL-Konzepts merklich gesteigert werden kann, ist jedoch zweifelhaft. Der Zeitschriftenaufsatz zeigt nämlich: Brand und Wissen wollen ihr Forschungsprogramm nicht grundsätzlich überdenken. An vielem, was an ihrem Buch bemängelt wurde, halten sie offenbar fest. Etwa an ihrem antiimperialistischen Weltbild. Brand/Wissen erwecken nach wie vor den Eindruck, alle Missstände in der Dritten Welt seien Konsequenzen einer Symbiose aus Imperialismus und imperialer Lebensweise. Als ob es keine hausgemachten Ursachen für die Probleme und Krisen in den Ländern des Südens gäbe: Despotische Herrschaft, Demokratiedefizite, Menschenrechtsverletzungen und, nicht zu vergessen, religiöser Fundamentalismus, der alle gesellschaftlichen Bereiche zu reglementieren trachtet. Es ist befremdlich, dass die beiden vermeintlich radikalen Herrschaftskritiker kein Wort über den sich ausbreitenden Islamismus verlieren. Und das, obwohl der politische Islam ein mindestens so großes Hindernis wie der „Imperialismus“ für die von Brand/Wissen postulierte „solidarische Lebensweise“ darstellen dürfte.
Ärgerlich ist zudem, dass Brand/Wissen in ihrem Zeitschriftenaufsatz nicht ihr Mitwirken am wachstumskritischen Diskurs selbstkritisch hinterfragen. Das wäre dringend notwendig, denn die Postwachstumsbewegung ist alles andere als emanzipatorisch. Mehr denn je dominieren dort Strömungen, die kleinkapitalistische Verhältnisse glorifizieren, öko-autoritäre Verzichtsideologien gutheißen und das Geld und den Zins in einer Weise anprangern, die viele Gemeinsamkeiten mit dem völkischen Antikapitalismus rechtspopulistischer Kreise aufweist. All das wird von Brand/Wissen nicht problematisiert.
Dass Ulrich Brand und Markus Wissen bisweilen nicht allzu viel zu sagen haben, zeigen auch ihre strategischen Entwürfe. Ihr Zeitschriftenaufsatz ist, was sozial-ökologische Transformationsschritte angeht, keinen Deut gehaltvoller als ihr Buch. Die beiden wollen einen working-class environmentalism, in dem „Erwerbsarbeit, Ökologie und reproduktive Arbeit in ihrer konstitutiven Verbindung begriffen und politisiert werden“. Um dieses noch sehr vage Konzept zu schärfen, werden Brand/Wissen viel in den modernen Arbeitswelten forschen müssen. Und sie werden sich endlich klar von den Wachstumskritiker*innen abgrenzen müssen, die in den Mitgliedern der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse nur konsumwütige Nimmersatts sehen.
3. Agrarwende?
Streit um die moderne Landwirtschaft
(2020)
Anfang der 1950er Jahre lebten noch zwanzig Prozent der westdeutschen Bevölkerung auf Bauernhöfen. Dabei handelte es sich oft um Kleinstbetriebe mit wenigen Hektar Nutzfläche und geringen Viehbeständen. Bäuerliche Romantik war selten anzutreffen. Viele Höfe verzeichneten nur dürftige Erträge. Sie wirtschafteten unter ärmlichen Bedingungen und rutschten nur deshalb nicht vollends ins Elend, weil die Bauernfamilien fast pausenlos schufteten und drastische Selbstausbeutung betrieben.
Heute sind in der Bundesrepublik nicht mal mehr drei Prozent der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig. Trotzdem produzieren die verbliebenen Agrarbetriebe viel mehr als in früheren Zeiten. Das hat zu tun mit einer tief greifenden Mechanisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft. Viele Bauernhöfe verschwanden im Zuge eines Wachsen-oder-Weichen-Prozesses. Die Betriebe, die überleben konnten, sind geprägt durch Massentierhaltung, intensiven Chemikalieneinsatz und hoch automatisierte Wirtschaftsgebäude und Landmaschinen. Moderne Landwirtinnen und Landwirte produzieren fabrikähnlich und ausgesprochen effizient. Ärmliche Kleinbauerhöfe, die so typisch waren für die klassischen Dörfer, sind nahezu komplett verschwunden. Lange zurück liegen hierzulande auch Hungersnöte. Die Industrialisierung des Agrarsektors ermöglichte es, mit immer weniger Bauernhöfen eine wachsende Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen.
Aber wie ist es um die Qualität dieser Lebensmittel bestellt? Wie um die ländliche Flora und Fauna? Was bedeutet Intensivlandwirtschaft für das Tierwohl? Und was für den Zustand lebenswichtiger Güter wie etwa dem Trinkwasser? Diese Fragen sorgen für viel Diskussionsstoff. Und für eine anschwellende Kritik an der heutigen Form der Landwirtschaft. Der Ruf nach einer „Agrarwende“ wurde in den letzten Jahren immer lauter. Das Image der Intensivlandwirtschaft ist arg angekratzt. Zugleich ist aber auch beobachtbar, dass sich bisher wenig ändert. Die viel beschworene Agrarwende lässt auf sich warten.
Agrarkapitalistische Macht
Dass sich im ländlichen Raum bislang wenig ändert, hängt mit einem soziopolitischen Phänomen zusammen. Konkret: Mit der beachtlichen Organisations- und Konfliktfähigkeit der Landwirte. Sie verfügen nicht nur mit dem Deutschen Bauernverband und den Landwirtschaftskammern über schlagkräftige Interessenvertretungen mit besten Kontakten zur CDU/CSU. Das „Landvolk“ kann auch, siehe dessen aktuelle Proteste, weithin sicht- und spürbare Demonstrationen auf die Beine zu stellen. Hinzu kommt eine nach wie vor wirksame Standesideologie. Der Bauernverband vermag immer noch recht erfolgreich den Landwirtschaftsberuf zu überhöhen und als etwas Exklusives darzustellen, das nur seine Mitglieder begreifen und in das sich deshalb nicht „von außen“ eingemischt werden darf.
Moderne Landwirtschaft ist aber nichts Außergewöhnliches. Sie ist ein ganz normaler Wirtschaftszweig, der genau wie andere Branchen einer kapitalistischen Logik folgt. Bei den heutigen Bauernhöfen handelt es sich mithin um Industriebetriebe mit dem Zwang zur Gewinnmaximierung. Und Bauern sind folglich Agrarkapitalisten, die sich Einmischungen durch die kritische Öffentlichkeit und die Politik gefallen lassen müssen. Zum Beispiel mit Blick auf das Gülleproblem: „Die meisten konventionellen Bauern sind überzeugt, dass nur eine ‚moderne’ Landwirtschaft Zukunft hat. Sie begrüßen die Industrialisierung auf ihren Höfen. Doch dann müssen sie auch die Regeln akzeptieren, die für andere Industriebetriebe gelten. Für jeden Chemiekonzern ist klar, dass man Abfälle nicht in den nächsten Fluss leiten darf. Für Landwirte kann es kein Sonderrecht geben, das Grundwasser zu verseuchen. Gülle ist kein Dünger, wenn sie im Übermaß auf die Weiden gekippt wird – sondern Sondermüll.“30
Zurück zur Natur?
Gegen diesen Sondermüll wird bisher wenig getan. Das hat mit der vorhin angesprochenen Macht der Agrarlobby zu tun. Schuld daran sind aber wohl auch diejenigen, die sich für eine Agrarwende stark machen. Warum diese im ersten Moment absurd anmutende Einschätzung? Weil viele Agraroppositionelle mit einer ökologischen Modernisierung der modernen Landwirtschaft offensichtlich wenig am Hut haben. Sie favorisieren stattdessen einen rückwärtsgewandten Politikansatz und verbreiten romantisch-vormoderne Vorstellungen vom bäuerlichen Leben: „Oftmals interessieren sich die Freunde der ‚nachhaltigen Landwirtschaft’ wenig für die realen Bauern in ihren Ställen und auf ihren Äckern. Sie präsentieren stattdessen einen Wunschzettel, wie sie die Landwirtschaft gern hätten: klein und nett, viel bio, weil konventionell ja böse ist, viele freilaufende Tiere, am besten pro Hof zehn Tierarten und zwanzig Ackerfrüchte, ein paar Kühe, ein paar Schweine und Hühner dürfen auch nicht fehlen, dann klappt es auch mit dem Bauernhof als Streichelzoo für Kinder. Andere sind gar für eine vegane Landwirtschaft ganz ohne Tiere. In einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft sollen Bauern also den romantischen Vorstellungen von NGOs genügen. Ein Melkroboter für Milchbauern hat in diesen Phantasien keinen Platz, handelt es sich bei ihm doch um ein Werkzeug der Agrarindustrie. Während die Freunde der ‚nachhaltigen Landwirtschaft’ selbstverständlich mit Smartphones unterwegs sind, gestehen sie Bauern die Nutzung dieser Technik nur ungern zu.“31
Nicht zu übersehen ist: Die Freunde der „nachhaltigen Landwirtschaft“ reden wachstumskritisch und postwachstumsökonomisch daher. Im Einklang mit Verzichtsideologen à la Niko Paech wird ein Hohelied auf kleinkapitalistische Verhältnisse gesungen. Damit verknüpft sind nostalgische Forderungen nach einem Zurück „zur Natur“ und „zur Region“. So etwas findet momentan viel Anklang, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. So etwas muss aber trotzdem kritisiert werden, denn die postwachstumsökonomischen Zukunftsentwürfe bieten keine emanzipatorische Alternative zum (agrar-) wirtschaftlichen Status Quo. Eine Ökonomie, geprägt durch bäuerliche und handwerkliche Zwergbetriebe, würde alles nur noch schlimmer machen und für noch mehr Herrschaft, Patriarchat und Ungleichheit sorgen als der Hightech-Kapitalismus.
„Zurück zur Natur“ und „Zurück zur Region“ sind, so sympathisch solche Appelle angesichts von Globalisierungs- und Coronakrisen auch klingen mögen, historisch-politisch gesehen keine unbelasteten Forderungen. Es sind Postulate, die der selbstkritischen Reflexion bedürfen, denn die Idealisierung des Bäuerlichen und Ländlichen findet sich keinesfalls nur in der sich links wähnenden Wachstums- und Agrarkritik. Sie ist ebenso anzutreffen im neurechten Milieu. Hier tummeln sich allerlei Völkische, die durch Immobilienerwerb in ländlichen Räumen selbst versorgende Siedlungsgemeinschaften mit Blut-und-Boden-Mission aufbauen wollen. Eine Strategie, die nicht erstaunen kann, denn typisch für völkisches Denken ist seit jeher (neben der Gegenüberstellung von „schaffendem“ und raffendem“ Kapital) eine durch antiurbane Ressentiments gespeiste Unterscheidung zwischen „Stadt“ und „Land“.
Agraroppositionelle Fehlorientierungen
Sind die Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Landwirtschaft also allesamt rechts? Ganz bestimmt nicht. Gleichwohl sollten diejenigen, die nach linken Antworten auf die Agrar- und Umweltkrise suchen, den Konzepten dieser Freund_innen sehr kritisch begegnen. Die Idealisierung des Bäuerlichen und Ländlichen geht nämlich einher mit weiteren konzeptionellen Sackgassen:
§ Dem Antispeziesismus : Unter den Freundinnen und Freunden der nachhaltigen Landwirtschaft gibt es etliche, die angewidert von den Zuständen in der Fleischproduktion zur „Tierbefreiung“ aufrufen und Tiere und Menschen rechtlich gleichstellen wollen. Diese Gleichsetzung birgt inhumane Effekte: „Der Antispeziesismus verkennt …, dass hier Ungleiches gleich gemacht wird, was in der Konsequenz Menschenfeindlichkeit relativiert. Jüngst hieß es auf dem Schild eine Klimademonstranten: ‚Wäre das Klima eine Synagoge … was für ein Aufschrei!’. Solcherlei Entgleisungen treffen meist auch szeneintern auf Ablehnung. Der Antispeziesismus steht jedoch vor dem Problem, dass er sich kaum von solchen Aussagen abgrenzen kann.“32 Und er steht vor dem Problem, dass er fragwürdige Vordenker in seinen Reihen hat. Zum Beispiel den Tierrechtler Peter Singer, den philosophischen Wortführer einer animalisierten und gnadenlosen Konkurrenzgesellschaft, der kurzerhand Naturgesetze auf das menschliche Leben überträgt und ein sozialdarwinistisches survival of the fittest proklamiert.
§ Dem Faire-Preise-Postulat : Im Mittelalter wurde viel auf den „gerechten Preis“ gehalten. Für ein Produkt, das nicht für den Eigenbedarf, sondern für andere hergestellt wurde, sollte vom Käufer ein Preis gezahlt werden, der den Arbeitsaufwand und die „standesgemäßen Bedürfnisse“ des Produzenten berücksichtigt. Auch heute ist die Forderung nach gerechten oder fairen Preisen sehr beliebt. Siehe vor allem die Proteste des kleinbäuerlich geprägten „Bundes Deutscher Milchviehhalter“ gegen die als unfair empfundene Preispolitik der Molkereien und Supermärkte. Die Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Landwirtschaft solidarisierten sich mit diesen Protesten für „faire Preise“, ohne sich die Frage zu stellen, ob der Schulterschluss mit dem Kleinbauerntum im Sinne alternativer Zukunftsentwürfe tatsächlich etwas bringt: „Der Rückgriff auf mittelalterliche Kategorien ist nicht hilfreich für emanzipatorische Politik. Die sozialen Interessen von Kleinproduzenten zu verteidigen, kann notwendig sein, ersetzt jedoch nicht das Nachdenken über eine rationale Organisierung der landwirtschaftlichen Produktion in einer Welt, in der in vielen Ländern noch immer 80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Wer seine Kartoffeln selbst anbauen will, sollte die Möglichkeit dazu haben. Letztlich ist es jedoch ein Fortschritt, wenn immer mehr Menschen den Kornsack abwerfen und in die Welt ziehen können.“33
§ Der fehlenden Selbstkritik : Die Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Landwirtschaft nehmen gern und oft die konventionelle Agrarökonomie ins Visier. Zu einem auch mal kritischen Blick auf den von ihnen favorisierten Biolandbau sind sie aber nicht willens. Dabei gibt es Grund genug, ökologische Anbaumethoden nicht zum Heilsbringer zu erklären. So hinken die Ernteerträge im Biolandbau denen im konventionellen Anbau deutlich hinterher. Um ausreichend Nahrungsmittel für die wachsende Weltbevölkerung zu erzeugen, müssten die Biobauern ihre Anbauflächen erheblich vergrößern. Es müsste noch mehr Naturland in Ackerfläche umgewandelt werden. Doch gerade diese Umwandlung gehört zu den Hauptursachen für den Klimawandel, für verringerte Artenvielfalt und anscheinend auch für die aktuelle Covid-19-Pandemie.
Welche Landwirtschaft?
Es kann folglich nicht überraschen, dass es agrarwissenschaftliche Studien gibt, die durchaus Sympathien für den ökologischen Landbau hegen, aber zugleich vor einem Schwarz-Weiß-Denken im Streit um die Zukunft der Landwirtschaft warnen. Sie machen sich, was die Debatte ökologisch contra konventionell angeht, dafür stark, von polarisierenden Denkmustern Abschied zu nehmen und die Akzente in der Agrar- und Ernährungsdebatte anders zu setzen. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz liefert die differenziert argumentierende Seufert/Ramankutty-Studie: „Nach Ansicht von Seufert und Ramankutty gibt es … in der Frage des Biolandbaus kein klares Schwarz oder Weiß. Stattdessen gleiche die Lage eher einer Vielzahl von Grauschattierungen. ‚Kosten und Nutzen variieren sehr stark je nach Kontext’, betont Seufert. Die ökologische Landwirtschaft sei ein Weg, um die Nahrungsversorgung der Menschheit umweltverträglicher zu gestalten – aber nicht der einzige und alleinseligmachende. ‚Andere Veränderungen in unserem Ernährungssystem, wie die Vermeidung von Abfällen und das Essen von weniger Fleisch, könnten aus Umweltsicht sogar größere Vorteile bringen’, so die Forscher. Ihrer Meinung nach sollten wir zudem aufhören, die konventionelle und ökologische Landwirtschaft als ein Entweder-Oder zu sehen. ‚Stattdessen sollten Verbraucher in beiden Formen bessere Praktiken fordern.’“34
4. Verzichtsprediger im Doppelpack I
Zum Autorenduo Folkers & Paech (2020)
Manfred Folkers und Niko Paech haben Anfang des Jahres im Oekom Verlag das Buch All You Need Is Less veröffentlicht. Diese Anlehnung an einem bekannten Beatlessong klingt zweifelsohne amüsant. Alles andere als amüsant, sondern äußerst ärgerlich ist freilich die Lektüre der Publikation. Die „Kultur des Genug“, die das Autorenduo aus buddhistischer und ökonomischer Sicht nahe bringen will, taugt nicht als Leitfaden für eine Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Verhältnisse. Das gilt für beide Essays im Buch. Für Niko Paechs Suffizienz als Antithese zur modernen Wachstumsorientierung. Und für Manfred Folkers’ Buddhistische Motive für eine Überwindung der Gier-Wirtschaft.
Hier stichwortartig einige Anmerkungen zum Buddha-Essay:
§ Manfred Folkers preist die buddhistische Lehre als Problemlöserin par excellence. Sie halte das geistig-spirituelle Rüstzeug bereit, um die ökologischen und kulturellen Krisen der von den „Peitschen des Mehrungssystems“ getriebenen Zivilisation zu überwinden. Destruktive Gier lasse sich durch den Buddhismus in eine nachhaltige Haltung des „genug“ transformieren. Diese wiederum fördere Toleranz und Solidarität und ebne einer Achtsamkeit den Weg, in der Täuschung und Verblendung durch ein von Bewusstheit und Integrität geprägtes gutes Leben ersetzt werde. Schöne Worte, die allerdings nicht so recht zur Realität des Buddhismus passen mögen. Dort, wo er Politik und Gesellschaft stark prägt, erweist er sich oft als geradezu böse, fremdenfeindlich und mörderisch. Ein aktuelles Beispiel: Die blutige Verfolgung und Vertreibung muslimischer Rohingya in Burma (Myanmar) durch die buddhistisch orientierte Bevölkerungsmehrheit. Hingewiesen sei auch auf die jüngere Geschichte Sri Lankas. Zu den Hauptverantwortlichen dafür, dass auf der Insel im Indischen Ozean der Konflikt zwischen buddhistischen Singhalesen und hinduistischen Tamilen eskalierte und in einem Bürgerkrieg mündete, gehörte zweifelsohne der mächtige buddhistische Klerus.
§ Trotzdem findet sich bei Manfred Folkers keine Spur buddhistischer Selbstkritik. Stattdessen würdigt er in seinem Essay lieber den Dalai Lama. Das geistige Oberhaupt der buddhistischen Community fabriziert aber nicht nur banal-harmlose Kalenderspruchlyrik. Er ist ein – leider sehr populärer – esoterischer Obskurant mit Vorliebe für feudalistische Herrschaftsstrukturen, der gern mit grinsender Miene die schreckliche Mönchsherrschaft im alten Tibet verharmlost. Eine Umgestaltung des heutigen Tibet nach den Vorstellungen des gegenwärtigen Dalai Lama wäre gewiss kein Fortschritt. Der oberste Buddhist taugt nicht zum Vorbild. Genauso wenig wie ein anderer Liebling des Manfred Folkers: der armutsverklärende und frauenverachtende Mahatma Gandhi.
§ Manfred Folkers ist nicht nur angetan vom Dalai Lama, sondern auch von Niko Paech. Buddhistische Motive für eine Überwindung der Gier-Wirtschaft will zeigen, dass Buddhismus und Degrowth gut zusammenpassen. Viel Fundiertes springt dabei allerdings nicht raus. Im Gegenteil: Folkers’ Essay reproduziert die Fehlorientierungen der einschlägigen Wachstumskritik. Er ist voll von modischem Entschleunigungsgelaber, idealisiert das Leben in Bescheidenheit/Frugalität und unterscheidet sich letztlich nicht von Paech’schen Verzichtsideologien. Folkers geißelt mit besonderem Eifer den „Knopfdruckkonsumismus“. Und er schließt an ausgesprochen unappetitliche Strömungen der Postwachstumsbewegung an, wenn er in seinem Essay mal einfach so, unbedarft und unreflektiert, über vielschichtige Phänomene lamentiert: über Überbevölkerung, über Schuldenberge und über das Zinseszins-System.
§ Es zeigt sich: Folkers’ vollmundiges Versprechen, eine „vorbehaltslose Analyse“ der Gier-Wirtschaft zu liefern, wird nicht erfüllt. Sein Essay überschätzt einerseits die diagnostische Kraft der buddhistischen Lehre. Zugleich unterschätzt er das analytische Potenzial der Kapitalismusanalyse. Folkers kreidet ihr an, den Menschen zum bloßen Objekt maschinenhafter Systeme zu degradieren. Sozialtheoretische Klassiker wie Karl Marx oder Max Weber (der übrigens den Buddhismus religionssoziologisch sezierte) sind aber keineswegs blind für den individuellen Faktor. Sie beschäftigen sich sorgfältig mit den Zusammenhängen von Struktur und Handeln, speziell mit Handlungsrestriktionen und -möglichkeiten in der kapitalistischen Moderne. Sorgfältiger als der vermeintliche Menschenfreund Manfred Folkers. Der fixiert sich, im Einklang mit dem Gros der Wachstumskritik, in seinen Diagnosen und Lösungsvorschlägen auf den Konsum. Dass die meisten Menschen auch arbeiten müssen, thematisiert der Kalenderspruchexperte nur beiläufig. Folkers geht es um eine Ökologie des Konsums, eine Ökologie der (Lohn-) Arbeit fehlt bei ihm. Wer die Gier-Wirtschaft überwinden will, muss aber alle Bereiche des Alltagslebens berücksichtigen. Nicht bloß den „Knopfdruckkonsumismus“ der Verbraucher*innen, sondern auch die produktive Konsumtion, d.h. die Verkonsumtion der Arbeitskräfte im kapitalistischen Produktionsprozess. Einem Prozess mit einer komplexen Gleichzeitigkeit von Herrschaft und widerständigem Handeln, Ausbeutung und Solidarität.
§ Vonnöten ist eine sozial-ökologische Kritik kapitalistischer Lebens- und Produktionsweisen. Folkers’ Mix aus Dalai Lama und Degrowth leistet das nicht. Offensichtlich taugt der Buddhismus, siehe auch Erich Fromms doch recht kitschiges Haben oder Sein, nicht als Richtschnur einer Gesellschaftsanalyse auf der Höhe der Zeit. Aber was stattdessen lesen? Empfohlen sei zum Beispiel ein jüngst erschienenes Buch namens Shutdown, in dem es um eine kapitalismuskritische Erkundung der Zusammenhänge zwischen Wachstumszwängen und Covid-19-Pandemie geht. Wem das postwachstumsökonomische Geraune gegen das Zinseszins-System nicht behagt, sollte einen Blick auf die durch die Neue Marx-Lektüre angestoßenen Geld- und Wertdebatten werfen. Und wer im Gegensatz zu Manfred Folkers den Eindruck hat, dass Entschleunigung, Konsumverzicht und Frugalität keine echten Alternativen zum Status Quo sind, dürfte in akzelerationistischen und luxuskommunistischen Beiträgen einiges Interessantes entdecken.
So viel zu Buddhistische Motive für eine Überwindung der Gier-Wirtschaft. In Teil 2 geht es um das, was Niko Paech zu All You Need Is Less beigesteuert hat.
5. Verzichtsprediger im Doppelpack II
Zum Autorenduo Folkers & Paech (2020)
In Teil 1 ging es um den Essay, den Manfred Folkers zu All You Need Is Less beigesteuert hat. Im Folgenden richtet sich das Augenmerk auf Niko Paechs Beitrag. Seine Ausführungen in dem zum Jahresanfang veröffentlichten Buch sind betitelt: Suffizienz als Antithese zur modernen Wachstumsorientierung. Auch die Anmerkungen zu diesem Essay bemühen sich um Kürze und erfolgen deshalb ebenfalls in einer eher stichwortartigen Form:
§ Ein Grund für die Kürze der Kritik: Niko Paechs Essay bietet wenig Neues. Es taucht vieles auf, was schon in früheren Veröffentlichungen des Oldenburger Postwachstumsökonomen zu finden war. Zum Beispiel seine geradezu beleidigenden Äußerungen zu den heutigen Arbeitswelten. Lohnabhängige sind für Paech saturierte Faulpelze, die immer weniger leisten, aber zugleich immer mehr verdienen; die sich kaum noch anstrengen, aber eine materielle Versorgung wollen, die deutlich über die eigene Leistungsbereitschaft hinausgeht. Damit ignoriert der Guru der Postwachstumsbewegung nicht nur Offensichtliches: dass nämlich Stress, Belastungen und Leistungsdruck in den modernen Unternehmen keinesfalls abgenommen haben. Paech macht sich auch zum Fürsprecher einer Leistungsträgerideologie, die letztlich nur den Unternehmern und den beruflich besonders Erfolgreichen echte Leistungswilligkeit attestiert und gern die vermeintliche Anspruchsideologie der „einfachen Arbeitnehmer“ geißelt. Folglich kann es nicht verwundern, dass ökologisch orientierte Gewerkschafter*innen durchaus offen sind für Kooperationen mit Bewegungen à la Fridays for Future, aber um Gestalten wie Niko Paech zumeist lieber einen großen Bogen machen.
§ Solidarität mit den einfachen Arbeitnehmern ist von Niko Paech nicht zu erwarten. Er interessiert sich nicht für deren Arbeitsbedingungen. Und er stellt deren Konsum- und Freizeitverhalten wieder mal grob verzerrt und undifferenziert dar. Im Paech’schen Gesellschaftsbild wimmelt es von Leuten, die bei der Arbeit eigentlich nur rumhängen, aber außerhalb des Betriebs rastlos konsumieren, sich von Reizen überfluten lassen und unentwegt auf der Jagd nach Wohlstandstrophäen sind. Das alles münde in den schon von Erich Fromm konstatierten Verlust von Identität und Individualität. Sich auf dieses Mitglied der Frankfurter Schule zu berufen, vermag aber nicht so recht zu überzeugen. Es gibt sowohl in der älteren als auch in der neueren Kritischen Theorie eine Reihe von Kultur- und Zeitdiagnosen, die differenzierter und vielschichtiger argumentieren als der ins Buddhistische abgedriftete Erich Fromm. Hingewiesen sei auf Walter Benjamin oder Jürgen Habermas.
§ Erich Fromm kokettierte mit buddhistischer Spiritualität, wahrte aber stets Distanz zu den Ideen der kulturellen und politischen Rechten. Niko Paech verhält sich da nicht so eindeutig. Auch in Suffizienz als Antithese zur modernen Wachstumsorientierung lamentiert er sauertöpfisch über die „Bequemokratie“, bejammert eine um sich greifende „Virtuosität des Nichtkönnens“ und mahnt vor einem geistigen und körperlichen Verfall durch „eine logistisch und technisch aufgerüstete Fremdversorgung“. Das klingt doch sehr nach der völkisch grundierten Zivilisations- und Technikkritik eines Martin Heidegger. Und es zeigt sich damit ein weiteres Mal: Wer Distanz zum Oldenburger Sauertopf und dessen leider recht populären Wanderpredigerjargon wahrt, liegt richtig.
§ Der liegt im Übrigen auch deshalb richtig, weil Niko Paech kein wirtschaftswissenschaftlicher Dissident ist. Seine mikro- und zeitökonomischen Betrachtungen des Konsumgeschehens könnten auch einem ganz normalen BWL- oder VWL-Buch entstammen. Paech orientiert sich an der neoklassischen Grenznutzenlehre. Für die ist aber typisch, dass sie das Gewicht der Privathaushalte überzeichnet und die Macht der Unternehmen verharmlost. Das erkannte auch der gewiss nicht marxistischen Max Weber: „Für die ökonomische Theorie ist der Grenz konsument der Lenker der Richtung der Produktion. Tatsächlich, nach der Machtlage, ist dies für die Gegenwart nur bedingt richtig, da weitgehend der ‚Unternehmer’ die Bedürfnisse des Konsumenten ‚weckt’ und ‚dirigiert’, wenn dieser kaufen kann.“ Dieses Problembewusstsein fehlt Niko Paech. Da er trotzdem Plurale Ökonomik an der Universität Siegen lehrt, drängt sich natürlich die Frage auf, ob dieser angeblich unkonventionelle Studiengang tatsächlich eine Alternative zu den herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften verkörpert.
§ Nichts hält der plurale Ökonom von Ralf Fücks. Der realogrüne Vordenker, der mittels technischer Innovationen wirtschaftliches Wachstum ohne zusätzlichen Naturverbrauch ermöglichen will, ist für Paech ein abstruser Technikutopist. Da ist sicherlich was dran: Nur verliebt auf technische Innovationen zu schauen und zu hoffen, dass sie Mensch und Natur schonen, reicht nicht. Technik ist nichts Neutrales, sondern immer auch verwoben mit gesellschaftlichen Herrschafts- und Funktionsmechanismen. Aber ist es sinnvoll, Niko Paech zu folgen und einem Technikboykott das Wort zu reden? Nicht alle bekannten Wachstumskritiker*innen denken so. Zum Beispiel Maja Göpel, die in einem Interview mit der tageszeitung (taz) nicht nur, aber eben auch auf technische Neuerungen zur Lösung der Umweltkrise setzt.
§ Mit Maja Göpel setzt sich Niko Paech nicht auseinander. Er stilisiert sich lieber zum unerschrockenen „Suffizienzpionier“, der im Stile eines Mahatma Gandhi gegen alle Widerstände für eine genügsame und konsumbefreite Daseinsform wirbt. So groß sind die Widerstände aber leider gar nicht. Obwohl die Verwirklichung der Paech’schen Utopie eine kleinkapitalistische Mangel- und Elendswirtschaft zur Folge hätte, erntet der Oldenburger Postwachstumsökonom beachtlichen Zuspruch für seine Wanderpredigten. In Corona-Zeiten sind offenbar nicht nur populistische Verschwörungsideologien besonders angesagt, sondern auch Verklärungen des naturnah-einfachen Lebens.
§ Niko Paech tut so, als spreche er für eine übermenschliche Macht (die Natur). Im Stile eines zornigen Propheten mahnt er die Menschen zur reuigen Umkehr, um die ökologische Apokalypse zu verhindern. Ein Experte in ökologischen Fragen, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre, schlug einen anderen, einen besseren Weg vor: Friedrich Engels. Marx’ Wegbegleiter plädierte nicht für ein Paech’sches Zurück. Engels machte sich stark für ein die Erkenntnisse und Möglichkeiten moderner Wissenschaften nutzendes Vorwärts in Richtung einer nachkapitalistischen wissenschaftlich-technischen Zivilisation: Friedrich Engels vertraute „nicht auf die Macht der Natur, sondern glaubte, dass die Naturwissenschaften es den Menschen ermöglichen, die zerstörerischen Nebenwirkungen der Naturbeherrschung auf stofflicher Ebene vorauszusehen und sie zu vermeiden. Und auch den sozialen Nebenwirkungen könne nur durch rationale Sozialwissenschaften begegnet werden. Um deren Erkenntnisse tatsächlich berücksichtigen zu können, bedürfe es aber einer Umwälzung der bisherigen Produktionsweise und der gesamten gesellschaftlichen Ordnung. Für Engels verband sich mit der Rede von der ‚Rache der Natur’ kein back to nature.“ (Chr. Schmidt in jungle world vom 19.11.20)
[...]
1 https://www.labournet.de/?p=47203
2 Es gibt zwei Werkausgaben. Zum einen: Karl Marx, Friedrich Engels: Werke (MEW). Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin 1956 bis 1990 (43 Bände in 45 Büchern, zusätzlich zwei Register- und zwei Verzeichnisbände). Zum anderen: Karl Marx, Friedrich Engels: Gesamtausgabe (MEGA). Die auf insgesamt 114 Bände geplante historisch-kritische Ausgabe präsentiert Werk und Nachlass vollständig und in authentischer Form, unter Einbeziehung der Textgenese und aller Textvarianten. Beide Werkausgaben sind im Internet abrufbar.
3 Paech 2017, S. 42.
4 Ebd., S. 43.
5 Ebd.
6 Hofmann 1969, S. 63.
7 MEW 25, S. 838: „Im Kapital – Profit, oder besser noch Kapital – Zins, Boden – Grundrente, Arbeit – Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben.“
8 Heinrich 2016, S. 180.
9 Interessengemeinschaft Robotercommunismus.
10 MEW 3, S. 29 f.
11 Kößler/Wienold 2002, S. 170.
12 MEW 23, S. 95. Vgl. auch Heinrich 2004, S. 69 ff.
13 Kößler/Wienold 2002, S. 176.
14 Konicz 2014.
15 Heinrich 2004, S. 93 f.
16 Ebd., S. 94.
17 Paech 2017, S. 44.
18 Ortlieb 2013.
19 Interessengemeinschaft Robotercommunismus 2014
20 Boris 2017, S. 65.
21 Ebd., S. 64.
22 Berger 2003, S. 227. Hingewiesen sei auch auf eine aufschlussreiche Studie von Matthias M. Becker (2017), die nachweist, dass Arbeitsverdichtung, Leistungsdruck und Ausbeutung im digitalisierten Kapitalismus keineswegs aufhören.
23 Ganßmann 1998, S. 28.
24 Vgl. Paech 2017, S. 45.
25 Bierl 2015, S. 364. Wie schnell ein alternativökonomisch gefärbter Regionalismus in einen völkischen Nationalismus übergehen kann, zeigt der Werdegang des Oldenburger Soziologieprofessors Gerd Vonderach (vgl. Naber 2017).
26 Paech 2017, S. 45.
27 Lohoff/Trenkle 2012, S. 292.
28 Zum Beispiel in MEW 4, S. 63-182.
29 Interessengemeinschaft Robotercommunismus.
30 Ulrike Herrmann: Bauern sind auch nur Kapitalisten. In: taz.de vom 26.11.2019: https://taz.de/Proteste-von-Landwirten/!5640551/ (abgerufen am 12.04.2020).
31 Roland Röder: Ein besserer Bauernhof ist nicht käuflich. In: jungle world vom 18.01.2018: https://jungle.world/artikel/2018/03/ein-besserer-bauernhof-ist-nicht-kaeuflich (abgerufen am 12.04.2020).
32 Maximilian Schulz: Erdbeeren müssen nie weinen. In: jungle world vom 10.12.2019: https://jungle.world/artikel/2019/50/erdbeeren-muessen-nie-weinen (abgerufen am 12.04.2020).
33 Jörn Schulz: Nicht jeder will den Kornsack tragen. In: jungle world vom 12.06.2008: https://jungle.world/artikel/2008/24/nicht-jeder-will-den-kornsack-tragen (abgerufen am 12.04.2020).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Wachstumskritik statt Kritik der politischen Ökonomie?"?
Der Text setzt sich kritisch mit der Wachstumskritik auseinander, insbesondere mit den Positionen von Niko Paech. Es wird argumentiert, dass Paechs Kritik am Kapitalismus oberflächlich ist und keine emanzipatorische Alternative bietet. Stattdessen wird eine Rückkehr zur Kritik der politischen Ökonomie im Sinne von Karl Marx gefordert, um die Mechanismen des Kapitalismus und seine ökologischen Folgen besser zu verstehen.
Was kritisiert der Text an Niko Paechs Wachstumskritik?
Der Text kritisiert, dass Paechs Wachstumskritik den Kapitalismus naturalisiert, sich auf moralisierende Appelle zum Verzicht beschränkt und die Bedeutung von Arbeit, Kapital und Ausbeutung im kapitalistischen System verkennt. Außerdem wird Paech vorgeworfen, eine öko-elitäre Verachtung für die Lebens- und Konsumgewohnheiten von Menschen zu zeigen, die sich ausbeuten lassen müssen.
Was versteht der Text unter dem Begriff "Ausbeutung"?
Der Text bezieht sich auf den klassischen Marxschen Ausbeutungsbegriff, der besagt, dass die Produzierenden (Arbeitnehmer) von ihren Arbeitgebern weniger an Wert erhalten, als sie durch ihre Arbeit produzieren. Ausbeutung wird nicht auf niedrige Löhne oder schlechte Arbeitsbedingungen beschränkt, sondern als grundlegendes Merkmal des Kapitalismus dargestellt.
Was wird an der "Imperialen Lebensweise" (IL) kritisiert?
Obwohl die Konzepte der IL von Autoren wie Brand und Wissen als kritische Analysen postkolonialer Ausbeutung im "Süden" präsentiert werden, wird kritisiert, dass sie oft in moralische Vorhaltungen münden und pauschale Aussagen über die Abhängigkeit des "Nordens" von der Ausbeutung des "Südens" treffen, die empirisch nicht immer haltbar sind.
Was sind die Kritikpunkte an der modernen Landwirtschaft und der "Agrarwende"?
Es wird kritisiert, dass die moderne Landwirtschaft durch Massentierhaltung, intensiven Chemikalieneinsatz und den Zwang zur Gewinnmaximierung geprägt ist. Die Kritik an der "Agrarwende" richtet sich gegen romantisch-vormoderne Vorstellungen vom bäuerlichen Leben und eine Idealisierung von Kleinstbetrieben, die keine emanzipatorische Alternative zum Hightech-Kapitalismus darstellen.
Was wird an Folkers & Paechs "All You Need Is Less" kritisiert?
Der Text kritisiert, dass die "Kultur des Genug", die Folkers und Paech in ihrem Buch propagieren, keine geeignete Grundlage für eine Verbesserung der ökologischen und sozioökonomischen Verhältnisse darstellt. Insbesondere wird Folkers' Verklärung des Buddhismus und Paechs Leistungsträgerideologie und pauschale Kritik an Lohnabhängigen kritisiert.
Welche Alternativen zur Wachstumskritik werden im Text genannt?
Als Alternativen zur Wachstumskritik werden eine Rückkehr zur Kritik der politischen Ökonomie im Sinne von Karl Marx, eine sozial-ökologische Kritik kapitalistischer Lebens- und Produktionsweisen, die Berücksichtigung der Erkenntnisse moderner Wissenschaften zur Lösung von Umweltproblemen und eine nachkapitalistische wissenschaftlich-technische Zivilisation genannt.
- Quote paper
- Geert Naber (Author), 2022, Kritik der Wachstumskritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1248853