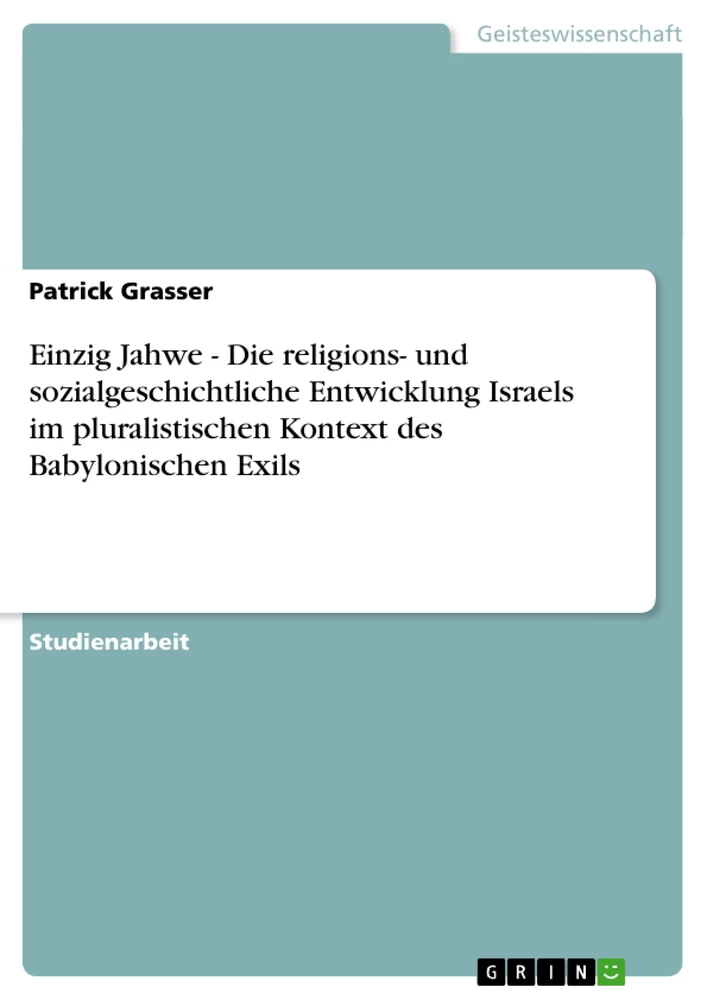Heute stellt das Judentum eine der großen Weltreligionen dar und gilt als Ausgangspunkt für die beiden weiteren monotheistischen Religionen, das Christentum und den Islam. Als wichtigstes Merkmal ist allen dreien der monotheistische Grundgedanke gemein. Jedoch ist diese Auffassung das Endprodukt einer langen Entwicklung. Sowohl während der Jahrhunderte von den Erzeltern über die Landnahme, als auch während der Königszeit ist es für Israel selbstverständlich, dass in ihrer Umwelt weitere Götter neben Jahwe existieren und von anderen Völkern verehrt werden. Doch genauso selbstverständlich sollte es für Israel sein, allein Jahwe zu verehren. Den Gott der Väter, der sich Mose am Sinai offenbart (Ex 20- 32) und Israel in der Geschichte seine Solidarität bezeugt hatte. Allerdings weisen die biblischen Quellen auf, dass dies nicht immer (uneingeschränkt) der Fall war. Es wird immer wieder deutlich, dass das auserwählte Volk, eigentlich dazu bestimmt ein alternatives Religions- und Gesellschaftskonzept umzusetzen dazu neigt, so zu sein wie alle Völker. Diese Entfernung von Jahwe und seiner Weisung wird von den Propheten aufs Strengste angemahnt und die Umsetzung die Herrschaft und das Recht Jahwes eingeklagt. Auf die Gerichtsprophetie soll im weiteren Verlauf der Arbeit noch eingegangen werden. 587 v. Chr. sieht sich das auserwählte Volk mit einer unvorstellbaren politischen und damit auch religiösen Katastrophe konfrontiert. Die als uneinnehmbar geltende Stadt Jerusalem wird vom babylonischen Großkönig Nebukadnezar besiegt. Der Tempel zerstört, die davidische Dynastie gestürzt. Es beginnt das Exil Israels. Die Zerstreuung Israels über die Grenzen des bisherigen Staates beginnt und hält bis in die heutige Zeit an.
Beachtlich ist jedoch, dass hier im Exil das Judentum erstmals als religiöse Größe erkennbar ist. Im Volk finden soziologische und religiöse Neuorientierungen statt, die für das Judentum und die daraus entstehenden Tochterreligionen grundlegenden Charakter haben. Finden wir in der Zeit vor dem Exil für Israel die religiöse Form der Monolatrie1, zeichnet sich nun im Exil ein neues Bild. Hier entwickelt sich der Monotheismus.
Diese Arbeit will sich den vielfältigen Einflüssen auf die Entwicklung Israels während des Exils und den entstehenden religiösen, sozialen und politischen Veränderungen Israels in dieser Zeit widmen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die politische Katastrophe
- 3. Die theologische Interpretation des politischen Unglücks
- 3.1 Die Klage und der exilische Gottesdienst
- 3.2 Literatur der Exilszeit
- 3.2.1 Die exilische Prophetie
- 3.2.2 Das Deuteronomische Geschichtswerk
- 4. Konfrontation mit einer gewaltigen Kultur
- 5. Religions- und sozialgeschichtliche Konsequenzen des Exils
- 5.1 Gesellschaftliche Umstrukturierung
- 5.2 Die Geburt des Monotheismus
- 6. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die religions- und sozialgeschichtliche Entwicklung Israels während des babylonischen Exils. Sie beleuchtet die Auswirkungen der politischen Katastrophe auf das religiöse Selbstverständnis Israels und die Entstehung des Monotheismus im Kontext des pluralistischen babylonischen Umfelds.
- Die politische Katastrophe von 587 v. Chr. und ihre Folgen
- Die theologische Interpretation des Exils in der exilischen Literatur
- Der Einfluss des babylonischen Kulturkreises auf Israel
- Die gesellschaftliche Umstrukturierung im Exil
- Die Entwicklung des Monotheismus aus der Monolatrie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Entwicklung des Monotheismus, beginnend mit der Verehrung Jahwes neben anderen Göttern im alten Israel bis hin zum monotheistischen Judentum. Sie betont den scheinbaren Widerspruch zwischen der monotheistischen Zielsetzung und dem polytheistischen Verhalten Israels und kündigt die Untersuchung der Veränderungen während des babylonischen Exils an, die zur Herausbildung des Monotheismus führten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Entwicklung des Judentums als religiöse Größe im Kontext der politischen und sozialen Umwälzungen.
2. Die politische Katastrophe: Dieses Kapitel beschreibt den Zerfall des israelitischen Reiches nach Salomos Tod und die daraus resultierenden Schwächen, die zu den Eroberungen durch Assur und später Babylon führten. Es betont die anhaltende Konflikte zwischen dem Nord- und Südreich und die fehlende gemeinsame Verteidigung gegen äußere Mächte. Die Kapitel beleuchtet die Kritik der Gerichtspropheten am politischen, sozialen und religiösen Zerfall und die Ankündigung des Gerichts Jahwes, ohne dass dies zu einer Umkehr führte. Trotzdem wird der Glaube an den Schutz Jahwes und die vermeintliche Uneinnehmbarkeit Jerusalems aufgrund des Zions hervorgehoben.
3. Die theologische Interpretation des politischen Unglücks: Dieses Kapitel analysiert die religiösen Reaktionen der Israeliten auf die Katastrophe des Exils. Es untersucht die Klagelieder und den exilischen Gottesdienst als Ausdruck des Leidens und der Suche nach Sinn. Die Analyse der exilischen Prophetie und des deuteronomistischen Geschichtswerkes soll Aufschluss über die unterschiedlichen theologischen Deutungen des Unglücks geben, wobei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Texten im Fokus stehen. Das Kapitel analysiert, wie die Erfahrung des Exils die religiöse Vorstellungswelt Israels geprägt hat und welche neuen theologischen Ansätze entstanden sind.
4. Konfrontation mit einer gewaltigen Kultur: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der babylonischen Kultur auf das Exilvolk Israel. Es wird die Begegnung mit einer fremden, mächtigen Kultur untersucht und wie diese Begegnung die religiösen, sozialen und kulturellen Gepflogenheiten Israels beeinflusste. Der Fokus liegt auf dem kulturellen Austausch und den Anpassungsprozessen der Exilgemeinschaft, sowie den Möglichkeiten des kulturellen Widerstandes oder der Integration in das babylonische Umfeld.
5. Religions- und sozialgeschichtliche Konsequenzen des Exils: Das Kapitel behandelt die tiefgreifenden Veränderungen in der israelitischen Gesellschaft und Religion während des Exils. Die gesellschaftliche Umstrukturierung wird im Detail analysiert, ebenso wie die Entstehung des Monotheismus als eine der wichtigsten Folgen des Exils. Hier werden die komplexen Prozesse der religiösen und sozialen Neuorientierung untersucht, die zur Bildung einer neuen, kohärenteren Identität im Exil führten und die Grundlage für das spätere Judentum legten.
Schlüsselwörter
Jahwe, Monotheismus, Monolatrie, Babylonisches Exil, Politische Katastrophe, Exilische Prophetie, Deuteronomistisches Geschichtswerk, Gesellschaftliche Umstrukturierung, Religiöse Neuorientierung, Judentum.
Häufig gestellte Fragen zur religions- und sozialgeschichtlichen Entwicklung Israels während des babylonischen Exils
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die religions- und sozialgeschichtliche Entwicklung Israels während des babylonischen Exils. Sie beleuchtet die Auswirkungen der politischen Katastrophe auf das religiöse Selbstverständnis Israels und die Entstehung des Monotheismus im Kontext des pluralistischen babylonischen Umfelds.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Katastrophe von 587 v. Chr. und ihre Folgen, die theologische Interpretation des Exils in der exilischen Literatur, den Einfluss des babylonischen Kulturkreises auf Israel, die gesellschaftliche Umstrukturierung im Exil und die Entwicklung des Monotheismus aus der Monolatrie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung mit der Skizzierung der Entwicklung des Monotheismus. Kapitel 2 beschreibt den Zerfall des israelitischen Reiches und die politische Katastrophe. Kapitel 3 analysiert die religiösen Reaktionen auf das Exil, insbesondere in der exilischen Literatur. Kapitel 4 befasst sich mit dem Einfluss der babylonischen Kultur. Kapitel 5 behandelt die religions- und sozialgeschichtlichen Konsequenzen des Exils, inklusive der gesellschaftlichen Umstrukturierung und der Entstehung des Monotheismus. Kapitel 6 bietet eine abschließende Betrachtung.
Wie wird die Entstehung des Monotheismus dargestellt?
Die Entstehung des Monotheismus wird als ein komplexer Prozess dargestellt, der eng mit den politischen und sozialen Umwälzungen des babylonischen Exils verbunden ist. Die Arbeit untersucht, wie die Erfahrung des Exils und die Konfrontation mit der babylonischen Kultur die religiöse Vorstellungswelt Israels prägten und zu neuen theologischen Ansätzen führten, die letztendlich zur Herausbildung des Monotheismus beitrugen.
Welche Rolle spielt die exilische Literatur?
Die exilische Literatur, insbesondere die exilische Prophetie und das deuteronomistische Geschichtswerk, spielt eine zentrale Rolle in der Analyse der theologischen Interpretation des Exils. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Deutungen des Unglücks in diesen Texten und deren Beitrag zum Verständnis der religiösen Entwicklung im Exil.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind Jahwe, Monotheismus, Monolatrie, Babylonisches Exil, Politische Katastrophe, Exilische Prophetie, Deuteronomistisches Geschichtswerk, Gesellschaftliche Umstrukturierung, Religiöse Neuorientierung, Judentum.
- Arbeit zitieren
- Patrick Grasser (Autor:in), 2003, Einzig Jahwe - Die religions- und sozialgeschichtliche Entwicklung Israels im pluralistischen Kontext des Babylonischen Exils, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12493