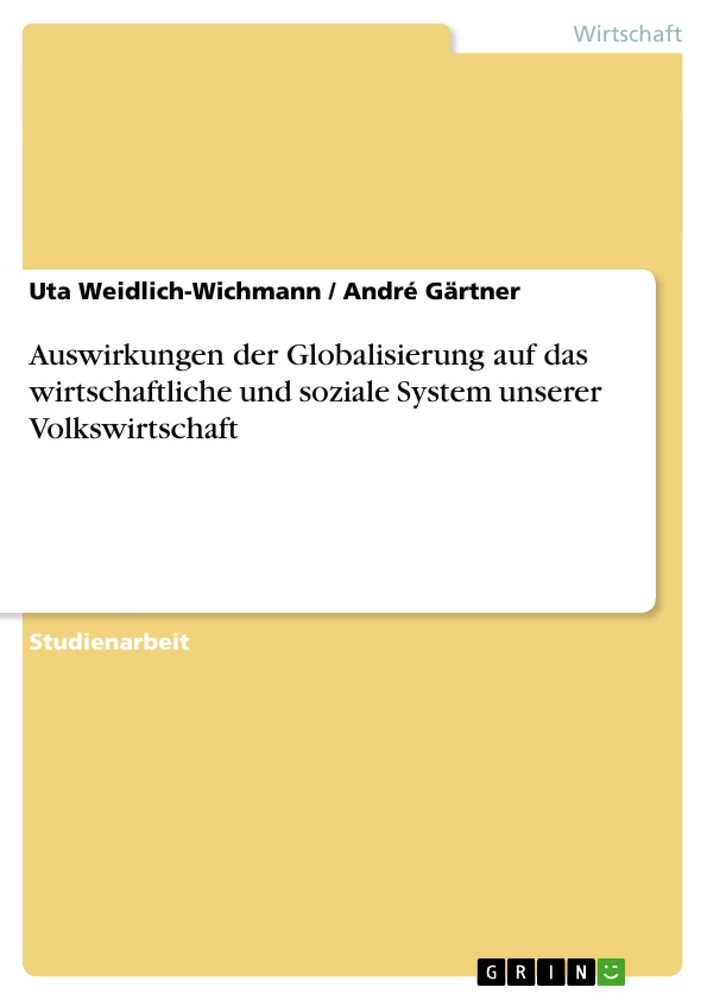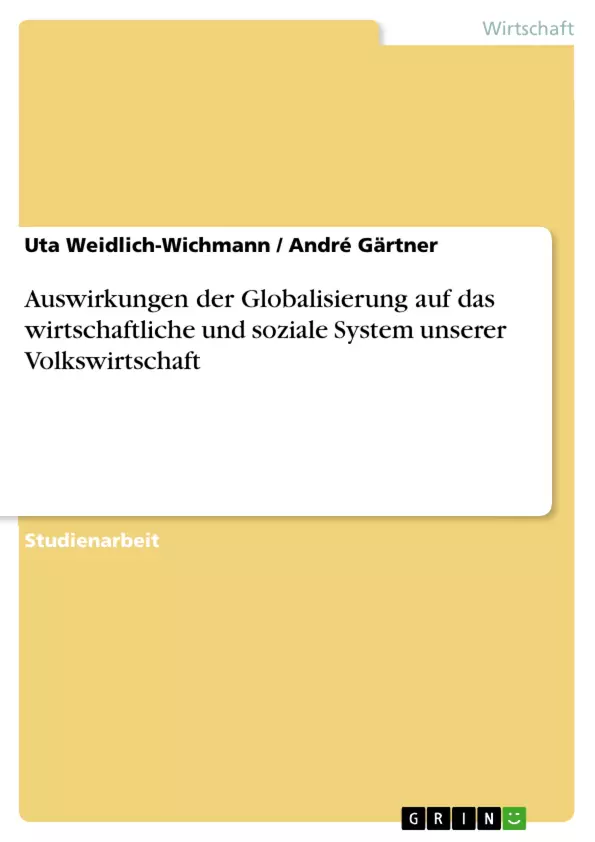In dieser Ausarbeitung soll die Globalisierung im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen und sozialen System unserer Volkswirtschaft betrachtet werden. Ausgewählte Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Systems sollen untersucht werden, um Effekte der Globalisierung festzustellen.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll zunächst in Kapitel 2 der Begriff der Globalisierung erläutert werden und die Abgrenzung der wirtschaftlichen Globalisierung erfolgen. Es soll dargestellt werden, wie und weshalb sich die wirtschaftliche Globalisierung entwickelt hat. Darauf aufbauend sollen in Kapitel 3 die begünstigenden unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Globalisierung seit dem Jahr 1945 aufgezeigt werden. Nachfolgend sollen in Kapitel 4 eine Bestandsaufnahme des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Auswirkungen der Globalisierung auf diesen vorgestellt werden. Im Anschluss sollen im Kapitel 5 das Prinzip des Sozialstaats und die Folgen der Globalisierung auf das soziale System von Deutschland dargelegt werden. Den Abschluss dieser Ausführung bildet das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2 Globalisierung
- 2.1 Dimensionen der Globalisierung
- 2.2 Wirtschaftliche Globalisierung
- 2.2.1 Geschichtliche Entwicklung
- 2.2.2 Außenhandel
- 2.2.2.1 Gründe für Außenhandel
- 2.2.2.2 Gewinner und Verlierer beim Außenhandel
- 3 Begünstigungen der Globalisierung seit 1945
- 3.1 Politische Rahmenbedingungen
- 3.2 Technische Innovationen
- 3.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.3.1 Internationale Standortbedingungen
- 3.3.2 Multinationale Unternehmen
- 4 Wirtschaftsstandort Deutschland
- 4.1 Bestandsaufnahme aus deutscher Sicht
- 4.2 Veränderungen des Wirtschaftssystems
- 4.2.1 Warenausfuhren
- 4.2.2 Direktinvestitionen
- 4.2.3 Arbeitsmarkt und Strukturwandel
- 4.2.4 Wohlfahrtsveränderungen
- 4.2.5 Finanzmärkte
- 5 Soziales System in Deutschland
- 5.1 Gestalt des deutschen Sozialstaats
- 5.2 Effekte der Globalisierung auf die Sozialsysteme
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf das wirtschaftliche und soziale System Deutschlands. Ziel ist es, die wichtigsten Veränderungen und Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der Globalisierung ergeben. Die Arbeit analysiert sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte.
- Die Dimensionen der Globalisierung und ihre geschichtliche Entwicklung
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf den deutschen Außenhandel
- Die Veränderungen des deutschen Wirtschaftssystems im Kontext der Globalisierung
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Die Effekte der Globalisierung auf das deutsche Sozialsystem
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Studienarbeit ein, beschreibt die Problemstellung und benennt das Ziel sowie den Aufbau der Arbeit. Sie dient als wichtiger Rahmen, um die nachfolgenden Kapitel zu kontextualisieren und die Forschungsfrage zu definieren.
2 Globalisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Globalisierung und beleuchtet dessen verschiedene Dimensionen. Es wird ein Überblick über die wirtschaftliche Globalisierung gegeben, inklusive ihrer geschichtlichen Entwicklung und Auswirkungen auf den Außenhandel. Die Analyse konzentriert sich auf die Faktoren, die den Außenhandel beeinflussen, und auf die daraus resultierenden Gewinner und Verlierer. Dies legt den Grundstein für das Verständnis der weiteren Kapitel, welche die konkreten Auswirkungen auf Deutschland untersuchen.
3 Begünstigungen der Globalisierung seit 1945: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die die Globalisierung seit dem Zweiten Weltkrieg begünstigt haben. Hierbei werden politische Rahmenbedingungen, technische Innovationen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie internationale Standortbedingungen und die Rolle multinationaler Unternehmen, analysiert. Der Fokus liegt auf den positiven Einflussfaktoren, die das Wachstum und die Integration in die globale Wirtschaft vorangetrieben haben. Dies steht im Kontrast zu den Herausforderungen, die in späteren Kapiteln im Detail besprochen werden.
4 Wirtschaftsstandort Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es beginnt mit einer Bestandsaufnahme und geht dann auf die Veränderungen des Wirtschaftssystems ein. Dies umfasst die Entwicklung der Warenausfuhren, Direktinvestitionen, den Arbeitsmarkt mit seinem Strukturwandel, Wohlfahrtsveränderungen und die Rolle der Finanzmärkte. Die detaillierte Betrachtung dieser Bereiche bietet einen umfassenden Einblick in die komplexen Auswirkungen der Globalisierung auf die deutsche Wirtschaft.
5 Soziales System in Deutschland: Dieses Kapitel fokussiert sich auf das deutsche Sozialsystem und seine Gestalt im Kontext des Sozialstaats. Es analysiert detailliert, wie die Globalisierung die Sozialsysteme beeinflusst, indem es die Herausforderungen und Anpassungsnotwendigkeiten beleuchtet, die sich aus der Globalisierung ergeben. Die Zusammenhänge zwischen den wirtschaftlichen Veränderungen (beschrieben in Kapitel 4) und den sozialen Auswirkungen werden hier explizit hergestellt.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Wirtschaftssystem, Sozialsystem, Außenhandel, Deutschland, Multinationale Unternehmen, Direktinvestitionen, Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsstaat, Strukturwandel, Finanzmärkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Auswirkungen der Globalisierung auf das wirtschaftliche und soziale System Deutschlands
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf das wirtschaftliche und soziale System Deutschlands. Sie analysiert sowohl positive als auch negative Aspekte dieser Entwicklung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Dimensionen der Globalisierung, ihre geschichtliche Entwicklung, Auswirkungen auf den deutschen Außenhandel, Veränderungen im deutschen Wirtschaftssystem (Warenausfuhren, Direktinvestitionen, Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsveränderungen, Finanzmärkte), und die Effekte der Globalisierung auf das deutsche Sozialsystem und den Sozialstaat.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Aufbau), Globalisierung (Definition, Dimensionen, wirtschaftliche Globalisierung, Außenhandel), Begünstigungen der Globalisierung seit 1945 (politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, technische Innovationen), Wirtschaftsstandort Deutschland (Bestandsaufnahme, Veränderungen des Wirtschaftssystems), Soziales System in Deutschland (Gestalt des Sozialstaats, Effekte der Globalisierung auf die Sozialsysteme), und Fazit.
Welche Faktoren haben die Globalisierung seit 1945 begünstigt?
Die Arbeit identifiziert politische Rahmenbedingungen, technische Innovationen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (internationale Standortbedingungen, multinationale Unternehmen) als wichtige Faktoren, die die Globalisierung seit dem Zweiten Weltkrieg vorangetrieben haben.
Wie wirkt sich die Globalisierung auf den deutschen Arbeitsmarkt aus?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Globalisierung auf den deutschen Arbeitsmarkt im Kontext des Strukturwandels. Dieser Aspekt wird im Kapitel über den Wirtschaftsstandort Deutschland detailliert behandelt.
Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf das deutsche Sozialsystem?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Anpassungsnotwendigkeiten des deutschen Sozialsystems im Angesicht der Globalisierung. Der Fokus liegt auf den Effekten der Globalisierung auf den deutschen Sozialstaat und seine Gestaltung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Globalisierung, Wirtschaftssystem, Sozialsystem, Außenhandel, Deutschland, Multinationale Unternehmen, Direktinvestitionen, Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsstaat, Strukturwandel, Finanzmärkte.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die einen Überblick über den Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse gibt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die wichtigsten Veränderungen und Herausforderungen aufzuzeigen, die sich aus der Globalisierung für das wirtschaftliche und soziale System Deutschlands ergeben.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Globalisierung und deren Auswirkungen auf Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Uta Weidlich-Wichmann (Autor:in), André Gärtner (Autor:in), 2008, Auswirkungen der Globalisierung auf das wirtschaftliche und soziale System unserer Volkswirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124984