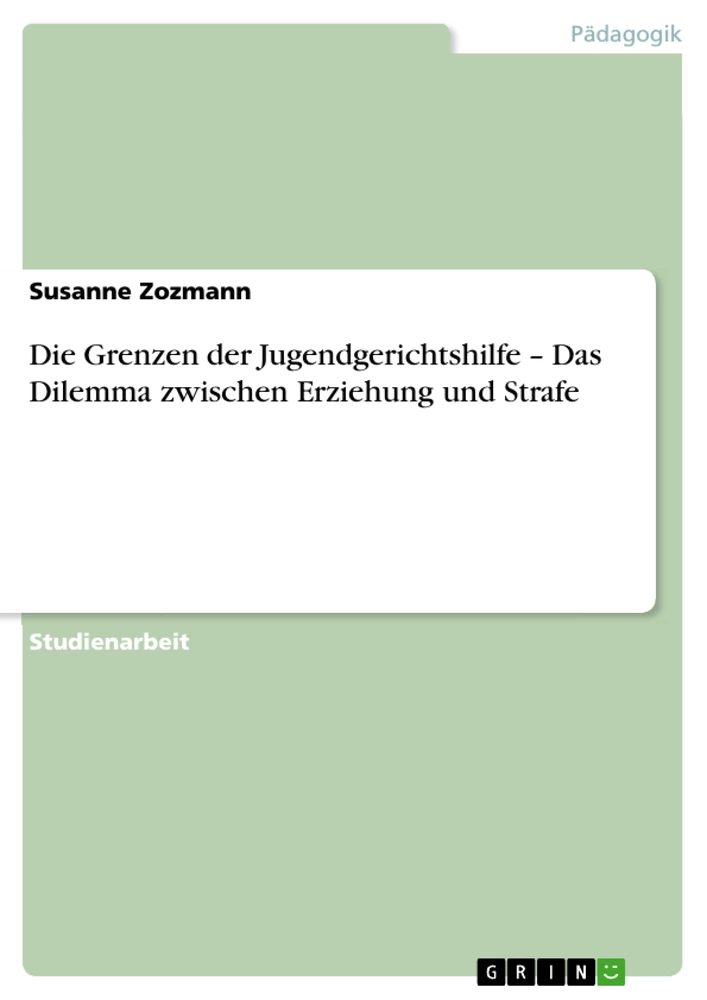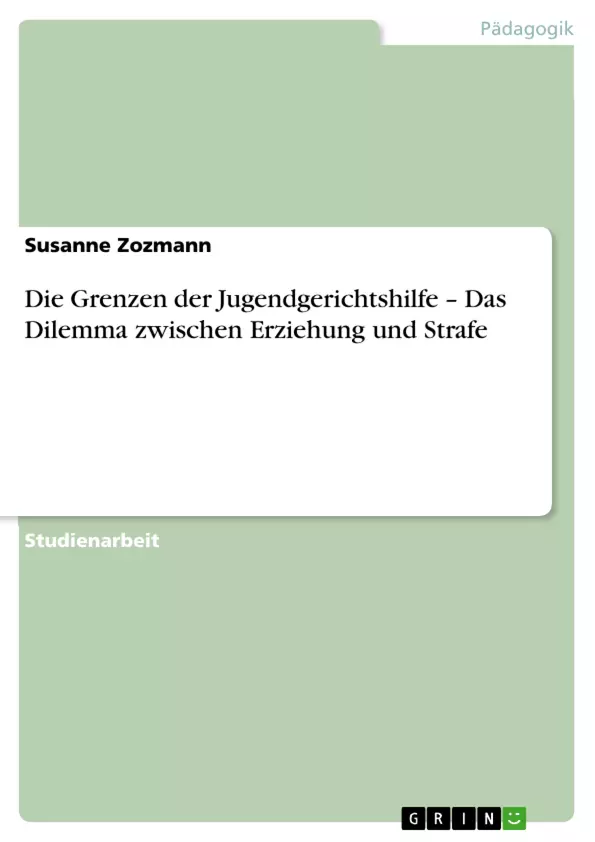Mit der Entstehung der Jugendgerichtshilfe (JGH) im Jahre 1882 wurde eine Instanz der sozialen Arbeit geboren, die mit widersprüchlichen Aufgaben und Erwartungen wie keine Andere konfrontiert ist. Die JGH soll, mit der Rolle eines doppelten Mandats gestraft, als Repräsentant der Jugendgerichtshilfe junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und so den Ansprüchen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) nach Herausbildung einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gerecht werden, sodass sie im Rahmen der Jugendhilfe als helfende Institution anzusehen ist. Zugleich ist sie aber als Ermittlungsinstanz eingebettet in ein strafendes Kriminalsystem, welches dem Jugendlichen die Falschheit seiner Tat verdeutlichen möchte durch das Mittel der Sanktionen. Folglich ist die JGH als personifizierte Widersprüchlichkeit von Erziehung und Strafe ein Element des Jugendstrafrechts, welches neben den Anspruch zu Strafen unter einem notorischen Erziehungswahn leidet. Die „Bindegliedstellung“ zwischen Justiz und Pädagogik ist zudem das Verhängnis der JGH und soll in der vorliegenden Arbeit unter Anderem thematisiert werden.
Hinter dem Titel „Die Grenzen der Jugendgerichtshilfe – das Dilemma zwischen Erziehen und Strafen“ verbirgt sich der Gedanke, mit Hilfe der Doppelpositionierung die daraus resultierenden Probleme beziehungsweise Grenzen ersichtlich zu machen, wobei der eben genannte Anspruch, eine Instanz zu schaffen, die zugleich Straffvollzieher als auch Erzieher ist, das eigentliche Übel aller auftretender Defizite nach sich zieht. Um die Widersprüchlichkeit zu verdeutlichen ohne den Leser sofort in die Problemlage zu werfen, soll zu Beginn eine allgemeine Betrachtung der Entstehung der JGH und der damit verbundenen Erwartungen aufgestellt werden.In einen zweiten Schritt wird auf die im § 38 JGG verankerten Aufgaben und Pflichten zu verweisen sein,anhand derer sich bereits Schwachstellen und Widersprüchlichkeiten zeigen.Im dritten Punkt wird kurz die Funktion der JGH angerissen,die sich aus der Gesetzeslage ergibt.Bevor es um die Grenzen geht,ist es notwendig, den erzieherischen Anspruch und die daran gebundenen Maßnahmen zu hinterfragen,da diese ein Teil des eigentlichen Dilemmas ausmachen.Innerhalb des Gliederungspunktes werden darüber hinaus einige erzieherische Maßnahmen,wie beispielsweise der Täter-Opfer-Ausgleich und die sozialen Trainingskurse,genauer beleuchtet und eine Kurzuntersuchung in Hinblick auf deren Effektivität...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II. 1. Allgemeines - die Entstehung und Notwendigkeit der Jugendgerichtshilfe (JGH)
- II. 2. Die Aufgaben und Rechtsstellung der Jugendgerichtshilfe
- II. 2. 1. Die Mitwirkungsrechte der Jugendgerichtshilfe und die damit verbundenen Aufgaben
- II. 2. 2. Die Beteiligungsrechte
- II. 2. 3. Die verfahrensbegleitenden Rechte
- II. 3. Die Funktion der Jugendgerichtshilfe
- II. 4. Die erzieherischen Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe und deren Wirkung
- II. 5. Die Grenzen der Jugendgerichtshilfe
- II. 5. 1. Die finanziellen Grenzen
- II. 5. 2. Die zeitlichen Grenzen
- II. 5. 3. Die Grenze der fachlichen Kompetenzen
- II. 5. 4. Das Dilemma des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechts
- II. 5. 5. Die Grenzziehung zwischen Erziehen und Strafen oder die Kluft zwischen Freiwilligkeit und Zwang
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendgerichtshilfe (JGH) und ihre widersprüchliche Position zwischen Erziehung und Strafe. Ziel ist es, die daraus resultierenden Grenzen und Probleme aufzuzeigen. Die Doppelrolle der JGH als sowohl erzieherische als auch strafverfolgende Instanz wird als Kernproblem betrachtet.
- Entstehung und Notwendigkeit der Jugendgerichtshilfe
- Aufgaben und Rechtsstellung der Jugendgerichtshilfe im Spannungsfeld zwischen JGG und KJHG
- Erzieherische Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe und deren Effektivität
- Grenzen der Jugendgerichtshilfe: finanzielle, zeitliche und fachliche Aspekte
- Das Dilemma zwischen Erziehen und Strafen sowie Freiwilligkeit und Zwang
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die widersprüchliche Rolle der Jugendgerichtshilfe (JGH) als Bindeglied zwischen Justiz und Pädagogik. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus dem doppelten Mandat ergeben: die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen einerseits und die Einbettung in ein strafendes System andererseits. Die Arbeit kündigt eine Auseinandersetzung mit den Grenzen der JGH an, die aus dieser Doppelpositionierung resultieren.
II. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit einer Betrachtung der Entstehung der JGH im Kontext der steigenden Jugendkriminalität im 19. Jahrhundert. Es wird die Notwendigkeit einer Instanz betont, die sowohl die Persönlichkeit des Jugendlichen als auch seine Lebensumstände berücksichtigt, um geeignete erzieherische Maßnahmen zu finden. Die rechtliche Verankerung der JGH im JGG und KJHG wird erläutert, wobei die Widersprüchlichkeiten in ihren Aufgaben hervorgehoben werden. Der Hauptteil geht dann detailliert auf die Aufgaben der JGH ein, unterteilt in Mitwirkungs-, Beteiligungs- und verfahrensbegleitende Rechte. Kritisch beleuchtet werden die Herausforderungen der JGH bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere die Erstellung von Persönlichkeitsanalysen und die Abwägung zwischen erzieherischen und strafrechtlichen Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Jugendgerichtshilfe, Jugendstrafrecht, Jugendhilfe, Erziehung, Strafe, Widerspruch, Grenzen, Mitwirkungsrechte, Beteiligungsrechte, Verfahrensbegleitung, JGG, KJHG, Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Effektivität, fachliche Kompetenz, Freiwilligkeit, Zwang.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Jugendgerichtshilfe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Jugendgerichtshilfe (JGH) und ihre komplexe Rolle im Spannungsfeld zwischen Erziehung und Strafe. Sie analysiert die daraus resultierenden Grenzen und Probleme, insbesondere die Doppelrolle der JGH als erzieherische und strafverfolgende Instanz.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Notwendigkeit der JGH, ihren Aufgaben und ihrer Rechtsstellung (im Kontext des JGG und KJHG), den erzieherischen Maßnahmen und deren Effektivität, sowie den Grenzen der JGH in finanzieller, zeitlicher und fachlicher Hinsicht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Dilemma zwischen Erziehen und Strafen sowie Freiwilligkeit und Zwang.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Der Hauptteil beinhaltet detaillierte Abschnitte zu den Aufgaben der JGH (Mitwirkungs-, Beteiligungs- und verfahrensbegleitende Rechte), den erzieherischen Maßnahmen und den verschiedenen Grenzen der JGH (finanzielle, zeitliche, fachliche Grenzen, das Problem des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechts und die Abwägung zwischen Erziehen und Strafen/Freiwilligkeit und Zwang).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Jugendgerichtshilfe, Jugendstrafrecht, Jugendhilfe, Erziehung, Strafe, Widerspruch, Grenzen, Mitwirkungsrechte, Beteiligungsrechte, Verfahrensbegleitung, JGG, KJHG, Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Effektivität, fachliche Kompetenz, Freiwilligkeit und Zwang.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass die Jugendgerichtshilfe aufgrund ihrer widersprüchlichen Position zwischen Erziehung und Strafe mit erheblichen Grenzen und Problemen konfrontiert ist. Diese Doppelrolle stellt ein Kernproblem dar, das im Detail untersucht wird.
Welche konkreten Probleme der Jugendgerichtshilfe werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert unter anderem die finanziellen, zeitlichen und fachlichen Grenzen der JGH, das Dilemma des fehlenden Zeugnisverweigerungsrechts und den Konflikt zwischen erzieherischen und strafrechtlichen Maßnahmen. Die Schwierigkeit, die Balance zwischen Freiwilligkeit und Zwang zu halten, wird ebenfalls kritisch beleuchtet.
Welche Kapitelzusammenfassung bietet die Arbeit?
Die Einleitung beschreibt die widersprüchliche Rolle der JGH. Der Hauptteil beleuchtet die Entstehung der JGH, ihre rechtliche Verankerung, Aufgaben und Herausforderungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben (z.B. Persönlichkeitsanalysen, Abwägung erzieherischer und strafrechtlicher Maßnahmen). Die Arbeit endet mit einem Schlussteil (der im Detail nicht beschrieben wird).
- Quote paper
- Susanne Zozmann (Author), 2008, Die Grenzen der Jugendgerichtshilfe – Das Dilemma zwischen Erziehung und Strafe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125027