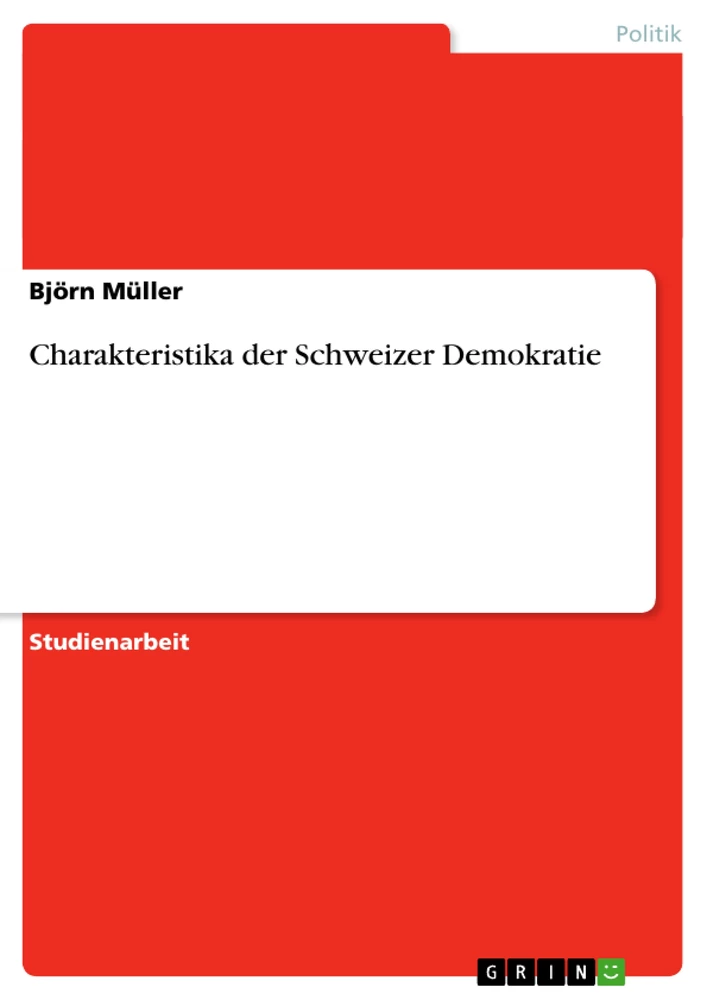Im Dezember 2007 starrte Deutschland fasziniert auf den Nachbarn Schweiz. Christoph Blocher, Vorsitzender der stärksten Partei, der SVP (Schweizerische Volkspartei) war von der Bundesversammlung nicht als Mitglied der Regierung bestätigt worden. Die SVP ging daraufhin in die Opposition. Das einem Bundesrat die Wahl versagt wurde, kommt zwar seit Einführung der „Zauberformel“ selten vor, ist im System aber vorgesehen. Das eine Regierungspartei ankündigte den Weg des Konsens zu verlassen, und es schließlich auch tat, war neu. In deutschen Zeitungen war vom Ende des „Schweizer Models“ die Rede. Hierzulande gilt das Staatswesen der Schweiz als „So sollte Demokratie eigentlich sein“- Typus schlechthin. In die Wahrnehmung der Vorgänge mischte sich nicht selten ein wenig Schadenfreude. Bis dato schien die von der „Zauberformel“ dirigierte „Wohlfühldemokratie“ der Eidgenossen unantastbar zu sein. Immer wieder wurde der Tod des berühmten „Zwangs zum Konsens“ attestiert. Fast ein Jahr später, zeichnet sich jedoch ein Sieg der Schweizer Konkordanz ab. Im Oktober 2008 versagte die SVP ihrer Führungsspitze die Gefolgschaft. Auf Grund von Skandalen droht der Sturz des zweiten von der SVP in die Regierung entsandten Rates, Samuel Schmid. Doch die SVP verweigerte eine Vorabnominierung Blochers. Vielen geht der Konfrontationskurs ihres Vorsitzenden inzwischen zu weit. Also doch kein Ende des Sonderfalls Schweiz? Der Schweizer Politologe Silvano Möckli schreibt in seinem Buch „Das politische System der Schweiz verstehen“: „Die Schweiz hat über sieben Jahrhunderte jenes politische System herausgebildet, das ihren Verhältnissen angemessen ist. In der Kombination der Einzelteile ist es einzigartig und unterscheidet sich von allen anderen politischen Systemen. Es ist deswegen aber nicht 'besser' als andere politische Systeme. Jedes politische System ist ein 'Sonderfall'.“ Die vorliegende Seminararbeit möchte dieser Aussage folgen und die spezifischen Charakteristika der Schweizer Demokratie aufzeigen. Als erstes werden prägenden Einflüsse bei der Herausbildung der politischen Kultur anhand eines historischen Entwicklungsüberblicks des eidgenössischen Staates aufgezeigt. Es folgt eine Beschreibung über deren Einbindung in die erste demokratische Verfassung der Schweiz von 1848. Von dieser Basis aus endet die Arbeit mit einem Überblick der Ausentwicklung der „halbdirekten Demokratie“ Schweizer Typs.
Björn Müller
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Einleitung
- 2.) Historische Entstehung der Charakteristika der Schweizer Demokratie
- 2.1.) Die „Alte Eidgenossenschaft“ entsteht
- 2.2.) Die Ausformung eines besonderen Staatswesens
- 2.3.) Die Gefahr der Spaltung
- 2.4.) Das Ende der „Alte Eidgenossenschaft“
- 2.5.) Der Weg zur Bundesverfassung von 1848
- 3.) Die Schweizer Bundesverfassung von 1848
- 3.1.) Kernelemente der neuen Verfassung
- 3.2.) Bund und Kantone
- 3.3.) Legislative und Exekutive neuen Zuschnitts
- 3.4.) Zum Wesen der neuen Verfassung
- 3.5.) Die Grundlagen der „halbdirekten“ Schweizer Demokratie
- 3.6.) Leistungen der Bundesverfassung von 1848
- 4.) Weitere wichtige Entwicklungslinien der Schweizer Demokratie bis heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die spezifischen Charakteristika der Schweizer Demokratie. Ziel ist es, prägende Einflüsse auf die Herausbildung der politischen Kultur aufzuzeigen, indem ein historischer Entwicklungsüberblick des eidgenössischen Staates gegeben wird. Die Einbindung dieser Einflüsse in die erste demokratische Verfassung von 1848 wird beschrieben, bevor die Arbeit mit einem Überblick über die Entwicklung der „halbdirekten Demokratie“ Schweizer Typs abschließt.
- Historische Entwicklung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
- Einfluss der „Alten Eidgenossenschaft“ auf die heutige Demokratie
- Die Bundesverfassung von 1848 und ihre Kernelemente
- Das föderale Element in der Schweizerischen Demokratie
- Entwicklung der „halbdirekten Demokratie“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beleuchtet den Fall Blochers und die Diskussion um das „Schweizer Modell“ in den Medien. Sie führt in die Thematik der spezifischen Charakteristika der Schweizer Demokratie ein und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 (Historische Entstehung): Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der „Alten Eidgenossenschaft“ aus dem Bund der drei Waldstätte (Uri, Schwyz, Nidwalden) im Kontext der politischen Verhältnisse des späten Mittelalters. Es erläutert die allmähliche Erweiterung des Bundes, die verschiedenen Interessenslagen der beteiligten Herrschaften und die Entwicklung der „Landsgemeinden“ als Ausdruck demokratischer Elemente.
Kapitel 3 (Die Bundesverfassung von 1848): Dieser Abschnitt behandelt die Kernelemente der Bundesverfassung von 1848, das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, sowie die neue Struktur von Legislative und Exekutive. Die Grundlagen der „halbdirekten“ Demokratie werden erklärt.
Schlüsselwörter
Schweizer Demokratie, Alte Eidgenossenschaft, Bundesverfassung 1848, halbdirekte Demokratie, Föderalismus, Landsgemeinde, Konkordanz, „Zauberformel“, politische Kultur, historische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Besonderheiten der Schweizer Demokratie?
Die Schweiz zeichnet sich durch eine "halbdirekte Demokratie", einen starken Föderalismus, das Konkordanzsystem und direktdemokratische Elemente wie Volksabstimmungen aus.
Was bedeutet "halbdirekte Demokratie"?
Es ist eine Mischform, bei der das Volk neben der Wahl von Repräsentanten auch direkt über Sachfragen durch Initiativen und Referenden entscheiden kann.
Was ist die "Zauberformel" im Schweizer Bundesrat?
Die Zauberformel war ein jahrzehntelanger parteipolitischer Verteilschlüssel für die sieben Sitze im Bundesrat, um eine möglichst breite Unterstützung der Regierung zu sichern.
Welche Bedeutung hat die Bundesverfassung von 1848?
Sie legte den Grundstein für den modernen Bundesstaat, schuf ein Gleichgewicht zwischen Bund und Kantonen und etablierte die ersten demokratischen Strukturen auf nationaler Ebene.
Was versteht man unter dem "Konkordanzprinzip"?
Es ist das Bestreben, alle maßgeblichen politischen Kräfte in den Entscheidungsprozess einzubinden und Lösungen durch breiten Konsens statt durch einfache Mehrheiten zu finden.
Was ist eine "Landsgemeinde"?
Eine historische Form der direkten Demokratie in einigen Kantonen, bei der stimmberechtigte Bürger unter freiem Himmel per Handzeichen über Gesetze und Wahlen abstimmen.
- Arbeit zitieren
- Björn Müller (Autor:in), 2008, Charakteristika der Schweizer Demokratie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125032