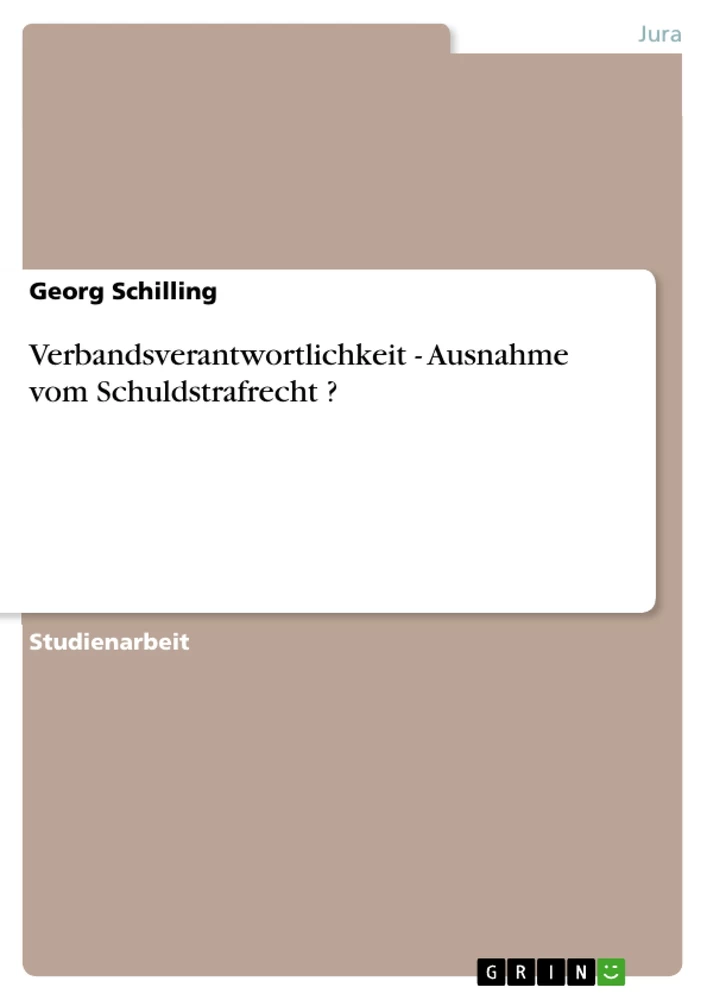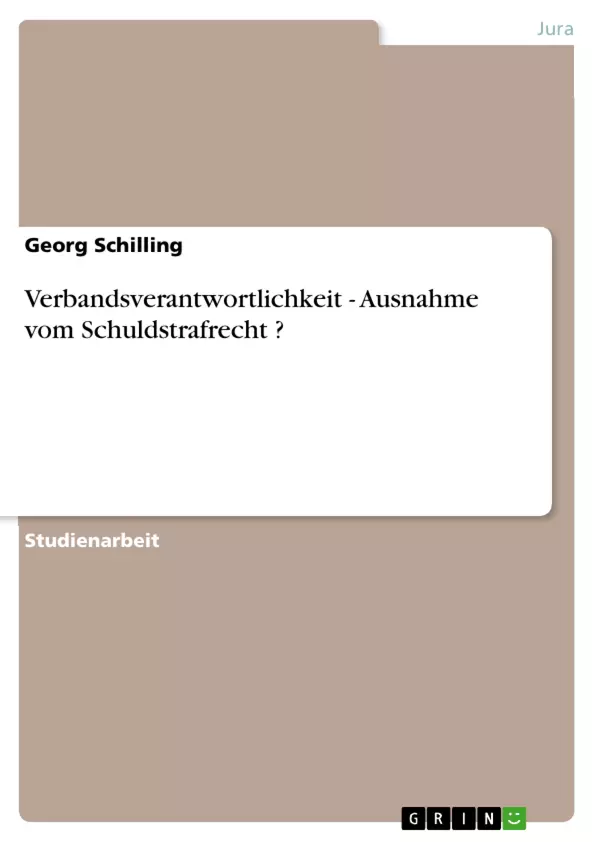- Praxisbezogen klärt diese Arbeit ua iZm "Tauerntunnelunfall"-, "Kaprun-",
"WU-Brand-", "BAWAG-Prozess", "Parmalat", "ENRON" rechtsvergleichend (insbes zw Ö und Dtl) die Frage, wie "nulla poena sine lege" vs "societas delinquere potest" auch in theoria et in praxi zu verstehen ist.
- Es wird rechtsvergleichend vorgegangen, etliche Termini werden auf Herz und Nieren untersucht.
- Als ein zentrales Fundament hierzu dient die Arbeit Heines (1995).
- Zahlreiche Behauptungen Heines werden generell einer sachlich-kritischen Prüfung unterzogen.
- Fernerhin werden zahlreiche (ö; dt) Fehlbehauptungen (Pilz; Boller; Tipold im WK; Heine; Marlies; Kienapfel/Höpfel; Zeder; Seiler; Meyer/Badelt; Haberer et al) sachlich widerlegt, Lücken aufgedeckt, zT Inkonsistenzen sachlich aufgezeigt.
- Die zentrale Figur des sog "Schuldstrafrechts" als sog "Eckpfeiler" des geltenden (dt; ö) Strafrechts (korrekt, mittlerweile: Kriminalrechts) wird sachlich und fachlich als hinterfragenswert näherer Analyse und Reflexion unterzogen.
- Auch die Substanzlosigkeit der sog "mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit" (!) im Kontext der sog Unterlassungshaftung wird in diesem Kontext wird praxisbezogen dargelegt.
- Überdies wird eine betriebswirtschaftliche Verortung (Stichwort sog "Corporate Governance", sog "Risk Management", sog "Krisenmanagement", sog "Katastrophenmanagement") vorgenommen.
- Weiters wird eine volkswirtschaftliche Komponente in diesem Kontext anskizziert (Stichwort "Post-Democracy", "CSR").
- Insgesamt wird auch akurat die Verzahnung zwischen Philosophie, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Soziologie in diesem Kontext aufgezeigt.
- Insgesamt wird in hohem Maße auf Praxisbezug und Interdependenzens sub titulo "vernetztes Denken" (wo angebracht) wert gelegt und die Bedeutung des dogmatischen Rechtsdenkens in einem sachlich-konstruktiven Metadiskurs einer akuraten Analyse poly-zentrischer Denklogik(en) unterzogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Zum Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen und Grundprobleme
- 2.1 Zentrale Problembereiche des Strafrechts beim Umweltschutz
- 2.1.1 „Konventionelles“ Modell: Täter als beherrschende „Zentralfigur“
- 2.1.2 Prinzip der Eigenverantwortung als HEINES „Leitmotiv“
- 2.1.3 Vorab: zur Unterscheidung von Individualtäter-Systemtäter
- 2.2 Frage nach dem Begriff „Organisation“
- 2.2.1 HEIMERL/MEYER in BADELT zur „Organisation“
- 2.2.2 Arbeitsteilung als Grundproblem zufolge HEINE
- 2.2.3 Einschränkung von unmittelbarer Täterschaft und Mittäterschaft?
- 2.2.4 „Schwierigkeiten“ bei Sonderdelikten zufolge HEINE
- 2.2.5 Klare Betriebsstrukturen und Kettenanstiftung
- 2.2.6 Verantwortungsvervielfachung oder -einschränkung?
- 2.2.7 Umweltschutz und atypische Zurechnungs- und Zielstrukturen
- 2.2.8 Rechtliche Steuerungsprobleme bei Handeln in Organisationen
- 3 Haftung von Individualpersonen
- 3.1 Möglichkeiten und Grenzen strafrechtlicher Kriminalität in Verbänden: Haftung von Leitungsorganen und Vertretern im Kernbereich des Strafrechts
- 3.2 Täterschaft und aktives Handeln
- 3.2.1 HEINES Blick für Deutschland
- 3.2.2 Österreichisches Täterschafts-Verständnis
- 3.3 Haftung des „Geschäftsherrn“ durch Unterlassen
- 3.3.1 HEINES Fragestellung
- 3.4 „Quasi-Kausalität“ Wahrscheinlichkeit der Nichtverwirklichung komplexer Großrisiken?
- 3.4.1 Zur so genannten „Quasi-Kausalität“ – (Fehl-)Behauptungen
- 3.5 Rechtsfortbildung im Kernstrafrecht? – Entwicklung in „repressiven“ Nebensystemen
- 3.5.1 Generelle Bedenken zum „Kern“-Strafrecht betreffend HEINE
- 3.5.2 Der „Begriff des „Nebenstrafrechts“ nach HEINE; ferner KERT
- 3.6 Zum Begriff der Rechtsfortbildung
- 4 Zum Begriff der so genannten „Schuld“
- 4.1 Zur „Schuld“ im Sinne von Strafbegründungsschuld
- 4.1.1 HEINES Blick aus Deutschland
- 4.1.2 HEINES „Lebensführungsschuld“ - Analogon für Verbände?
- 4.2 Österreichische Denklogik
- 4.2.1 Der so genannte „Schuldgrundsatz“- FUCHS, TIPOLD, EBRV 1971
- 4.2.2 Der „Schuldgrundsatz“ in Relation zur Verbandsverantwortlichkeit
- 4.3 Zum Begriff des „Schuldstrafrechts“ in Deutschland
- 4.3.1 MARLIES Worte und die jene von OSTENDORF
- 4.3.2 Nexus vom „Schuldstrafrecht“ zum „Kernstrafrecht“?
- 5 Verbandshaftung
- 5.1 Einführung:
- 5.2 Zur Ausgangslage in Deutschland
- 6 Positionsbestimmung de lege lata
- 6.1 Die (Kriminalisierungs-)Lage in Österreich
- 6.1.1 Internationale Vorgaben für Österreich – „Normzweck“
- 6.1.2 Gegenwärtige Rechtslage in Österreich nach dem öVbVG
- 6.1.3 Zu den Verbandssanktionen, auch aus rechtspolitischer Sicht
- 6.2 Zusammenfassung und skeptisch-ambivalenter Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Verbandsverantwortlichkeit, insbesondere im Kontext des österreichischen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (öVbVG). Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, Probleme und Herausforderungen im Bereich der strafrechtlichen Haftung von Organisationen zu untersuchen.
- Strafrechtliche Haftung von Organisationen
- Der Begriff der Schuld im Zusammenhang mit der Verbandsverantwortlichkeit
- Rechtsvergleichende Aspekte (Deutschland und Österreich)
- Herausforderungen des Umweltschutzes im Kontext der Verbandsverantwortlichkeit
- Rechtsfortbildung im Strafrecht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Verbandsverantwortlichkeit ein und skizziert den weiteren Verlauf der Untersuchung. Es wird die Komplexität des Themas herausgestellt und der Fokus auf die Analyse des öVbVG gelegt. Der interdisziplinäre Ansatz der Arbeit, der rechtshistorische, dogmatische, politikwissenschaftliche und soziologische Aspekte umfasst, wird ebenfalls vorgestellt.
2 Grundlagen und Grundprobleme: Dieses Kapitel beleuchtet zentrale Problemfelder des Strafrechts im Umweltschutz und die Schwierigkeiten bei der Anwendung des „konventionellen“ Tätermodells auf Organisationen. Es diskutiert das Prinzip der Eigenverantwortung und die Herausforderungen, die sich aus der Arbeitsteilung in Organisationen ergeben. Die Definition des Begriffs „Organisation“ und die Einschränkungen bei unmittelbarer Täterschaft und Mittäterschaft werden kritisch analysiert. Der Fokus liegt auf den spezifischen Herausforderungen, die sich im Kontext des Umweltschutzes und atypischer Zurechnungs- und Zielstrukturen ergeben.
3 Haftung von Individualpersonen: Dieses Kapitel analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der strafrechtlichen Haftung von Leitungsorganen und Vertretern in Organisationen. Es wird der Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Täterschaftsverständnis beleuchtet, und die Haftung des „Geschäftsherrn“ durch Unterlassen wird diskutiert. Die Konzepte der „Quasi-Kausalität“ und die Rechtsfortbildung im Kernstrafrecht werden kritisch untersucht. Der Abschnitt beleuchtet die Debatte um den Begriff des „Nebenstrafrechts“ und dessen Relevanz für die Verbandsverantwortlichkeit.
4 Zum Begriff der so genannten „Schuld“: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der „Schuld“ im Kontext der Strafbegründung und im Verhältnis zur Verbandsverantwortlichkeit. Es vergleicht deutsche und österreichische Denkmodelle und diskutiert den „Schuldgrundsatz“ in Bezug auf die Haftung von Organisationen. Die Kapitel untersuchen die Verbindung zwischen dem „Schuldstrafrecht“ und dem „Kernstrafrecht“ und analysiert unterschiedliche juristische Positionen zu diesem Thema.
5 Verbandshaftung: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik der Verbandshaftung und beleuchtet die Ausgangslage in Deutschland. Es bildet die Brücke zum folgenden Kapitel, das die Rechtslage in Österreich detailliert analysiert.
6 Positionsbestimmung de lege lata: In diesem Kapitel wird die Rechtslage zur Verbandsverantwortlichkeit in Österreich im Detail analysiert. Internationale Vorgaben und die aktuelle Rechtslage nach dem öVbVG werden beleuchtet, ebenso wie die Verbandssanktionen aus rechtspolitischer Sicht. Es findet eine kritische Auseinandersetzung mit der derzeitigen Situation statt, die in einem skeptisch-ambivalenten Ausblick mündet.
Schlüsselwörter
Verbandsverantwortlichkeit, öVbVG, Strafrecht, Umweltschutz, Organisation, Schuld, Haftung, Rechtsvergleichung, Deutschland, Österreich, Rechtsfortbildung, Kernstrafrecht, Nebenstrafrecht, Eigenverantwortung, Täterschaft, Quasi-Kausalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verbandsverantwortlichkeit im Umweltschutz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Verbandsverantwortlichkeit, insbesondere im Kontext des österreichischen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (öVbVG). Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen, Probleme und Herausforderungen der strafrechtlichen Haftung von Organisationen, insbesondere im Umweltschutz.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die strafrechtliche Haftung von Organisationen, den Begriff der Schuld im Zusammenhang mit der Verbandsverantwortlichkeit, rechtsvergleichende Aspekte (Deutschland und Österreich), Herausforderungen des Umweltschutzes im Kontext der Verbandsverantwortlichkeit und die Rechtsfortbildung im Strafrecht. Sie befasst sich mit der Definition von "Organisation", der Problematik der Arbeitsteilung, der Haftung von Leitungsorganen und Vertretern, dem Unterlassen, der Quasi-Kausalität und dem Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Täterschaftsverständnis. Der Begriff des "Schuldstrafrechts" und seine Verbindung zum "Kernstrafrecht" wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rechtsordnungen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche und das österreichische Rechtssystem im Hinblick auf die Verbandsverantwortlichkeit. Es wird der Unterschied im Täterschaftsverständnis und im Umgang mit dem Begriff der "Schuld" herausgearbeitet.
Welche Rolle spielt der Umweltschutz?
Der Umweltschutz bildet einen wichtigen Kontext der Arbeit. Die spezifischen Herausforderungen der Anwendung des Strafrechts auf Organisationen im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere die Schwierigkeiten bei der Zurechnung von Umweltschäden, werden detailliert analysiert.
Was ist der Fokus auf das öVbVG?
Das österreichische Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (öVbVG) steht im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht die aktuelle Rechtslage, internationale Vorgaben und die rechtspolitischen Aspekte der Verbandssanktionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen und Grundprobleme, Haftung von Individualpersonen, Zum Begriff der so genannten „Schuld“, Verbandshaftung und Positionsbestimmung de lege lata. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten der Verbandsverantwortlichkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verbandsverantwortlichkeit, öVbVG, Strafrecht, Umweltschutz, Organisation, Schuld, Haftung, Rechtsvergleichung, Deutschland, Österreich, Rechtsfortbildung, Kernstrafrecht, Nebenstrafrecht, Eigenverantwortung, Täterschaft, Quasi-Kausalität.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der rechtshistorische, dogmatische, politikwissenschaftliche und soziologische Aspekte umfasst.
Wie lautet der Schluss der Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem skeptisch-ambivalenten Ausblick auf die aktuelle Rechtslage der Verbandsverantwortlichkeit in Österreich.
Wo finde ich detailliertere Informationen?
Detailliertere Informationen finden sich im vollständigen Text der Arbeit, inklusive des ausführlichen Inhaltsverzeichnisses und der Kapitelzusammenfassungen.
- Arbeit zitieren
- Mag. Georg Schilling (Autor:in), 2009, Verbandsverantwortlichkeit - Ausnahme vom Schuldstrafrecht ?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125069