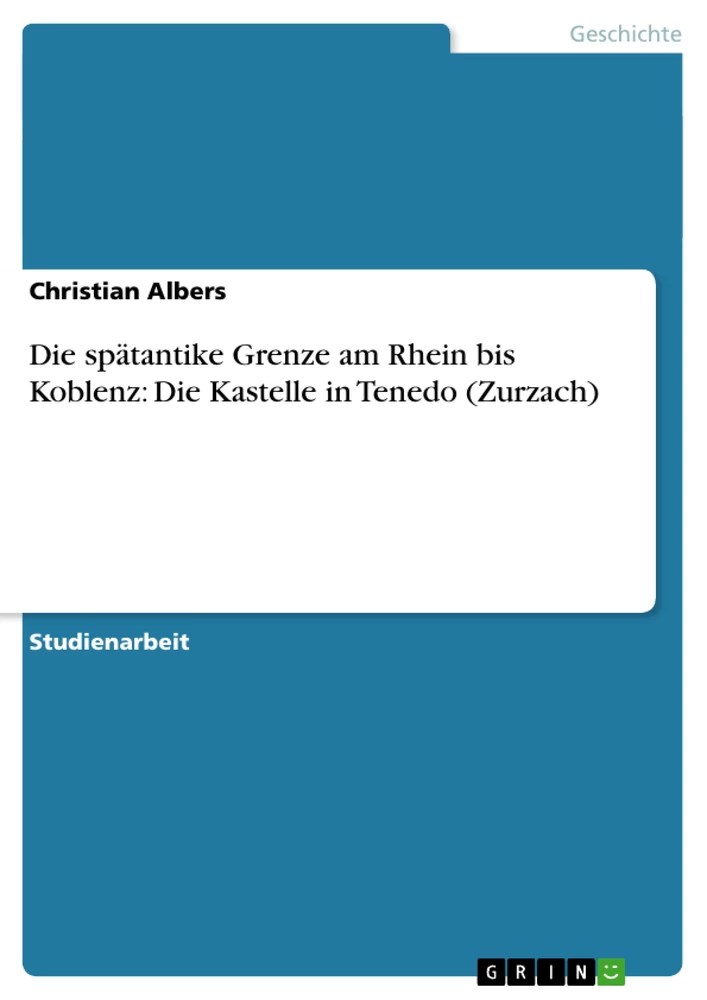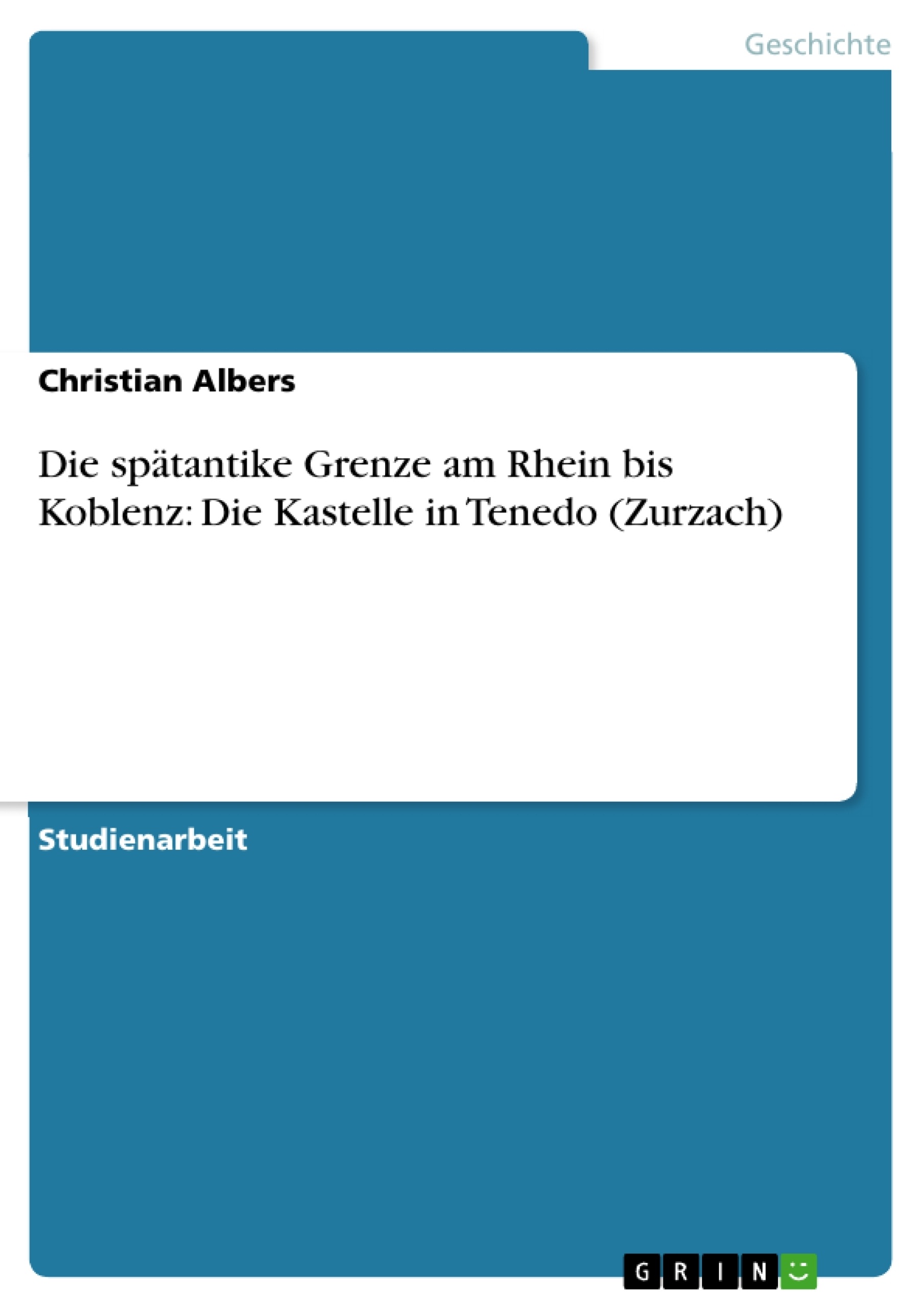Der obergermanisch-rätische Limes ist ein faszinierendes Baudenkmal, das in den ersten Jahrhunderten nach Christi über mehrere hundert Kilometer an der Grenze zum Römischen Reich errichtet wurde. Der Limes war zunächst keine echte Verteidigungsvorrichtung, sondern eine einfache Grenzbefestigung. Zur Verteidigung dieser Grenze wurden Kastelle im Hinterland gebaut, von denen aus Militäreinheiten bei Einfällen auszogen, um den Feind zurückzuschlagen.
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit Tenedo, dem heutigen Zurzach in der Schweiz. An diesem Ort am Rhein bauten die Römer hinter der Limesgrenze zwei Kastelle. Auf der rechten Rheinuferseite, wo heute Rheinheim liegt, errichteten sie einen Brückenkopf. Wie diese Kastelle und der Brückenkopf aufgebaut waren, soll im Mittelpunkt der vorliegenden Hausarbeit stehen. Außerdem werden die bedeutendsten Funde dieser Orte aufgeführt, die zum Teil vor nicht allzu vielen Jahren gemacht wurden.
Aufgrund der Beschränkung einer Hausarbeit auf nur wenige Seiten, werden lediglich die wichtigsten Merkmale dargestellt. Es wird aber trotzdem deutlich, dass die Bauweise der vorliegenden römischen Kastelle mit größter Systematik erfolgte.
Das Fazit weist darauf hin, dass eine Auseinandersetzung mit diesem Thema beim Umgang mit der vorhandenen Literatur nicht so einfach zu handhaben ist.
Zur besseren Orientierung ist im Anhang eine Abbildung beigefügt, in der ein Gesamtplan Tenedos, einschließlich des rechtsufrigen Brückenkopfs, zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Chronologie der Entdeckungen in Tenedo
- 2.1 Das Kastell auf Kirchlibuck
- 2.2 Das Kastell auf Sidelen
- 2.3 Die Umgebung der Kastelle
- 2.4 Die Rheinbrücken
- 2.5 Der rechtsufrige Brückenkopf
- 3 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die römischen Kastelle in Tenedo (heutiges Zurzach) und deren Bedeutung für die spätantike Grenzsicherung am Rhein. Im Fokus steht die Analyse der Bauweise, der Funde und der Chronologie der Ausgrabungen an den beiden Kastellen Kirchlibuck und Sidelen sowie der dazugehörigen Infrastruktur, insbesondere der Rheinbrücken.
- Bauweise und Architektur der Kastelle in Kirchlibuck und Sidelen
- Chronologie der Ausgrabungen und Entdeckungen in Tenedo
- Bedeutung der Funde für die Rekonstruktion der römischen Militärgeschichte
- Funktion der Kastelle im spätantiken Grenzsystem
- Die römischen Rheinbrücken und der rechtsufrige Brückenkopf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den obergermanisch-rätischen Limes und die Bedeutung der Kastelle in Tenedo vor. Kapitel 2 beschreibt die Chronologie der Ausgrabungen in Zurzach, beginnend im späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Es werden die wichtigsten Funde und die Besonderheiten der beiden Kastelle Kirchlibuck und Sidelen detailliert dargestellt, inklusive ihrer Abmessungen, Bauweise und der gefundenen Artefakte. Die Umgebung der Kastelle, insbesondere das Badgebäude, und die Rheinbrücken mit ihren verschiedenen Bauphasen werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Römische Kastelle, Spätantike, Limes, Tenedo, Zurzach, Kirchlibuck, Sidelen, Rheinbrücken, Militärgeschichte, Archäologie, Ausgrabungen, Funde.
Häufig gestellte Fragen
Wo befand sich das antike Tenedo?
Tenedo entspricht dem heutigen Zurzach in der Schweiz, direkt an der Grenze zum damaligen Römischen Reich.
Welche Kastelle werden in der Arbeit untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Kastelle Kirchlibuck und Sidelen sowie den rechtsufrigen Brückenkopf in Rheinheim.
Was war die Funktion des Limes in der Spätantike?
Der Limes diente primär als Grenzbefestigung, während die Kastelle im Hinterland als Stützpunkte für Militäreinheiten zur Verteidigung fungierten.
Welche baulichen Besonderheiten wiesen die Kastelle auf?
Die römischen Kastelle wurden mit größter Systematik errichtet, was sich in präzisen Abmessungen und einer strategischen Infrastruktur wie den Rheinbrücken zeigte.
Gibt es bedeutende archäologische Funde in Zurzach?
Ja, die Arbeit führt wichtige Funde auf, die zur Rekonstruktion der römischen Militärgeschichte und des Alltags (z.B. Badgebäude) beitragen.
- Quote paper
- Christian Albers (Author), 2004, Die spätantike Grenze am Rhein bis Koblenz: Die Kastelle in Tenedo (Zurzach), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125127