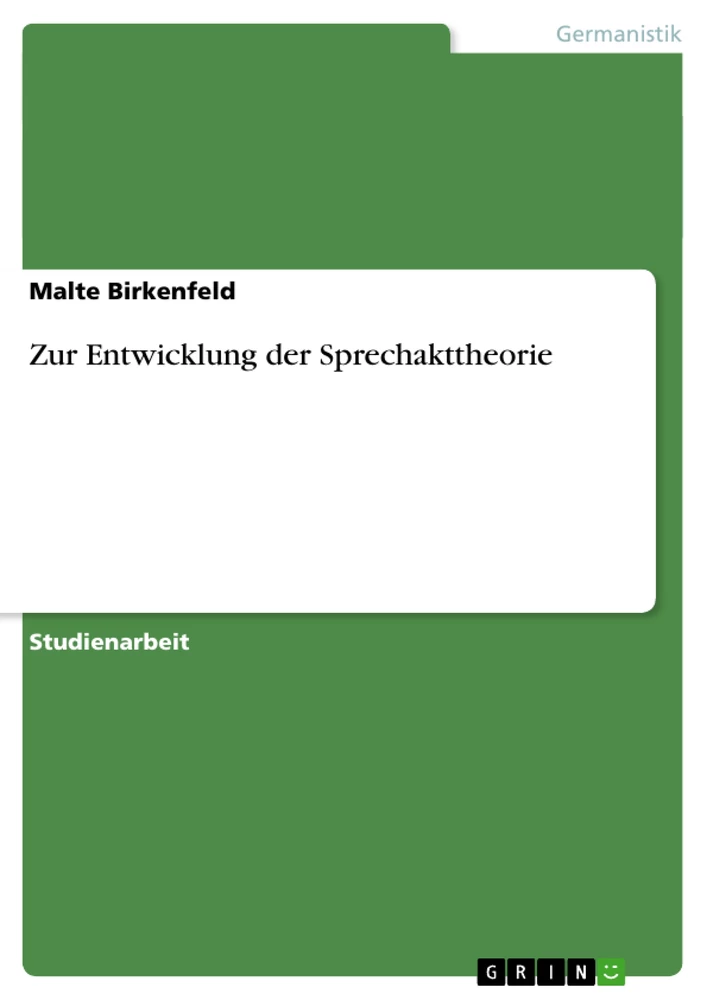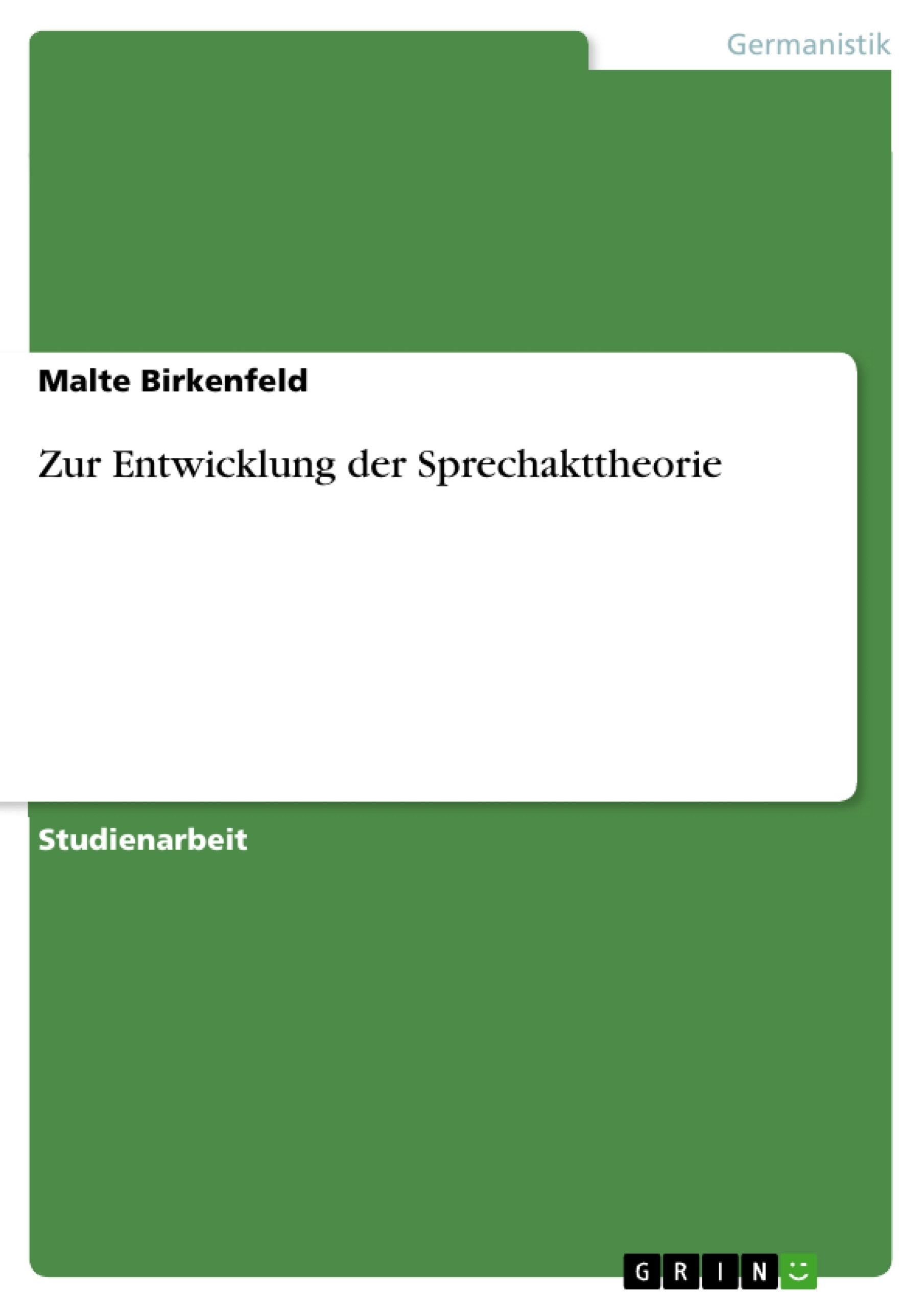Die theoretischen Konzeptionen der Sprachwissenschaft haben sich in den letzten knapp 100 Jahren stetig geändert und weiterentwickelt. Dabei können die Theorien der modernen Linguistik im wesentlichen in folgende Grundpositionen zusammengefasst werden: die Systemlinguistik (inklusive der generativen Grammatik) und die Pragmalinguistik.
Die systematische Linguistik, die bis 1970 vorherrschte, ist durchzogen von einer struktualistischen Betrachtungsweise, mit welcher man die sprachlichen Formen als Sprachsystem mit verschiedenen Teilsystemen interpretierte. Zu ihren entwicklungsrelevanten Stationen seien die Prager Schule (1926), die Kopenhagener Schule (1930) und der Amerikanische Deskriptivismus (bzw. Distributionalismus ab 1951) erwähnt, welche im wesentlichen auf den Ideen Ferdinand de Saussures basieren.
Saussure gliederte (1905) die Sprache in die Trias langue (das Zeichensystem als soziale Erscheinung), parole (die individuelle Anwendung dieses Systems) und language (die allgemeine Sprachfähigkeit) und gilt mit dieser ersten Systematisierung als Begründer der modernen Sprachwissenschaft. Die Vertreter der generativen Linguistik hingegen beschäftigten sich mit der Sprachkompetenz und suchten nach Formulierungen für Regeln, welche die menschliche Fähigkeit zur Produktion immer neuer Sätze ermöglicht.
Seit etwa 1970 verlagerte sich das Interesse von der systemorientierten Linguistik zur kommunikationsorientierten Linguistik. Es wurde erkannt, dass „die sprachlichen Zeichensysteme kein Selbstzweck sind, sondern immer nur Mittel zu außersprachlichen Zwecken“. Dieser neue Aspekt der Funktionen sprachlicher Mittel in der kommunikativen Tätigkeit führte 1970 zur kommunikativ-pragmatischen Wende. Die Pragmalinguistik ging nun der Frage nach, wie der Gebrauch der Sprache durch situative und kommunikative Bedingungen gelenkt wird. Somit stellt die Pragmatik einen selbständigen Bereich der Sprachwissenschaft dar, da sie eine zusätzliche Betrachtungsweise von Sprache ist.
Der Gebrauch der sprachlichen Formen wurde zuerst mit der Sprechakttheorie systematisiert, der innere Zusammenhang zwischen einzelnen sprachlichen Handlungen wurde in ein Ordnungssystem zu bringen versucht.
Die vorliegende Arbeit umreißt die verschiedenen Entwicklungsstufen der Sprechakttheorie, die ihre Ursprünge in der Sprachphilosophie bzw. Logik findet, von John L. Austin zuerst ausgebildet und u.a. von Searle weiterentwickelt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlegungen der Sprachphilosophie
- Zur Theorie der Sprachakte nach Austin
- Weiterentwicklung der Sprechakttheorie durch Searle
- Sprechaktregeln
- Indirekte Sprechakte
- Klassifikation der Sprechakte
- Vergleichende Beobachtungen
- Abschliessende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Sprechakttheorie von ihren philosophischen Ursprüngen bis zu den Weiterentwicklungen durch Searle nachzuzeichnen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der zentralen Konzepte und der Verknüpfung mit sprachphilosophischen Überlegungen.
- Entwicklung der Sprechakttheorie
- Einfluss der Sprachphilosophie auf die Sprechakttheorie
- Konzepte der Sprechaktregeln und indirekter Sprechakte
- Klassifizierung von Sprechakten
- Vergleich verschiedener Ansätze innerhalb der Sprechakttheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Sprachwissenschaft und die Herausbildung der Pragmalinguistik. Der Abschnitt über die Sprachphilosophie beleuchtet die Vorläufer der Sprechakttheorie, insbesondere die Arbeiten von Aristoteles und Wittgenstein, und deren Fokus auf den Handlungscharakter von Sprache. Die Kapitel zu Austin und Searle präsentieren die zentralen Theorien und Konzepte der Sprechakttheorie, einschließlich Sprechaktregeln, indirekter Sprechakte und Klassifizierung von Sprechakten. Der Abschnitt zu den vergleichenden Beobachtungen wird in der Vorschau nicht berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, Sprachphilosophie, Pragmalinguistik, Austin, Searle, Sprechaktregeln, indirekte Sprechakte, Sprachhandlung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Sprechakttheorie?
Eine linguistische Theorie, die Sprache nicht nur als System von Zeichen, sondern als Form des Handelns betrachtet (Sprechen als Handeln).
Wer sind die Begründer der Sprechakttheorie?
Die Theorie wurde maßgeblich von John L. Austin begründet und später von John Searle systematisch weiterentwickelt.
Was ist ein indirekter Sprechakt?
Ein Sprechakt, bei dem die gemeinte Absicht nicht direkt in den Worten liegt (z. B. „Kannst du das Fenster schließen?“ als Bitte statt als Frage nach der Fähigkeit).
Was war die „kommunikativ-pragmatische Wende“?
Ein Umschwung in der Linguistik um 1970, bei dem das Interesse vom starren Sprachsystem hin zum tatsächlichen Gebrauch der Sprache in der Kommunikation rückte.
Was unterscheidet Austin und Searle?
Austin legte den Grundstein mit der Unterscheidung von lokutionären und illokutionären Akten, während Searle feste Regeln und eine präzise Klassifikation (z. B. Assertive, Direktive) einführte.
- Arbeit zitieren
- Malte Birkenfeld (Autor:in), 2001, Zur Entwicklung der Sprechakttheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125144