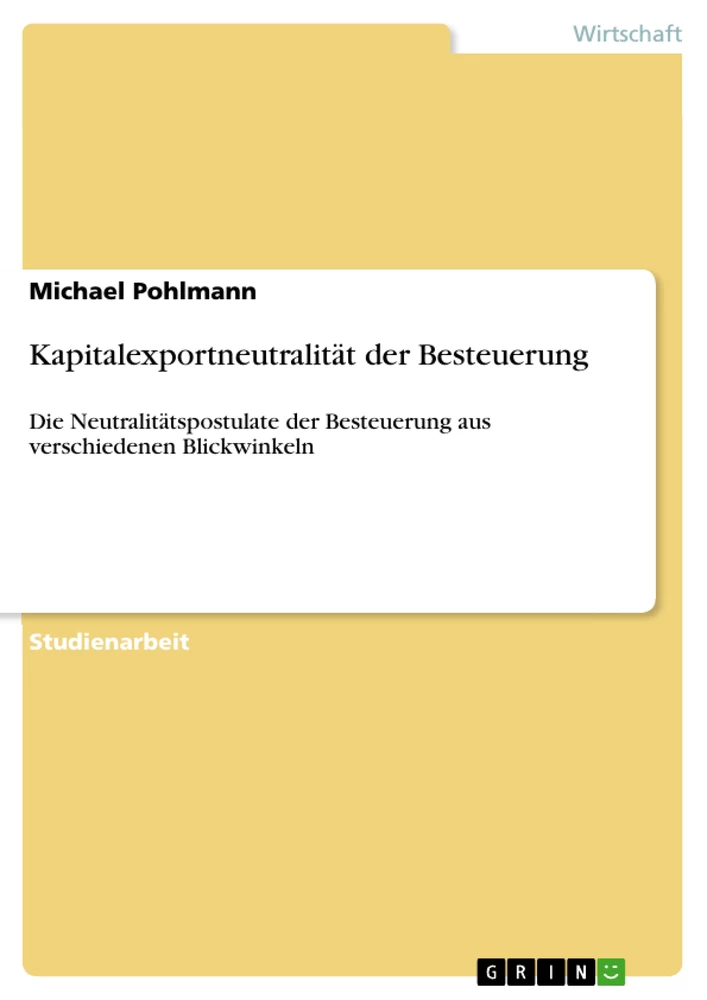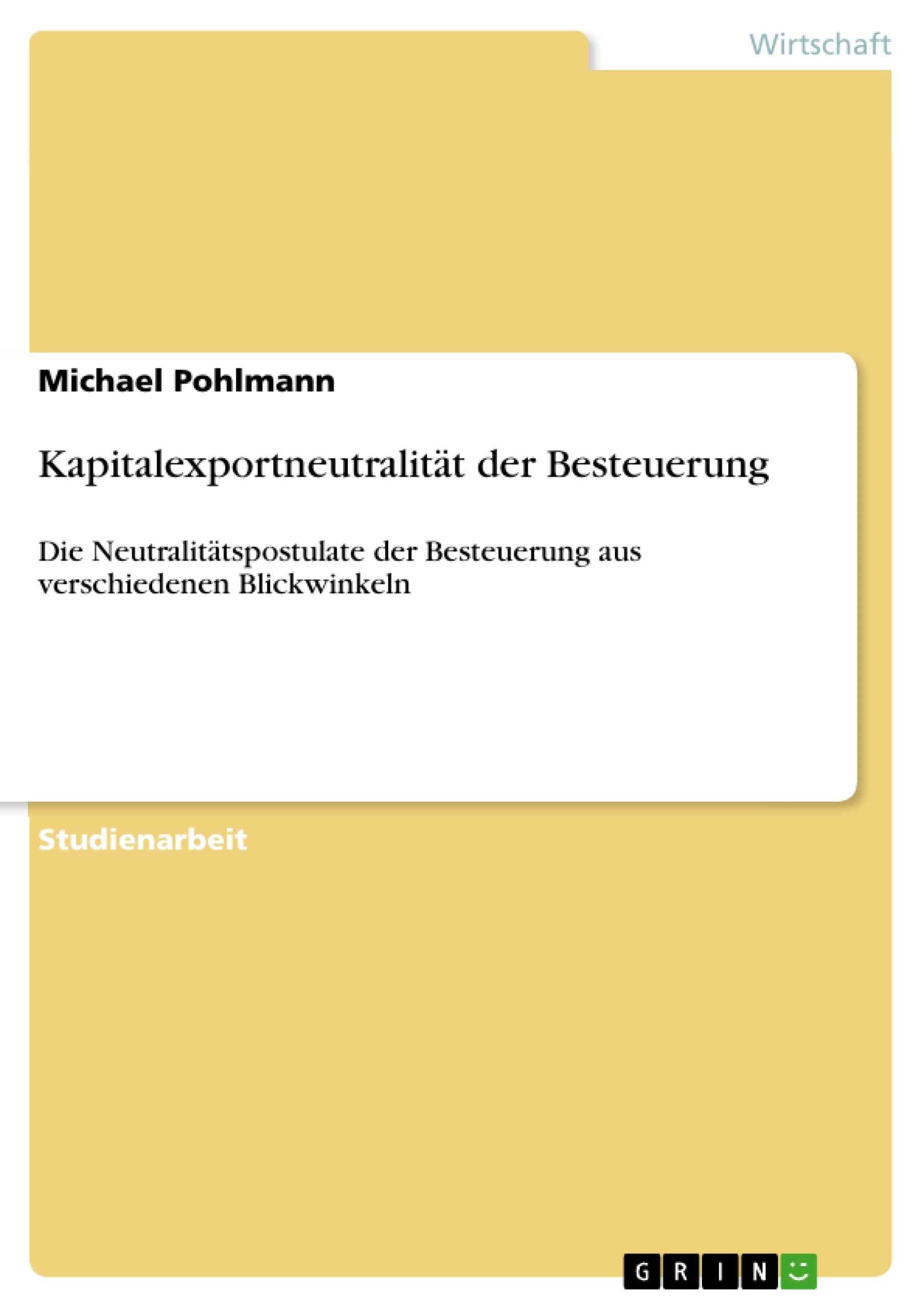Was eigentlich unter Internationalem Steuerrecht zu verstehen ist, welche Begriffsbildung maßgeblich sein soll und ob es ein Internationales Steuerrecht überhaupt gibt, ist umstritten. Einerseits sollen von der Herkunft des Rechts ausgehend ausschließlich völkerrechtliche Normen erfasst werden, andererseits wird der Begriff des Internationalen Steuerrechts auf alle Sachverhalte mit Auslandsbezug ausgedehnt. Letztlich findet sich aber auch die Meinung, dass zum Internationalen Steuerrecht lediglich Kollisionsnormen bzw. Konfliktregeln gehören, also Rechtsnormen, die die Rechtshoheit gegeneinander abgrenzen. Die Forderung nach einer internationalen wettbewerbsneutralen Besteuerung ist schon sehr alt. Selbst die Klassiker wie Adam Smith und David Ricardo verlangten nach einer Besteuerung, die die Leistungsströme nicht beeinflusst. Insbesondere in den letzten Jahren hat der internationale Aspekt der Besteuerung von Unternehmen in der Öffentlichkeit eine Aufmerksamkeitssteigerung erfahren. Dies liegt unter anderem an der stetigen Fortführung der Globalisierung und am internationalen Steuerwettbewerb sowie der Ausweitung der europäischen Integration und die mit diesen Punkten verbundene Meinung der Bevölkerung, dass deutsche Unternehmen immer weniger Steuern zu zahlen haben. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb wird aufgezeigt, inwieweit sich die internationale Besteuerung neutral verhält und wie das Ziel der Kapitalexportneutralität umgesetzt werden kann. Dazu wird in Punkt 3 ein Verfahren dargelegt, nach dem internationale Geschäftsabwicklungen besteuert werden können. Im Vorfeld werden die Begriffe und Grundprinzipen der Neutralität, der Doppelbesteuerung und Minderbesteuerung aufgezeigt und erklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Begriffe und Grundprinzipien der Doppelbesteuerung
- Ursachen für die Entstehung
- Gründe für die Vermeidung
- Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
- Ökonomische Wirkungen
- Neutralitätskonzepte der internationalen Besteuerung
- Arten der Neutralität der Besteuerung
- Kapitalexportneutralität
- Begriffserklärung
- Leistungsfähigkeitsprinzip
- Vor- und Nachteile der Kapitalexportneutralität
- Anrechnungsmethode gemäß § 34 c EStG und § 26 KStG zur Umsetzung der Kapitalexportneutralität:
- Nachholeffekt der Anrechnungsmethode:
- Kritische Würdigung der Exportneutralität als Leitlinie der Besteuerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Neutralitätspostulate der Besteuerung, insbesondere die Kapitalexportneutralität. Sie analysiert die Konzepte der Doppelbesteuerung und Minderbesteuerung, legt verschiedene Vermeidungsmethoden dar und bewertet kritisch die Anwendbarkeit der Kapitalexportneutralität als Leitlinie der Besteuerung.
- Doppelbesteuerung und ihre Vermeidung
- Konzepte der internationalen Steuerneutralität
- Kapitalexportneutralität: Definition und Umsetzung
- Vor- und Nachteile der Kapitalexportneutralität
- Kritische Bewertung der Kapitalexportneutralität als Steuerleitlinie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema der internationalen Besteuerung und die Problematik der Begriffsbestimmung des Internationalen Steuerrechts. Kapitel zwei definiert die Doppelbesteuerung, untersucht ihre Ursachen und beleuchtet Methoden zu ihrer Vermeidung. Kapitel drei beschreibt verschiedene Neutralitätskonzepte der internationalen Besteuerung, mit besonderem Fokus auf die Kapitalexportneutralität, inklusive einer detaillierten Erläuterung der Anrechnungsmethode nach § 34c EStG und § 26 KStG. Kapitel vier widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Exportneutralität als Steuerleitlinie.
Schlüsselwörter
Internationale Besteuerung, Doppelbesteuerung, Minderbesteuerung, Kapitalexportneutralität, Anrechnungsmethode, § 34c EStG, § 26 KStG, Steuerneutralität, Leistungsfähigkeitsprinzip, OECD-Musterabkommen, Steuerwettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Kapitalexportneutralität?
Ein steuerliches Konzept, bei dem Investitionsentscheidungen unabhängig davon getroffen werden sollen, ob das Kapital im In- oder Ausland investiert wird.
Wie wird Doppelbesteuerung vermieden?
Häufig genutzte Methoden sind die Anrechnungsmethode (gemäß § 34c EStG) und die Freistellungsmethode im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen.
Was ist das Leistungsfähigkeitsprinzip?
Ein Grundprinzip der Besteuerung, nach dem jeder Steuerpflichtige entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung des Staates beitragen soll.
Welche Rolle spielt der internationale Steuerwettbewerb?
Er führt dazu, dass Staaten versuchen, durch niedrige Steuersätze Unternehmen anzulocken, was die Forderung nach wettbewerbsneutraler Besteuerung verstärkt.
Was ist der „Nachholeffekt“ der Anrechnungsmethode?
Ein Effekt, bei dem die im Ausland gezahlte niedrigere Steuer durch eine Nachzahlung im Inland auf das heimische Steuerniveau angehoben wird.
- Citar trabajo
- Michael Pohlmann (Autor), 2008, Kapitalexportneutralität der Besteuerung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125170