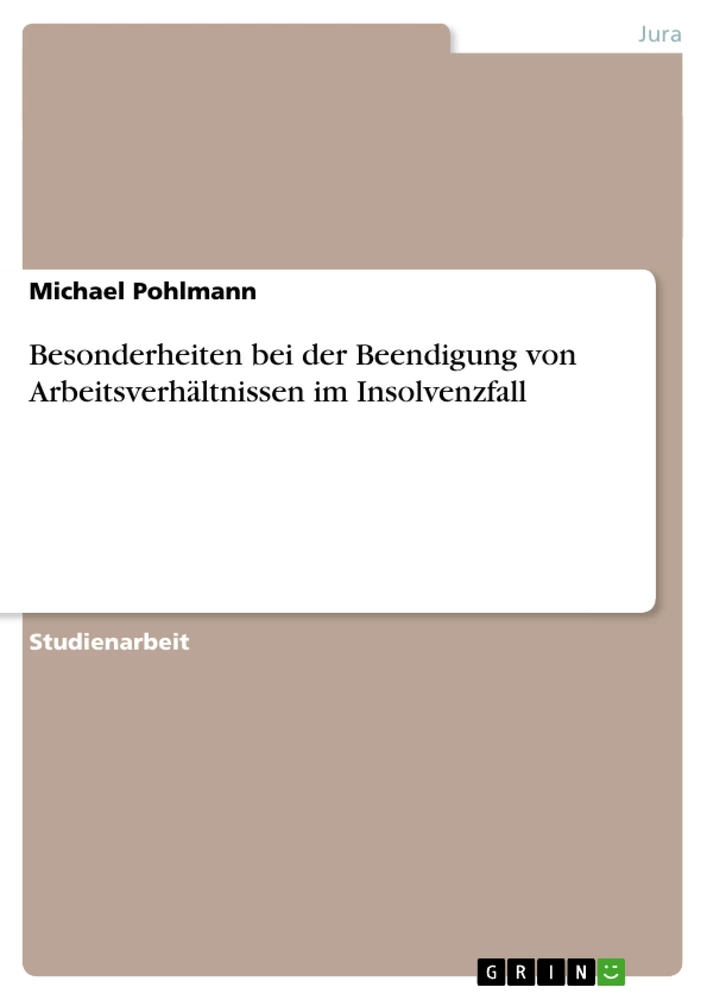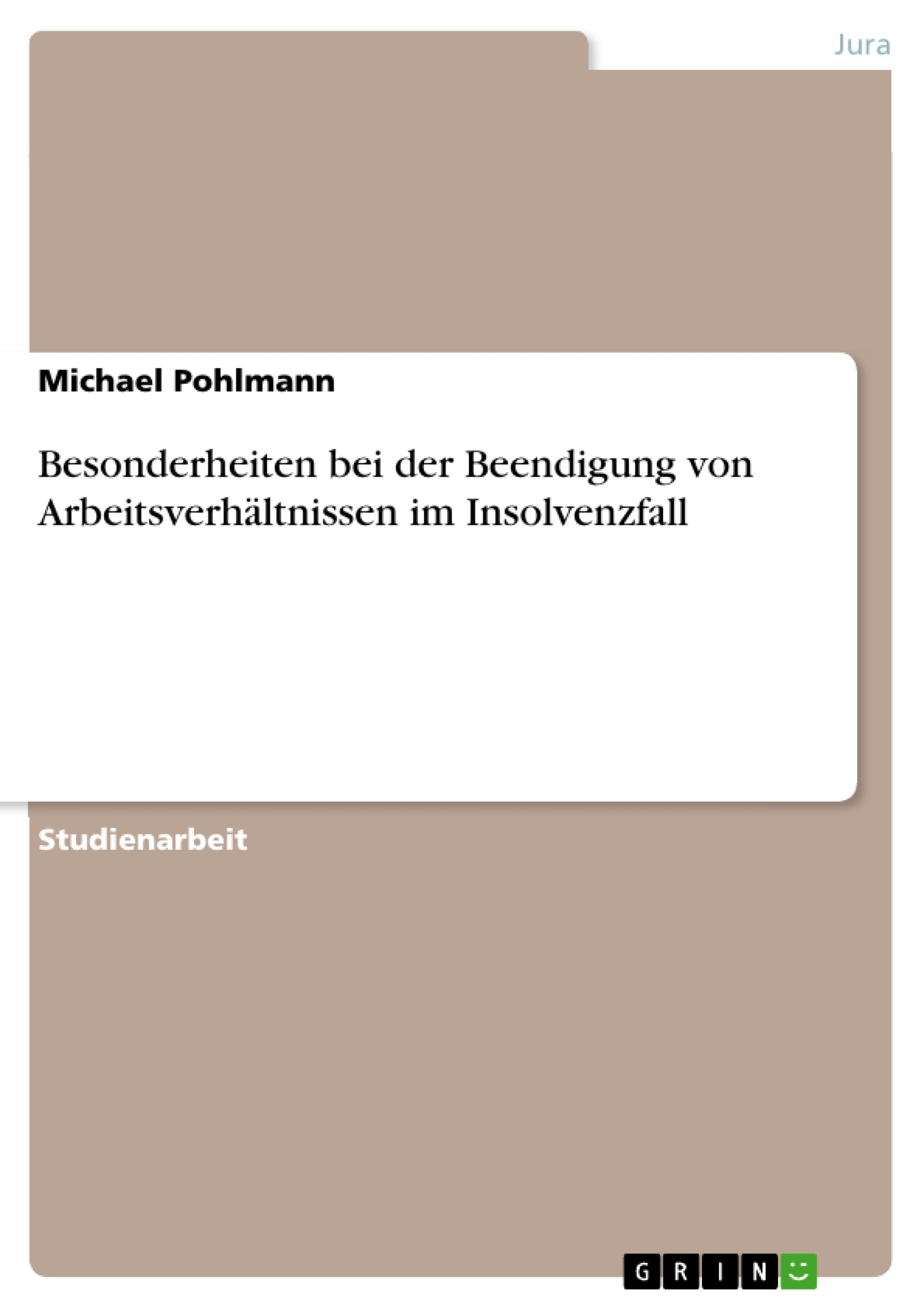Nach § 1 Satz 1 InsO dient das Insolvenzverfahren dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Ver-mögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens getroffen wird.
Insolvenzen sind die Folgen von offenkundigen krisenhaften Entwick-lungen, welche insbesondere durch wirtschaftliche Schwierigkeiten ent-stehen. Ein stetiger Begleiter dieser Misswirtschaft sind die Kündigungen von Arbeitsverhältnissen. Bei der Insolvenz eines Unternehmens sind in der Regel neben finanziellen, betriebswirtschaftlichen oder geschäftspolitischen Maßnahmen auch Entscheidungen erforderlich, die die Belegschaft des Unternehmens betreffen. Diese Personalfreisetzungen werden auch dann als gängig angesehen, wenn an Stelle einer Liquidation des Unternehmens eine Sanierung durch Unternehmensreorganisation erfolgen soll.
Bei der Liquidation oder der Sanierung kann es notwendig sein, durch anzeige- und interessenausgleichspflichtige Massenentlassungen gemäß §§ 17 ff. KSchG oder sozialplanpflichtigen Personalabbau gemäß § 112 Abs. 1 BetrVG Arbeitsplätze einzusparen.
Will man die insolvenzbedingte Arbeitslosigkeit messen, so stehen dafür kaum verlässliche Angaben zur Verfügung. Eine Statistik zur Schaffung eines bundeseinheitlichen amtlichen Vergleichsmaßstabs besteht nicht. So variiert die Schätzung über insolvenzbedingte Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark.
Im Folgenden werden die insolvenzrechtlichen Besonderheiten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen aufgezeigt, um so einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben.
Gliederung
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
A. Bedeutung des Insolvenzrechts im Arbeitsrecht
B. Regelungsbereich des § 113 InsO
I. Gesetzliches Kündigungsrecht
II. Kündigungsfrist
1.Gesetzliche Kündigungsfrist
2. Nachkündigung
III. Schadenersatz
IV. Kündigungsberechtigung
1. Vorläufiger Insolvenzverwalter
2. Insolvenzverwalter
C. Kündigungsschutzklage
I. Klagefrist
II. Nachträgliche Zulassung
D. Stellung des Betriebsrats im Insolvenzfall
I. Beteiligung bei Kündigungen
II. Besonderheiten bei der Kündigung von Betriebsratsmitgliedern
E. Interessenausgleich und Kündigungsschutz
I. Allgemeines
II. Vermutung dringender betrieblicher Erfordernisse
III. Voraussetzungen
F. Das Beschlussverfahren nach § 126 InsO
I. Allgemeines
II. Antragsinhalt und Antragsfrist
III. Verfahrensgegenstand und Verfahrensgrundsätze
G. Sozialplan in der Insolvenz
I. Sozialplan nach der Eröffnung der Insolvenz
II. Sozialplan vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
H. Betriebsübergang in der Insolvenz
I. Grundsätze der Anwendbarkeit des § 613a BGB
II. Überlagerung der allgemeinen Grundsätze durch § 128 InsO
III. Auswirkungen des Sammelverfahrens beim Betriebsübergang
IV. Kündigung durch den Insolvenzverwalter
I. Massenentlassungen
J. Insolvenzgeld
K. Fazit
Literaturverzeichnis
- BAG vom 31.07.2002, Sozialplan vor Insolvenzeröffnung, NZA 23/2002, Seite 1332 – 1334
- Berscheid, Ernst-Dieter, Nachkündigung des endgültigen Insolvenzverwalters, www.juris.de/jportal/t/1kx5/page/juriw.psml?pid=Dokumentenanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=9&formdoctodoc=yes&doc.id=jpr-NLAR00000750&doc.part=S&doc.price=0,0#focuspoint, 16.05.2008
- Braun, Eberhard, Insolvenzordnung, 3. Auflage, München 2007,
Beck Verlag,
- Bundesagentur für Arbeit, Merkblatt 10, Insolvenzgeld für Arbeitnehmer, Januar 2008
- Dieterich, Thomas, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 8 Auflage München 2008, Beck Verlag
- Düwell, Franz-Josef, Kölner Schrift zur Insolvenzordnung,
2. Auflage, Herne/Berlin 2000, Verlag für die Rechts und Anwaltspraxis
- Felser, Michael, Arbeitsentgelt in der Insolvenz, Arbeitsrecht im Betrieb 7/2004, Seite 427 - 431
- Foerste, Ulrich, Insolvenzrecht, 3. Auflage, München 2008,
Beck Verlag
- Henssler, Martin, Willemsen, Heinz, Kalb, Heinz-Jürgen, Arbeitsrecht Kommentar, 2. Auflage, Köln 2006, Verlag Dr. Otto Schmidt
- Henssen, Ralf, Ordentliche Unkündbarkeit und § 113 Satz 3 InsO, www.juris.de/jportal/t/1kn8/page/juriw.psml?pid=Dokumentenanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=jpr-NLAR000027707&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint, 16.05.2008
- Kuprat, Tino, Der Betriebsübergang nach§ 613a BGB und der Anspruch auf Schadensersatz nach § 826 BGB im Zusammenhang mit dem Anspruchsübergang nach § 187
SGB III, 2005, Seite 10-21 (10-11)
- Ries, Stephan, Der Insolvenzverwalter – „Arbeitgeber“ oder nur „Organ der (Insolvenz-) Rechtspflege“?, ZIsnO 2007,
Seite 414 - 420
- Richardi, Reinhard, Wlotzke, Otfried, Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Band 2, 2. Auflage, München 2000, Beck Verlag
- HaersgtjaghnHfnakjfnhoapfj Schaub, Günter, Arbeitsrechtshandbuch, 12. Auflage, Ort 2007, Beck Verlag,
- Stahlhacke, Eugen, Preis, Ulrich, Vossen, Reinhard, Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis, 8. Auflage, München
- Wolf, Betram, Die maßgebliche Kündigungsfrist in der Insolvenz, Der Syndikus, Seite 39 – 40
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Bedeutung des Insolvenzrechts im Arbeitsrecht
Nach § 1 Satz 1 InsO dient das Insolvenzverfahren dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Ver-mögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem In-solvenzplan eine abweichende Regelung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens getroffen wird.
Insolvenzen sind die Folgen von offenkundigen krisenhaften Entwick-lungen, welche insbesondere durch wirtschaftliche Schwierigkeiten ent-stehen. Ein stetiger Begleiter dieser Misswirtschaft sind die Kündi-gungen von Arbeitsverhältnissen. Bei der Insolvenz eines Unter-nehmens sind in der Regel neben finanziellen, betriebswirtschaftlichen oder geschäftspolitischen Maßnahmen auch Entscheidungen erforder-lich, die die Belegschaft des Unternehmens betreffen. Diese Personal-freisetzungen werden auch dann als gängig angesehen, wenn an Stelle einer Liquidation des Unternehmens eine Sanierung durch Unter-nehmensreorganisation erfolgen soll.
Bei der Liquidation oder der Sanierung kann es notwendig sein, durch anzeige- und interessenausgleichspflichtige Massenentlassungen gemäß §§ 17 ff. KSchG oder sozialplanpflichtigen Personalabbau gemäß § 112 Abs. 1 BetrVG Arbeitsplätze einzusparen.
Will man die insolvenzbedingte Arbeitslosigkeit messen, so stehen dafür kaum verlässliche Angaben zur Verfügung. Eine Statistik zur Schaffung eines bundeseinheitlichen amtlichen Vergleichsmaßstabs besteht nicht. So variiert die Schätzung über insolvenzbedingte Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark.
Im Folgenden werden die insolvenzrechtlichen Besonderheiten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen aufgezeigt, um so einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben.
B. Regelungsbereich des § 113 InsO
I. Gesetzliches Kündigungsrecht
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat keinen Einfluss auf den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Das ist nicht ausdrücklich gesetzlich klargestellt, ergibt sich aber aus dem Gesamt-zusammenhang. § 108 Abs.1 InsO stellt das Fortbestehen der vom Schuldner eingegangenen Dauerschuldverhältnisse fest. Deshalb sind trotz Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers die Arbeitnehmer verpflichtet, weiterhin die vertraglich geschuldete Arbeit zu leisten. Der Insolvenzverwalter übernimmt mit seiner Bestellung kraft Amtes den gesamten Pflichtenkreis des Arbeitgebers[1].
Der Regelbereich des § 113 InsO erleichtert allerdings sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Insolvenzverwalter das Dienstverhältnis ohne Rücksicht auf die in der Vergangenheit getroffenen Vereinbarungen und Tarifnormen zum Ausschluss des Rechts auf ordentliche Kündigung zu beenden[2]. Daraus ergibt sich, dass insbesondere Arbeitsverhältnisse von befristeten und Langzeit-beschäftigten von der Regelung des §113 Abs.1 InsO betroffen sind. Denn der Zweck des Gesetzes liegt u.a. darin, eine ausgewogene Personalstruktur zu schaffen und dies ist mit der Unkündbarkeit von Dienstverhältnissen nicht zu ermöglichen[3]. Betroffen sind alle Arten von Dienstverhältnissen gemäß § 611 Abs. 1 BGB. Dazu gehören auch Dienstverhältnisse mit Mitgliedern der Organe juristischer Personen, bspw. der Geschäftsführer einer GmbH. Allerdings ist zwischen der Organstellung und dem Angestelltenverhältnis zu unterscheiden[4]. Die Kündigung durch den Insolvenzverwalter beendet nur das Dienstverhältnis und nicht das Organverhältnis[5].
II. Kündigungsfrist
1.Gesetzliche Kündigungsfrist
Die unter Punkt I. aufgeführten Möglichkeiten zum Ausschluss der ordentlichen Kündigung im Insolvenzverfahren werden durch die Einführung einer gesetzlichen Kündigungsfrist von drei Monaten mit dem Kündigungstermin zum Monatsende hin vereinfacht[6]. In Umkehr-schluss bedeutet dies natürlich nicht, dass kürzere Kündigungsfristen verlängert werden, diese bleiben unberührt und werden durch die Regelung des § 113 Satz 2 InsO ersetzt. Diese gesetzliche Regelung geht als lex specialis anderen längeren Regelungen vor, ebenso wie möglichen Kündigungsfristen in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen[7]. Es handelt sich hierbei also nicht um eine Regelfrist, sondern um eine Höchstfrist, so dass jede kürzere Kündigungsfrist Vorrang hat. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es sich nicht um eine außerordentliche Kündigung mit Auslauffrist handelt, sondern um eine ordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses[8].
§ 113 InsO beinhaltet keinen Kündigungsgrund[9], was die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes während des Insolvenzverfahrens zur Folge hat. Dies liegt daran, dass die Insolvenz an sich keinen eigen-ständigen Grund für eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung bildet[10].
2. Nachkündigung
Wurde der Arbeitnehmer bereits vor Eintritt der Insolvenz gekündigt und ist die bestehende Restkündigungsfrist länger als die gesetzliche Kündigungsfrist von drei Monaten, so hat der Insolvenzverwalter die Möglichkeit zur Nachkündigung im Sinne des § 113 Satz 2 InsO.
Da bei der Nachkündigung ein anderer Beurteilungszeitpunkt gegen-über der früheren Kündigung vorliegt, sind die Merkmale einer unzu-lässigen Wiederholungskündigung, welche vorliegt, wenn sich zwei Kündigungen auf denselben Kündigungsgrund stützen[11], nicht erfüllt und die restliche Kündigungsfrist erfolgreich verkürzt[12].
III. Schadenersatz
Kündigt der Insolvenzverwalter unter Anwendung der dreimonatigen Kündigungsfrist das Dienstverhältnis vorzeitig, kann der Dienst-verpflichtete Schadenersatz nach § 113 Abs. 1 Satz 3 InsO ver-langen[13]. Ein direkter Anspruch auf Entschädigung aufgrund des Verlustes des Arbeitsplatzes ist dadurch nicht begründet, sondern es ist der „Verführungsschaden“[14] zu ersetzten. Dies ist der Schaden, der durch die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses entstanden ist[15]. Nach Auffassung des BAG ergibt sich die Auslegung von § 113 Satz 3 InsO, dass der Schadenersatzanspruch bei der Durchbrechung einer vereinbarten Unkündbarkeit auf den Verdienstausfall für den Lauf der längsten ohne Vereinbarung einschlägigen Kündigungsfrist be-schränkt ist[16].
Bei der Berechnung des Schadenersatzes muss sich der Arbeitnehmer dasjenige anrechnen lassen, was er anderweitig erwirbt oder zu erwerben unterlässt (§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB). Die nach dem Abzug dieser Anrechnungspunkte noch offenen Restposten kann der Arbeitnehmer als einfache Insolvenzforderung gemäß § 38 InsO gegen seinen alten Arbeitgeber geltend machen[17].
IV. Kündigungsberechtigung
Im Regelfall wird die Kündigung eines Dienstverhältnisses vom Arbeitgeber ausgesprochen. Im Insolvenzfall kann dies allerdings abweichen, da der Insolvenzverwalter kraft Amtes die Arbeitgeber-funktion[18] übernommen hat. Bei der Kündigungsbefugnis ist allerdings zwischen dem vorläufigen Insolvenzverwalter und den Insolvenz-verwalter zu unterscheiden.
1. Vorläufiger Insolvenzverwalter
Ein vorläufiger Insolvenzverwalter tritt immer dann auf, wenn der Insolvenzantrag schon gestellt wurde, aber vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch das Insolvenzgericht ein Verwalter gemäß
§ 21 Abs. 2 Ziff. 1 InsO bestellt wurde, um insbesondere die vorhandenen Vermögensmassen des Schuldners zu sichern und zu erhalten. Er hat also die Funktion eines Sequesters.
Zu unterscheiden ist zwischen einem vorläufigen Verwalter ohne Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis und einem Verwalter mit Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis. Eine Berechtigung Dienstver-hältnisse zu kündigen hat der vorläufige Insolvenzverwalter nur, wenn ihm das Insolvenzgericht zugleich ein allgemeines Verfügungsgebot nach § 22 Abs. 1 InsO zugeteilt hat. Hierdurch gehen die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse und damit auch das Kündigungsrecht auf den vorläufigen Insolvenzverwalter über. Somit werden durch den vorläufigen Insolvenzverwalter alle Arbeitgeberfunktionen übernom-men, wodurch er zur Prozesspartei kraft Amtes wird. Wird ein solches allgemeines Verfügungsverbot nicht ausgesprochen, verbleibt die Kündigungsbefugnis als Arbeitgeberfunktion beim Schuldner. Dieser wurde in seinen Möglichkeiten allerdings so eingeschränkt, dass er bei Verfügungen die Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters benötigt[19].
2. Insolvenzverwalter
Durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und darüber es zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter über (§ 80 Abs. 1 InsO). Auf den Insolvenzverwalter ist hierdurch die Amtstheorie anzuwenden, wodurch dieser die Rechtsstellung eines Organs zur Durchführung des Insolvenzverfahrens kraft Amtes hat. Er tritt also die Nachfolge des Arbeitgebers an. Dadurch handelt er auf eigenes Recht, auf eigenen Namen. Er ist also nicht nur der gesetzliche Vertreter der insolventen Gesellschaft, sondern ist allen Insolvenz-beteiligten gegenüber verantwortlich[20]. Daher ist er auch berechtigt, Arbeitsverhältnisse zu kündigen, bzw. Änderungsverträge, Sozialpläne oder ähnliche Vereinbarungen mit Arbeitnehmern oder dem Betriebsrat abzuschließen.
[...]
[1] Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Düwell, S. 1440, Rn.: 19
[2] Wolf, Die maßgebliche Kündigungsfrist in der Insolvenz
[3] Kündigung & Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis, Vossen, S. 853, Rn.: 2153
[4] Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Düwell, S. 1442 , Rn.: 24
[5] Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Düwell, S. 1442 , Rn.: 24
[6] BAG, Urteil vom 13.05.2004 EZA § 102 BetrVG, AZ: 329/03
[7] BAG, Urteil vom 16.06.1999 EZA § 113 InsO, AZ: 191/98
[8] Kündigung & Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis, Vossen, S. 854, Rn.: 2155
[9] Arbeitsrechtskommentar, Annuß, S. 2306, Rn.: 1
[10] Kölner Schrift zur Insolvenzordnung, Düwell, S. 1444, Rn.: 29
[11] Berscheid, Nachkündigung des endgültigen Insolvenzverwalters
[12] Kündigung & Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis, Vossen, S. 855, Rn.:2156
[13] Kündigung & Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis, Vossen, S. 856, Rn.:2159
[14] ErfK/ Müller-Gölge, S. 2040 Rn.:31
[15] Insolvenzrecht, Foerste, S.125, Rn.: 251
[16] Henssen,Ordentliche Unkündbarkeit und § 113 Satz 3 InsO
[17] Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, Berkowsky, S. 390, Rn.: 20
[18] Ries, Der Insolvenzverwalter – „Arbeitgeber“ oder nur „Organ der (Insolvenz-) Rechtspflege“?
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Insolvenzverfahren und welche Rolle spielt es im Arbeitsrecht?
Das Insolvenzverfahren dient gemäß § 1 Satz 1 InsO dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung zur Aufrechterhaltung des Unternehmens getroffen wird. Im Arbeitsrecht führt die Insolvenz oft zu Kündigungen und Personalabbau.
Was regelt § 113 InsO?
§ 113 InsO erleichtert sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Insolvenzverwalter die Beendigung des Dienstverhältnisses, unabhängig von früheren Vereinbarungen, die das Recht zur ordentlichen Kündigung ausschließen. Dies betrifft insbesondere Arbeitsverhältnisse von befristeten und Langzeitbeschäftigten, um eine ausgewogene Personalstruktur zu ermöglichen.
Wie lautet die Kündigungsfrist im Insolvenzverfahren nach § 113 InsO?
Die gesetzliche Kündigungsfrist im Insolvenzverfahren beträgt drei Monate zum Monatsende. Kürzere Kündigungsfristen bleiben unberührt und werden durch § 113 Satz 2 InsO ersetzt. Es handelt sich um eine Höchstfrist, wobei jede kürzere Kündigungsfrist Vorrang hat.
Was ist eine Nachkündigung im Insolvenzverfahren?
Wenn der Arbeitnehmer bereits vor der Insolvenz gekündigt wurde und die Restkündigungsfrist länger als drei Monate ist, kann der Insolvenzverwalter die Kündigungsfrist im Sinne des § 113 Satz 2 InsO auf drei Monate verkürzen (Nachkündigung).
Welchen Schadenersatzanspruch hat ein Arbeitnehmer bei vorzeitiger Kündigung durch den Insolvenzverwalter?
Wenn der Insolvenzverwalter das Dienstverhältnis vorzeitig unter Anwendung der dreimonatigen Kündigungsfrist kündigt, kann der Arbeitnehmer Schadenersatz nach § 113 Abs. 1 Satz 3 InsO verlangen. Ersetzt wird der "Verführungsschaden", der durch die vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses entstanden ist, beschränkt auf den Verdienstausfall für den Lauf der längsten ohne Vereinbarung einschlägigen Kündigungsfrist.
Wer ist im Insolvenzfall kündigungsberechtigt?
Grundsätzlich ist der Insolvenzverwalter, nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, kraft Amtes für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen zuständig. Vor der Eröffnung, wenn ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wurde, ist zu unterscheiden. Verfügt dieser über ein allgemeines Verfügungsgebot nach § 22 Abs. 1 InsO, so ist auch er berechtigt, Arbeitsverhältnisse zu kündigen. Andernfalls verbleibt die Kündigungsbefugnis beim Schuldner, welcher jedoch die Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters benötigt.
Welche Rolle spielt das Kündigungsschutzgesetz im Insolvenzverfahren?
Die Insolvenz an sich ist kein eigenständiger Kündigungsgrund. Daher findet das Kündigungsschutzgesetz auch während des Insolvenzverfahrens Anwendung.
- Quote paper
- Michael Pohlmann (Author), 2008, Besonderheiten bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Insolvenzfall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125173