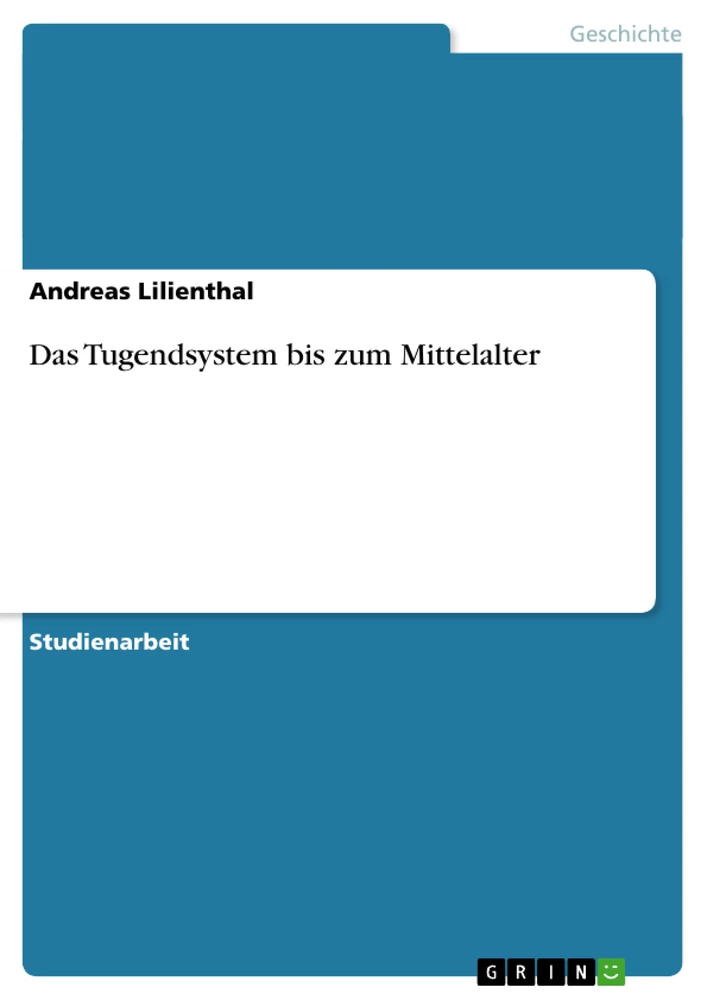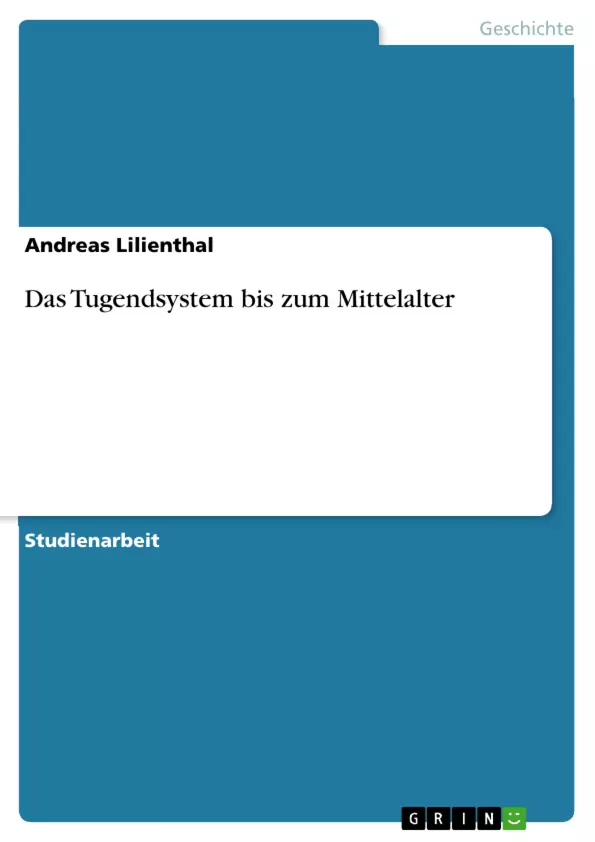Täglich geht eine wahre Informationsflut auf uns nieder. Im Fernsehren können wir live die Ereignisse rund um die Welt erleben. Permanent wird uns dabei eine objektive, neutrale Berichterstattung versprochen. Doch oft bleibt die Wahrheit im Dunkeln, die Nachrichten werden zensiert, mitunter manipuliert, und dienen meist nur zur Beeinflussung der Menschen. Ihnen wird jeden Tag vorgegeben, was richtig und was falsch, wer gut und wer böse ist. Viele Menschen können damit leben, ist es doch bequem, sich mit Problemen nicht auseinander setzten zu müssen, sondern sich vorgefertigten Meinungen anzuschließen. Ist dies auch der Grund für das mangelnde Interesse an einer Diskussion um den Tugendbegriff? Oder ist die Ablehnung in dem verstaubten Image des Begriffes begründet?
Dass es in den letzten Jahren doch ein Interesse an einer Diskussion gibt, zeigt zum Beispiel die populistische Publikation „Das Buch der Tugenden“ von Ulrich Wickert.1 Beachtung erhält der Tugendbegriff außerdem durch die neu entstandenen Probleme der Globalisierung. Gentechnik, Massentierhaltung, Umweltschutz und viele andere Themen erfordern eine Diskussion der Tugendethik.2
In dieser Seminararbeit soll die Veränderung des Tugendbegriffes, dessen Interpretation und die Diskussion um ihn, von der Antike bis zur Gegenwart betrachtet werden. Natürlich kann eine solche Darstellung nicht vollständig sein, zu groß ist die Zahl der Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Da ich an das Thema meiner Meinung nach eher ethisch herangehen muss, habe ich überwiegendend mit Büchern aus dem Bereich der Ethik gearbeitet.
Für die Bearbeitung der Seminararbeit wurde folgende Literatur verwendet: Zunächst einmal ein Lexikon der Philosophie, z.B. das „Metzler- Philosophie Lexikon“ von Prechtl/ Burkhard oder das „Philosophische Wörterbuch“ von Stockhammer. Ein weiteres Wer zur Ethik allgemein ist Martin Honeckers „Einführung in die theologische Ethik“. Das Buch „Grundbegriffe der christlichen Ethik“ von Wils/ Mieth ist sehr ausführlich, aber auch schwer verständlich. Zuletzt möchte ich noch auf 1 unterhaltsames Werk hinweisen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Tugendbegriff in der Antike
- Der vorsokratische Tugendbegriff
- Sokrates und Platon
- Die vier Kardinaltugenden
- Aristoteles
- Die Tugenden in der stoischen Lehre
- Der Tugendbegriff in der christlichen Ethik
- Die Tugend in der Bibel
- Die Tugendlehre im Mittelalter
- Der Tugendbegriff in der Gegenwart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung des Tugendbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart. Sie analysiert die unterschiedlichen Interpretationen und die damit verbundenen Diskussionen. Aufgrund des Umfangs des Themas, kann die Darstellung nicht vollständig sein.
- Der Wandel des Tugendbegriffs über die Jahrhunderte.
- Unterschiedliche philosophische Ansätze zur Definition von Tugend (z.B. vorsokratisch, Sokrates/Platon, Aristoteles).
- Die Rolle der Tugend in der christlichen Ethik.
- Die Relevanz des Tugendbegriffs in der heutigen Zeit.
- Ethische und gesellschaftliche Implikationen des Tugendbegriffs.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Relevanz des Tugendbegriffs angesichts von Informationsflut und gesellschaftlichen Herausforderungen. Kapitel 2 untersucht den antiken Tugendbegriff, beginnend mit den vorsokratischen Philosophen und der Darstellung von Arete als körperliche und gesellschaftliche Tüchtigkeit. Die Ansichten von Sokrates und Platon werden beleuchtet, wobei der Fokus auf der Verknüpfung von Tugend und Wissen liegt. Kapitel 3 befasst sich mit dem christlichen Verständnis von Tugend.
Schlüsselwörter
Tugendbegriff, Antike, Mittelalter, Christentum, Gegenwart, Arete, Sokrates, Platon, Ethik, Moral, Wissen, Glück, Gerechtigkeit, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete "Arete" in der griechischen Antike?
Arete bezeichnete ursprünglich die "Vortrefflichkeit" oder Tüchtigkeit eines Menschen, sowohl in körperlicher als auch in moralischer und gesellschaftlicher Hinsicht.
Was sind die vier Kardinaltugenden?
Die von Platon und später der christlichen Lehre geprägten Tugenden sind: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung.
Wie veränderte das Christentum den Tugendbegriff?
Das Christentum ergänzte die antiken Tugenden um die drei theologischen Tugenden: Glaube, Liebe und Hoffnung.
Warum ist die Diskussion um Tugenden heute wieder aktuell?
Herausforderungen der Globalisierung wie Gentechnik, Umweltschutz und Massentierhaltung erfordern eine neue ethische Debatte über Tugenden und moralische Verantwortung.
Welchen Zusammenhang sahen Sokrates und Platon zwischen Wissen und Tugend?
Sie vertraten die Ansicht, dass Tugend auf Wissen beruht: Wer das Gute wirklich erkennt, wird auch gut handeln.
- Arbeit zitieren
- Andreas Lilienthal (Autor:in), 2006, Das Tugendsystem bis zum Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125223