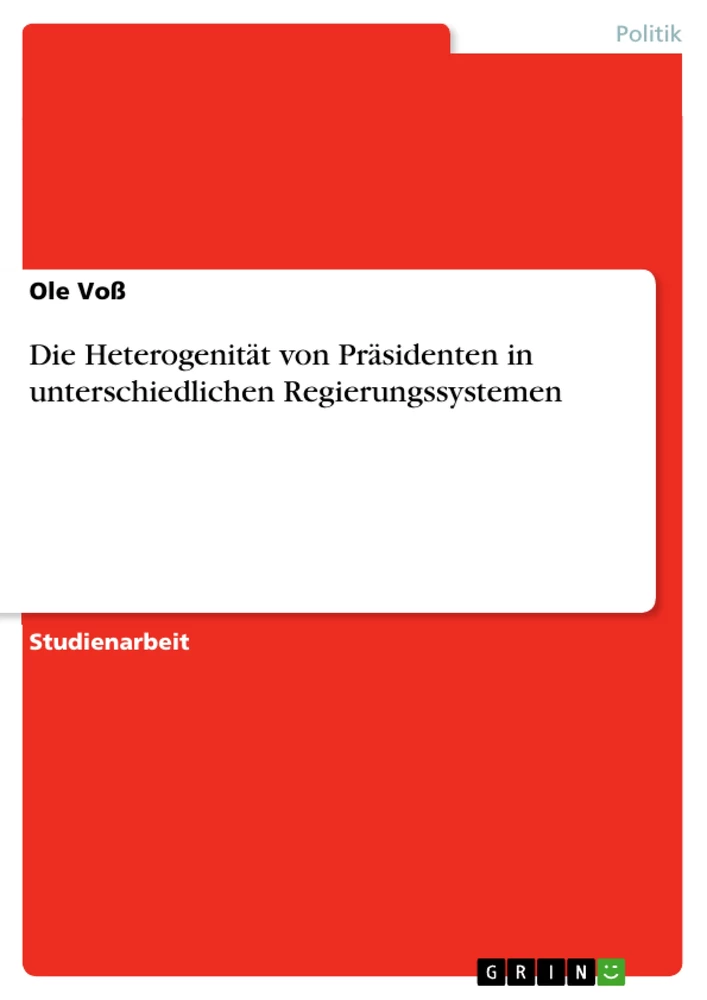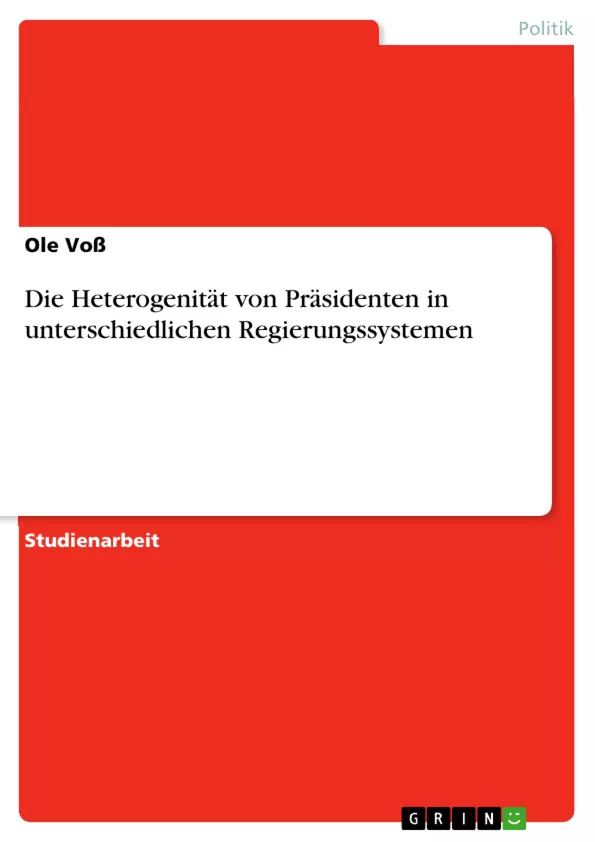Diese Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Varianten des Präsidentenamtes in verschiedenen politischen Systemen. Hierbei wird unter anderem auf die vier Stärketypen von Präsidenten, präsidentielle Befugnisse und das semipräsidentielle System als Sonderfall eingegangen.
Die Klärung der Frage wie die Ausgestaltung dieser einzelnen Faktoren Art und Rolle des Präsidenten eines Landes beeinflusst, ist das primäre Ziel dieser Arbeit. Hierfür werden zunächst die präsidentiellen Befugnisse und die vier Präsidententypen nach Decker erläutert. Anschließend wird die Rolle des Präsidenten als Staatsoberhaupt in präsidentiellen, parlamentarischen und semipräsidentiellen Republiken beleuchtet. Weiterhin soll näherungsweise diskutiert werden, ob es sich beim semipräsidentiellen System um einen Sonderfall der Regierungssysteme handelt. Dies ist ein weiteres wichtiges, jedoch sekundäres Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Präsidentielle Befugnisse
3 Die vier Typen von Präsidenten
4 Die Rolle des Präsidenten in unterschiedlichen Regierungssystemen 4.1 Der Präsident in der präsidentiellen Republik 4.2 Der Präsident in der parlamentarischen Republik 4.3 Der Präsident in der semipräsidentiellen Republik
5 Das semipräsidentielle System als Sonderfall?
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Erst vor wenigen Wochen wählte die deutsche Bundesversammlung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine weitere Amtszeit (vgl. Tagesschau, 2022). In Frankreich stehen im Frühjahr dieses Jahres Präsidentschaftswahlen an und auch in Costa Rica, Slowenien, Österreich, Kolumbien, Südkorea und sogar in Libyen werden in diesem Jahr neue Staatsoberhäupter gewählt (vgl. Welt 2022).
Betrachtet man die vielen verschiedenen Präsidenten der Länder der Erde wird eines schnell evident. Der Terminus „Präsident“ beschreibt (zumindest auf Nationalstaaten bezogen, in der Regel ein Staatsoberhaupt. Wobei selbstsagend auch Staatsoberhäupter existieren, die kein Präsident sind. Allerdings unterscheiden die verschiedenen Staatsoberhäupter sich dann in ihren jeweiligen Befugnissen und der individuellen Ausgestaltung ihres Amtes doch deutlich voneinander.
Wer und/ oder was ein Präsident ist, ist primär abhängig von den ihm zugestandenen präsidentiellen Befugnissen, dem Präsidententypus, der sowohl von individuellen als auch von regulatorischen Faktoren abhängig ist, sowie vom jeweiligen Regierungssystem des Landes, welches das Staatsoberhaupt regiert.
Die Klärung der Frage wie die Ausgestaltung dieser einzelnen Faktoren Art und Rolle des Präsidenten eines Landes beeinflusst, ist das primäre Ziel dieser Arbeit. Hierfür werden zunächst die präsidentiellen Befugnisse und die vier Präsidententypen nach Decker (2010) erläutert. Anschließend wird die Rolle des Präsidenten als Staatsoberhaupt in präsidentiellen, parlamentarischen und semipräsidentiellen Republiken beleuchtet. Weiterhin soll näherungsweise diskutiert werden, ob es sich beim semipräsidentiellen System um einen Sonderfall der Regierungssysteme handelt. Dies ist ein weiteres wichtiges, jedoch sekundäres Ziel dieser Arbeit.
Die große Mehrheit (circa 90%) der Staatsoberhäupter der 194 Staaten und den zwölf weiteren (nicht vollständig anerkannten) Territorien auf der Welt ist männlich. Dennoch seien an dieser Stelle auch die Staatspräsidentinnen von Äthiopien, Barbados, Griechenland, Kirgisistan, der Republik Korea, Kroatien, Nepal, Singapur, der Slowakei, Taiwan, Trinidad und Tobago, sowie die Königinnen von Dänemark, Großbritannien und den Commonwealth Staaten, ferner auch die Präsidentin der Europäische Kommission (vgl. CIA 2022) genannt, die in dieser von Männern dominierten Welt höchsten Respekt und Anerkennung verdienen. Da in der Literatur (vgl. z.B. Decker 2010; Kimmel 2013; Steffani 1995), nicht zuletzt zwecks der besseren Lesbarkeit aufgrund der häufigen Wortwiederholungen, das generische Maskulinum jedoch üblich ist, findet dieses auch hier Anwendung. Gemeint sind jedoch selbstredend alle Geschlechter.
2 Präsidentielle Befugnisse
Decker (2010) nennt insgesamt acht unterschiedliche präsidentielle Befugnisse (334f). Diese werden unterschieden in die sogenannten nicht-legislativen und die legislativen Befugnisse.
Unter nicht legislativen Befugnissen wird die Ernennung von Regierungen, sprich die von Staatschefs und ihren jeweiligen Fachministern, sowie auch die Entlassung derselben verstanden. Weiterhin zählt zu diesen Befugnissen auch die Auflösung des Parlaments zur Herbeiführung von Neuwahlen (ebd.).
Den nicht-legislativen Befugnisse stehen die legislativen, also gesetzgebenden Befugnisse von Präsidenten gegenüber. Diese bestehen beispielsweise aus der (teilweise alleinigen) Zuständigkeit des Staatsoberhauptes in bestimmten Politikfeldern. Typische Politikbereiche sind hier die Außen- und Verteidigungspolitik, aber auch Europapolitik (ebd.). Weitere wichtige legislative Befugnisse sind das Gesetzesinitiativrecht, also die Möglichkeit ein Gesetz zur Abstimmung ins Parlament einzubringen, sowie auch das dazugehörige Pendant in Form eines Vetorechts. Hier ist es dem Präsidenten als Exekutivkraft möglich, ein Veto gegen ein vom Parlament bereits verabschiedetes Gesetz einzulegen, es also nicht auszuführen (ebd.). Weiterhin können Präsidenten mit dem Dekret Recht ausgestattet sein, welches ihnen ermöglicht ein Gesetz, eine Verordnung oder eine Verfügung auch gegen den Willen, beziehungsweise die Stimme, des Parlamentes zu erlassen (ebd.). Schließlich kann ein Staatsoberhaupt noch ermächtigt sein gewisse Notstandsbefugnisse zu erlassen, also gewisse Verfassungsänderungen auf Zeit zu beschließen, um beispielsweise einem Krieg, einer Naturkatastrophe oder einer Pandemie Herr zu werden (ebd.).
Bei der Betrachtung dieser Befugnisse ist es nach Becker (2010: 335) jedoch zentral drei wichtige Punkte im Hinterkopf zu behalten. Erstens haben nicht alle Merkmale in allen Ländern dieselbe Bedeutung. So kann die Ernennung von Regierungen, je nach dem jeweiligen Regierungssystem (siehe Kapitel 4), mehr oder weniger relevant sein. Zweitens können die präsidentiellen Befugnisse in unterschiedlichen Staaten verschiedene Ausprägungen haben. Beispielweise können die Notstandsbefugnisse, die ein Präsident erlassen kann, unterschiedlich stark in die Grundrechte der Bürger eingreifen und unterschiedliche oder auch keine zeitlichen Befristungen haben. Drittens ist schließlich fraglich, ob der Befugte auch von seinen jeweiligen Befugnissen Gebrauch macht. Was zunächst rein hypothetisch klingt, hatte in der Vergangenheit durchaus große Relevanz, wie im folgenden Kapitel erläutert wird.
3 Die vier Typen von Präsidenten
Über die präsidentiellen Befugnisse hinaus ist weiterhin zentral, welchem der vier sogenannten Stärketypen (vgl. Decker 2010: 335f) der jeweilige Präsident angehört. Im Folgenden werden diese vier Typen in aufsteigender Reihenfolge von schwach bis stark aufgelistet.
Der erste Stärketyp beschreibt sogenannte „figureheads“ (Decker 2010: 336), die eine hauptsächlich zeremoniell-notarielle Funktion innehaben. Als Beispiel sind hier der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder der Präsident der Italienischen Republik Sergio Mattarella zu nennen. Den zweiten Präsidententyp verkörpern all die Staatsoberhäupter die zusätzlich aktiv korrigierend in den Regierungsprozess in ihrem Land eingreifen. Ein prominenter Vertreter des zweiten Typs ist der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Der dritte Typ von Präsidenten unterscheidet sich von den zuvor genannten insoweit, als dass er außerdem die Richtlinien der Politik, insbesondere die der Exekutive, vorgibt. Unter diesem Typus lassen sich die meisten demokratisch gewählten Präsidenten in präsidentiellen Systemen, wie der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden, wiederfinden. Der vierte und letzte Stärketyp wird von Präsidenten verkörpert, die hyperpräsidentiell (oder auch superpräsidentiell) mit vollständiger Dominanz über Parlament und Regierung eines Nationalstaats herrschen. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür ist der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin (vgl. Decker 2010: 335f).
Zentral ist, dass es nicht immer einwandfrei möglich ist einen bestimmten Präsidenten eindeutig einem Stärketyp zuzuordnen. Die Grenzen sind hier fließend. Dies gilt sowohl für Veränderungen innerhalb eines politischen Systems über Zeit als auch für Veränderungen des einzelnen Präsidenten im Laufe seiner Amtszeit, welche bedingt sein können von äußeren Umständen, Verfassungsänderungen oder charakterlichen Eigenschaften der individuellen Person. Weiterhin sind Veränderung des Präsidententyps in beide Richtungen möglich. In Finnland und Portugal führte der in Kapitel 3 bereits erwähnte Verzicht auf präsidentielle Befugnisse in den 80er Jahren über einen Wandel des Regierungssystems (von semi-präsidentiell zu parlamentarisch) auch zu einer Veränderung des Stärketyps hin zu einem reinen „figurehead“ (vgl. Decker 2010: 336). Gegenläufig war in der jüngeren Vergangenheit ein Wechsel des Typus hin zu einem stärkeren und mächtigeren Präsidenten exemplarisch in Russland zu beobachten, wo der seit 2000 regierende Präsident Putin sich im Laufe der Zeit zu einem Superpräsidenten entwickelte (ebd.).
Auch hier offenbart sich eine weitere Spannungslinie für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Frühjahr 2022. Denn während sich Russland neben der Stärkung des Präsidentenamtes zunehmend autokratisierte, war in der Ukraine, ebenfalls ein Nachfolgestaat der Sowjetunion, eine Wandlung des Stärketyps von vier hin zu zwei bis drei, sowie auch eine zunehmende Demokratisierung zu beobachten (ebd.; vgl. The Economist 2022: 33). Auch wenn sich diese Demokratisierungstendenzen in den vergangenen Jahren in der Ukraine auf dem absteigenden Ast befanden, liegt das Land laut dem Economist Democracy Index 2022 noch immer 38 Plätze vor der Russischen Föderation (vgl. The Economist 2022: 14f). Insbesondere in den Kategorien Poltische Kultur und Wahlprozesse, die beide das Präsidentenamt direkt betreffen, schneidet die Ukraine mit 5.00, beziehungsweise 8.25 Punkten, im Vergleich zu Russland (3.75, beziehungsweise 1.75 Punkte) deutlich besser ab (The Economist 2022: 14f).
4 Die Rolle des Präsidenten in unterschiedlichen Regierungssystemen
Die Rolle eines Präsidenten hängt neben seinen verfassungsrechtlich zugesicherten Befugnissen und seinem Stärketyp weiterhin elementar von dem jeweiligen Regierungssystem des Landes ab, in dem er regiert. Ferner spielt das Regierungssystem auch eine, wenn nicht die, entscheidende Rolle bei der Bemessung des Umfangs an Befugnissen und der Höhe des Stärkegrades.
Im Folgenden werden zur Klärung der Präsidentenrolle die drei häufigsten republikanischen Systeme beleuchtet. Namentlich sind diese die präsidentielle, die parlamentarische und die semipräsidentielle Republik. Absolute und konstitutionelle Monarchien, wie in Saudi-Arabien, beziehungsweise Marokko, werden ebenso wenig behandelt wie das chinesische, nordkoreanische oder kubanische Ein-Parteien-System. Da eine doch wesentliche Anzahl an Nationalstaaten über ein parlamentarisch-monarchisches Regierungssystem verfügt, sei an dieser Stelle erwähnt, dass dieses für den Zweck dieser Arbeit weitestgehend mit dem der parlamentarischen Republik gleichzusetzen ist. Die Rolle des Monarchen als Staatsoberhaupt ist hier in etwa gleichbedeutend mit der des in Kapitel 4.2 beschriebenen Präsidenten.
Weiterhin gilt, dass die hier skizzierten Rollen zwischen einzelnen Ländern mit dem gleichen Regierungssystem leicht variieren können. Da sich die Vielzahl der Variationen jedoch nur schwer abbilden lässt, wird hier prototypisch die Rolle des Staatsoberhauptes für das jeweilige Regierungssystem skizziert. In Kapitel 4.3 wird dies insbesondere anhand der V. Französischen Republik getan.
4.1 Der Präsident in der präsidentiellen Republik
Wie der Name schon erahnen lässt, steht der Präsident in der präsidentiellen Republik im Zentrum des politischen Geschehens. Sowohl er als auch das Parlament werden direkt von Volk gewählt, sind streng voneinander getrennt, unterliegen jedoch einer gegenseitigen Kontrolle („checks and balances“) (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2020b).
Der Präsident bildet in diesem System die Exekutive und ist mit weitreichenden (legislativen) Befugnissen ausgestattet. So verfügt er in der Regel über ein Exekutiv-, sowie Vetorecht, kann per Dekret regieren und Notstandsgesetze erlassen. Weiterhin ist der Präsident meist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte seines Landes. Allerdings bleibt das Staatsoberhaupt meist ohne Gesetzesinitiativrecht, welches allein dem Parlament vorbehalten ist (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2020b).
Die Person des Präsidenten ist im präsidentiellen System der zentrale Charakter und daher auch verhältnismäßig stark. Ein Stärketyp von drei bis vier ist daher die Regel. Ein präsidentielles System geht darüber hinaus meist mit einem einfachen Mehrheitswahlrecht und nur zwei politisch relevanten Parteien einher (ebd.). Diese zwei Faktoren verstärken daher den präsidentiellen Fokus zusätzlich, was unter anderem an der häufig stark polarisierten und emotionalisierten Debatte im Zuge der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen gut zu erkennen ist. Der US-amerikanische Präsident verfügt zwar über weitgehende Befugnisse, sieht sich jedoch häufig mit einer parlamentarischen Minderheit seiner eigenen Partei konfrontiert, die regelmäßig durch die Neuwahl von Teilen der Legislative (Midterm-Elections) nach der Hälfte seiner Amtszeit zu Stande kommt. Hierdurch kann es im (US-amerikanischen) präsidentiellen System immer wieder dazu kommen, dass das Staatsoberhaupt entgegen seiner eigentlichen Macht zu Kompromissen gezwungen oder sogar blockiert wird.
Neben den Vereinigten Staaten von Amerika verfügt eine Großzahl der Staaten der Welt über ein präsidentielles Regierungssystem. Dies gilt, mit Ausnahme Kanadas und einiger lateinamerikanischer Länder, für den gesamten amerikanischen Kontinent, sowie für große Teile Subsahara-Afrikas und Zentralasiens. Die einzigen „europäischen“ Länder die über ein präsidentielles Regierungssystem und somit auch über einen starkes (beziehungsweise in diesen Fällen sehr starkes) Staatsoberhaupt verfügen, sind die Republik Belarus und die Republik Türkei.
4.2 Der Präsident in der parlamentarischen Republik
Das Gegenstück (sofern in diesem Zuge von einem Gegenstück gesprochen werden kann) zur präsidentiellen Republik stellt das parlamentarische Regierungssystem dar. Der Präsident ist hier ebenso das Staatsoberhaupt, allerdings nur teilweise der Exekutive zuzuordnen. Diese wird ferner von einer Bundesregierung, bestehend aus Regierungschef und Fachministern, gebildet. Weder Regierungschef noch Staatsoberhaupt werden in der Regel direkt vom Volk gewählt (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2020a). Eine Ausnahme ist hier beispielweise Österreich, wo der Bundespräsident direkt vom Volk gewählt wird. Darüber hinaus hat dieser meist keine legislativen Befugnisse, ist also eine rein notariell-zeremonielle „Figurehead“-Figur (vgl. Decker 2010: 336). Dem Staatsoberhaupt obliegt es somit nicht, ein Veto gegen Gesetze einzubringen, die Armee zu befehligen oder einen Notstand zu verhängen. Folglich ist der Präsident im parlamentarischen System dem Stärketyp eins zuzuordnen.
Die lediglich vermittelnde und repräsentative Funktion des Staatsoberhauptes wird auch daran deutlich, dass die Regierungschefs der jeweiligen Staaten innen- und außenpolitisch nicht nur über weit größere Relevanz, sondern auch Bekanntheit verfügen. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Österreich Karl Nehammer, der auf Sebastian Kurz folgte, erfreut sich in den deutschen Medien (nicht nur auf Grund der Skandale seines Vorgängers) weit größerer Berühmtheit als sein Staatsoberhaupt Alexander van der Bellen. Gleiches gilt auch für Österreichs Nachbar Italien, dessen Ministerpräsident Mario Draghi, nicht nur aufgrund seiner EZB-Vergangenheit, in den Nachrichten signifikant präsenter vertreten zu sein scheint als der 2022 wiedergewählt Präsident Sergio Mattarella.
Die präsidentiellen Republiken sind eng verwandt mit den parlamentarischen Monarchien Skandinaviens, Japans oder der Commonwealth Staaten. Allerdings besitzt das Staatsoberhaupt in Form eines Monarchen, sowie seine gesamte Familie, häufiger noch eine größere Volksnähe und somit mehr Identifikationspotenzial als die Präsidenten der präsidentiellen Republiken (vgl. Schäfer 2022).
4.3 Der Präsident in der semipräsidentiellen Republik
Das letzte hier behandelte Regierungssystem stellt die semipräsidentielle Republik dar. Ihre Verortung in der politischen Landschaft ist umstritten (siehe Kapitel 5), da sie sowohl parlamentarische als auch präsidentielle Elemente enthält.
Das System selbst zeichnet sich durch die Direktwahl von Staatsoberhaupt und Parlament aus. Allerdings besteht die Exekutive neben dem Präsidenten weiterhin aus Regierungschef und Fachministern, wobei erstgenannter vom Präsidenten bestimmt wird (vgl. Vogel 2005). Die Regierung ist jedoch nicht dem Präsidenten, sondern allein dem Parlament gegenüber verantwortlich (vgl. Duverger 1986). Aus der Zweiteilung der Exekutive folgt auch eine besondere Stellung des Staatsoberhauptes. Dieses verfügt, im Gegensatz zu seinen Kollegen im parlamentarischen System, über zentrale legislative Befugnisse, welche jedoch nicht absolut sind. So ist der Präsident der semipräsidentiellen Republik zwar häufig alleiniger Verantwortlicher für Außen- und Sicherheitspolitik und somit auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte, verfügt im Gegenzug allerdings nicht über ein Vetorecht gegen vom Parlament verabschiedete Gesetze. Die Rolle des Präsidenten ist in diesem System besonders vielfältig, anspruchsvoll (siehe Kapitel 5) und nicht ganz so klar zu bestimmen wie in den vorausgegangenen Abschnitten. In der Regel lässt sich jedoch in semipräsidentiellen Systemen ein Präsident eines Stärketypen von zwei bis drei, also mit mittlerer Stärke finden. Der Präsident ist neben dem Regierungschef eine „Reservemacht“ (Kimmel 2013: 37).
Die dennoch nicht zu leugnende Signifikanz des Präsidenten in semipräsidentiell regierten Staaten lässt sich abermals am Bekanntheitsmaß des Staatsoberhauptes festmachen. So sind die Präsidenten Frankreichs und Russlands (auch bei Abwesenheit internationaler bewaffneter Konflikte) zentrale Bestandteile der politischen Berichterstattung in Deutschland und Europa. Frankreichs Premierminister Jean Castex und Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin wiederum sehen sich in der international medialen Berichterstattung wohl eher geringerer Bekanntheit ausgesetzt. Dies scheint jedoch kontrovers, da ihnen, zumindest im Falle intakter semipräsidentieller Demokratien wie Frankreich oder Portugal, eine zentrale Rolle im politischen System zukommt (vgl. Kimmel 2013).
5 Das semipräsidentielle System als Sonderfall?
Wie bereits oben erläutert handelt es sich beim semipräsidentiellen Regierungssystem um eine Art Sonderfall. Das System ist zum einen in seiner Einordnung in die politischen Systeme umstritten und geht zum anderen mit großen Ansprüchen an seine politischen Akteure einher. Nach Duverger (1986) ist das System durch drei zentrale, in Kapitel 4.3 bereits beleuchtete, Merkmale gekennzeichnet. Diese sind erstens die Direktwahl des Staatsoberhauptes, zweitens die Ausstattung desselben mit wichtigen (legislativen) Befugnissen und drittens die Co-Existenz von Präsidenten und Regierung mit seinem Regierungschef, welche alleinig dem Parlament gegenüber verantwortlich ist.
Dieses in der Literatur als „System bipolarer Exekutive“ (Kaltefleiter 1970: 129) oder „Doppelköpfiger Exekutive“ (Vogel 2005) beschriebene Phänomen, wirft die Frage auf, ob die Existenz zweier „Köpfe“ zu gesteigerter Macht und politischer Intelligenz oder aber zu Konflikten, Blockaden und politischer Unfähigkeit führt.
Die Beantwortung dieser Frage ist in dreifacher Form möglich. Skach (2005: 15ff) nennt insgesamt drei verschiedene Arten von Regierungspraxis die in semipräsidentiellen Systemen möglich sind. Diese sind die gleichgerichtete und geteilte Mehrheitsregierung, sowie die geteilte Minderheitsregierung.
Im Falle der gleichgerichteten Mehrheitsregierung entstammen sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef dem gleichen politischen Lager oder der gleichen Partei (vgl. Decker 2010: 339), mit welcher sie über eine Mehrheit im Parlament verfügen. Dieses Szenario führt zu einer Stärkung des Ministerpräsidenten und einer de facto Schwächung des Präsidenten, da dieser kein politisches Interesse daran hat, die ihm zur Verfügung stehenden Befugnisse zu nutzen. Vielmehr agiert er im Einklang mit seiner Partei und sichert seine politische Linie somit über die Arbeit der Regierung und des Parlamentes ab. Eine derartige Konstellation lässt sich im Jahr 2022 in Frankreichs Regierungsapparat vorfinden.
Dementgegen steht die geteilte Mehrheitsregierung, bei welcher Präsident und Regierungschef aus unterschiedlichen politischen Lagern kommen, allerdings nur die Regierung eine parlamentarische Mehrheit auf sich vereinen kann (vgl Decker 2010: 339; Skach 2005). Dem Staatsoberhaupt bleibt nichts anderes übrig als, entgegen seines politischen Willens, einen politischen Gegner als Regierungschef zu vereidigen. Kandidaten aus seinem eigenen Lager wären parlamentarisch unterlegen. Diese als „cohabitation“ (Decker 2010: 339) bezeichnete Situation führt zu einer starken Schwächung des Präsidenten, der in diesem Falle häufig (trotz Regierungsbeteiligung) als erster Oppositioneller bezeichnet wird (ebd.). Da er in diesem Fall, parlamentarisch wie auch gesellschaftlich, Teil einer Minderheit ist, kann er nur versuchen seine Macht und Befugnisse gegen die Regierung auszuspielen. Dies kann erfolgreich sein und ihm bei der nächsten Wahl neue Mehrheitsverhältnisse zu seinen Gunsten bescheren. Andererseits können die begrenzten Befugnisse des Präsidenten gegen die politischen Mehrheiten aber auch verpuffen und seine Umfragewerte weiter sinken. Ganz zentral ist in diesem Fall selbstredend auch der Umfang der präsidentiellen Befugnisse und die Art des Stärketyps. Präsidenten des Typs drei sehen sich hier weniger geschwächt als die des Typus zwei. In der französischen Republik war die cohabitation beispielsweise von 1997 bis 2002 der Fall. Dort mussten sich der liberale Gaullist Jacques Chirac als Staatspräsident und der Sozialist Lionel Jospin die Regierungsverantwortung teilen. In den fünf Jahren bestimmte die sozialistische Mehrheit die Sozial-, Innen- und Wirtschaftspolitik, die der Präsident mangels Vetos zwar kritisieren, allerdings nicht verhindern konnte. Im Gegenzug nutzte Chirac die ihm verfassungsmäßig zugesicherten Befugnisse der Bestimmung über Außen- und Sicherheitspolitik (vgl. Kimmel, 2013: 42f). Der Zustand der geteilte Mehrheitsregierung wird in Frankreich zunehmend versucht bereits im Vorhinein zu unterbinden, indem man Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, mit dem Ziel, dass ein politisches Lager als Begünstigte hervorgeht, in etwa zeitgleich abhält (ebd.).
Die letzte und schwierigste Regierungskonstellation stellt die geteilte Minderheitsregierung dar. In diesem Fall gehören Staatsoberhaupt und Regierungschef zum einen unterschiedlichen politischen Lagern an und können zum anderen beide keine politischen Mehrheiten im Parlament auf sich vereinen (vgl. Decker 2010: 339). In dieser Situation kann der Präsident jedoch seine (in Kapitel 4.3 erwähnte) Rolle als Reservemacht bestmöglich ausspielen. Er ist zwar keineswegs vollständig politisch handlungsfähig, besitzt allerdings im Vergleich zur Opposition gewisse Möglichkeiten und Befugnisse Regierungsprozesse auszugestalten. Diese erhaltene Handlungsfähigkeit ist jedoch verbunden mit einer großen Ambivalenz, welche abhängig ist von der Stärke und Einstellung des Präsidenten. Auf der einen Seite kann ein Land trotz suboptimaler Mehrheitsverhältnisse vor allem außenpolitisch weiterhin handeln. Auf der anderen Seite besteht jedoch die Gefahr, dass auf Seiten des Präsidenten die Beschlussfähigkeit ohne parlamentarische und gesellschaftliche Mehrheiten zu autokratischen Tendenzen und einer Ausweitung der eigenen Macht führt (vgl. Decker 2010: 341).
Die Variabilität semipräsidentieller Republiken ist Ursache eines andauernden Streits in der Wissenschaft darüber, wo das System politisch zu verorten sei. Weder eine vollständige Klärung noch eine allumfassende Darstellung des Konflikts sind in dieser Arbeit möglich. Allerdings sollen die Konfliktlinien entlang derer diskutiert wird hier kurz dargestellt werden.
Auf der einen Seite stehen Winfried Steffani und weitere Vertreter der These, dass das semipräsidentielle System ein parlamentarisches System mit Präsidialdominanz darstellen. Die Vertreter dieser These sehen Regierungssysteme als rein dichotome Variable an (präsidentiell oder parlamentarisch). Da der Präsident zur Verkündung der vom Parlament verabschiedeten Gesetzte verpflichtet ist und eventuell sogar die größere Relevanz im Regierungsprozess vom Regierungschef ausgehen, überwiegen die parlamentarischen Elemente für Steffani (1995) hier (vgl. Decker 2010). Eine Bezeichnung des Systems als „semiparlamentarisch“ wäre demnach an sich sinnig, könnte allerdings gewisse autokratische Assoziationen hervorrufen (vgl. Decker 2010: 229).
Demgegenüber steht unter anderem Maurice Duverger der etwas von Steffanis Dichotomie-Ansatz abrückt. Auch er betont die parlamentarischen Eigenschaften des Semipräsidentialismus, weist allerdings auch auf die präsidentiellen Elemente hin, die das System explizit von rein parlamentarischen Regierungsformen abgrenzt. Dies führt dazu, dass Duverger im hybriden semipräsidentiellen System ein System sui generis sieht, welches dazu auffordert die rein dichotome Kategorisierung zu überwinden (vgl. Duverger 1986; Decker 2010).
In jedem Fall bleibt das semipräsidentielle System eine zum einen höchst flexible und wandelbare, zum anderen aber auch hoch komplexe Regierungsform, welche von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden kann und eine hohe Verantwortung für alle Beteiligten mit sich bringt.
6 Fazit
Was die Aufgaben, Pflichten und Verantwortungen eines Staatspräsidenten sind lässt sich also keineswegs allein aus seinem Titel ablesen. Vielmehr ist seine Rolle abhängig vom jeweiligen Regierungssystem seines Landes, welches primär präsidentiell, parlamentarisch oder semipräsidentiell sein kann, von seinen legislativen und nicht-legislativen Befugnissen, seinem Stärkentypen und den vorherrschenden Mehrheitsverhältnissen und der daraus hervorgehenden Regierungspraxis abhängig.
Die verschiedenen Regierungssysteme sind demokratiepolitisch unterschiedlich anspruchsvoll und bieten, in Verbindung mit äußeren Umständen, verschiedene Handlungsmöglichkeiten für das Staatsoberhaupt. Besonders die semipräsidentiellen Republiken scheinen hier, auch auf Grund einer großen Varianz des Präsidentenamtes, besonders anspruchsvoll, aber auch (gerade für junge Demokratien, wie die Staaten der ehemaligen Sowjetunion) besonders attraktiv zu sein.
Die Rolle des Präsidenten ist jedoch unabhängig von den oben genannten Faktoren in jedem Fall eine der Repräsentation und Verantwortung. Inwieweit die Ausprägung hier analysierten Merkmale eine Grundlage für stabile Demokratie oder gegenläufig auch für Autokratisierungsprozesse spielen, welche Rolle hierbei der individuelle Charakter des Staatsoberhauptes und die Parteienlandschaft haben, kann und sollte einen Forschungsansatz kommender Arbeiten darstellen.
7 Literaturverzeichnis
Bundeszentrale für politische Bildung, 2020. Parlamentarisches Regierungssystem. [Online]Available at: https://m.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17990/parlamentarisches-regierungssystem[Zugriff am 13 Januar 2022].
Bundeszentrale für politische Bildung, 2020. Präsidentielles Regierungssystem. [Online]Available at: https://m.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/18057/praesidentielles-regierungssystem[Zugriff am 13 Januar 2022].
CIA, 2022. The CIA World Factbook. [Online]Available at: https://www.cia.gov/the-world-factbook/[Zugriff am 25 Februar 2022].
Decker, F., 2010. Der Semi-Präsidentialismus als "unechtes" Mischsystem. ZfP, Issue 03/2010, pp. 329-341.
Duverger, M., 1986. Les regimes semi-presidentiels. Paris
Kaltefleiter, W., 1970. Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der parlamentarischen Demokratie. Wiesbaden Hrsg. Köln/ Opladen: Springer.
Kimmel, A., 2013. Die V. französische Republik: Entdeckung eines neuen Systemtyps oder eine "wissenschaftliche Fata Morgana?". In: Gallus et al., Hrsg. Deutsche Kontroversen. s.l.:Nomos, pp. 251-263.
Schäfer, J., 2022. Wir sind sehr nah an den Schicksalen und Emotionen. [Online]Available at: https://www.das-parlament.de/2022/1_2/themenausgaben/874290-874290[Zugriff am 02 März 2022].
Skach, C., 2005. Borrowing Constitutional Design. Constitutional Law in Waimar, Germany and the French Fifth Republic. Princeton/ Oxford: Princeton University Press.
Steffani, W., 1995. Semi-Präsidentialismus: Ein eigenständiger Systemtyp? Zur Unterscheidung von Legislative und Parlament. Zeitschrift für Parlamentsfragen, Band 26.
Tagesschau, 2022. Bundespräsident Steinmeier wiedergewählt. [Online]Available at: https://www.tagesschau.de/inland/steinmeier-wiederwahl-101.html[Zugriff am 25 Februar 2022].
The Economist Intelligence Unit, 2022. Democracy Index 2022: The China Challenge. London. New York: EIU.
The Economist, 2021. Global Democracy has a very bad year. [Online]Available at: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year[Zugriff am 13 Januar 2022].
Vogel, W., 2005. Charakterisktika des politischen Systems. [Online]Available at: https://m.bpb.de/izpb/9130/charakteristika-des-politischen-systems[Zugriff am 13 Januar 2022].
WELT, 2022. Hier finden 2022 wichtige Wahlen statt - in Deutschland und im Ausland. [Online]Available at: https://www.welt.de/politik/article236319995/Wahlen-2022-Termine-in-Deutschland-und-Ausland-die-wichtigsten-Wahltermine.html[Zugriff am 25 Februar 2022].
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Rolle des Präsidenten in verschiedenen Regierungssystemen, wobei der Fokus auf den präsidialen Befugnissen, den Präsidententypen und den Unterschieden zwischen präsidentiellen, parlamentarischen und semipräsidentiellen Republiken liegt.
Welche präsidentiellen Befugnisse werden unterschieden?
Es werden nicht-legislative und legislative Befugnisse unterschieden. Zu den nicht-legislativen Befugnissen gehören die Ernennung und Entlassung von Regierungen sowie die Auflösung des Parlaments. Zu den legislativen Befugnissen zählen die Zuständigkeit in bestimmten Politikfeldern (z.B. Außen- und Verteidigungspolitik), das Gesetzesinitiativrecht, das Vetorecht, das Dekret-Recht und Notstandsbefugnisse.
Welche Präsidententypen werden unterschieden?
Es werden vier Stärketypen unterschieden: "Figureheads" (hauptsächlich zeremoniell), Präsidenten mit aktiv korrigierendem Eingriff in den Regierungsprozess, Präsidenten, die die Richtlinien der Politik vorgeben (insbesondere der Exekutive), und hyperpräsidentielle/superpräsidentielle Präsidenten mit vollständiger Dominanz über Parlament und Regierung.
Wie unterscheidet sich die Rolle des Präsidenten in den verschiedenen Regierungssystemen?
In präsidentiellen Republiken steht der Präsident im Zentrum des politischen Geschehens und verfügt über weitreichende Befugnisse. In parlamentarischen Republiken hat der Präsident eine hauptsächlich zeremonielle Funktion. In semipräsidentiellen Republiken teilt sich der Präsident die Exekutive mit einem Regierungschef und verfügt über legislative Befugnisse, die jedoch nicht absolut sind.
Was ist das semipräsidentielle System und warum wird es als Sonderfall betrachtet?
Das semipräsidentielle System kombiniert Elemente des präsidentiellen und parlamentarischen Systems. Es wird als Sonderfall betrachtet, da seine Einordnung in die politischen Systeme umstritten ist und es hohe Ansprüche an seine politischen Akteure stellt. Es kann zu verschiedenen Arten von Regierungspraxis kommen: gleichgerichtete Mehrheitsregierung, geteilte Mehrheitsregierung und geteilte Minderheitsregierung.
Welche unterschiedlichen Regierungsansätze sind in semipräsidentiellen Systemen möglich?
Es werden drei Arten von Regierungspraxis genannt: Die gleichgerichtete Mehrheitsregierung (Präsident und Regierungschef stammen aus dem gleichen Lager), die geteilte Mehrheitsregierung (Präsident und Regierungschef aus unterschiedlichen Lagern, aber die Regierung hat eine Mehrheit im Parlament) und die geteilte Minderheitsregierung (Präsident und Regierungschef aus unterschiedlichen Lagern und keiner hat eine Mehrheit im Parlament).
Welche Positionen gibt es in der Forschung bezüglich des semipräsidentiellen Systems?
Es gibt unterschiedliche Ansichten. Einige sehen das semipräsidentielle System als ein parlamentarisches System mit Präsidialdominanz, während andere es als ein eigenständiges System (sui generis) betrachten, das sowohl präsidentielle als auch parlamentarische Elemente aufweist.
Welche Literatur wird in diesem Text angeführt?
Der Text verweist auf zahlreiche Quellen, darunter Arbeiten von Bundeszentrale für politische Bildung, CIA, Decker, Duverger, Kaltefleiter, Kimmel, Schäfer, Skach, Steffani, Tagesschau, The Economist und Vogel, um seine Argumente zu untermauern und verschiedene Perspektiven auf die Rolle des Präsidenten und die Regierungssysteme darzustellen.
- Quote paper
- Ole Voß (Author), 2022, Die Heterogenität von Präsidenten in unterschiedlichen Regierungssystemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1252683