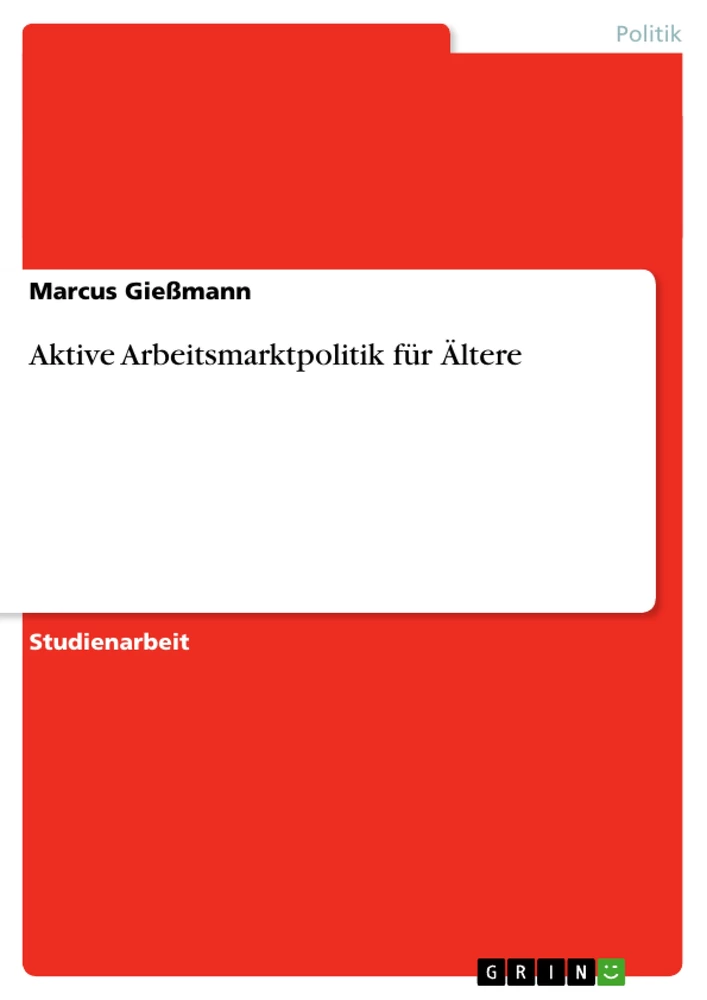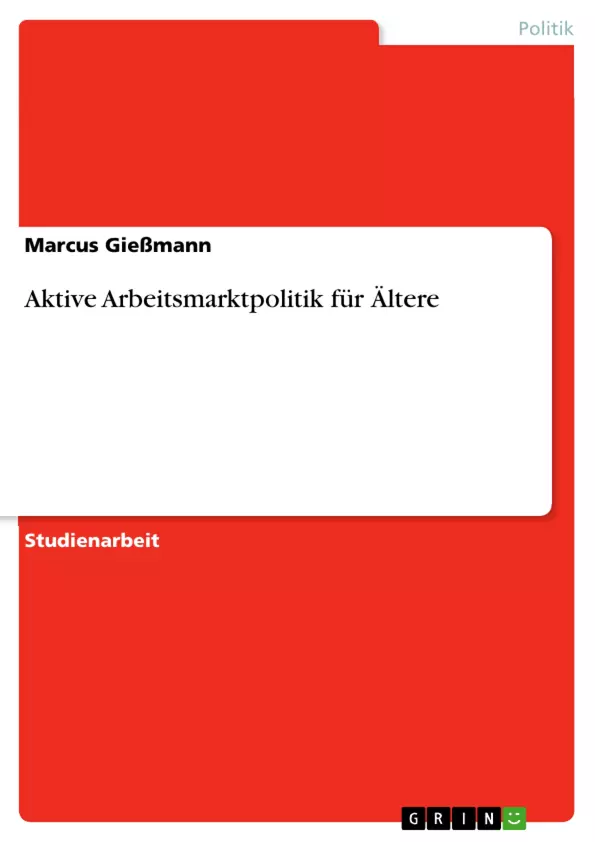Demographische Entwicklungen der letzten Jahre indizieren einen Zuwachs in der
gesellschaftlichen Gruppe der Älteren, wohingegen die der Jüngeren stagniert und schrumpft.
Somit stellen gesellschaftliche Entwicklungen die Politik – hier im Speziellen die
Arbeitsmarktpolitik – vor neue Herausforderungen: Zum einen vor das Problem einer
überproportionalen Frühverrentung Geringqualifizierter und zum anderen vor das der
Langzeitarbeitslosigkeit. [...] Der Begriff der Arbeitsmarktpolitik bedeutet konkret folgenden Sachverhalt:
„Arbeitsmarktpolitik hat die Gestaltung des unmittelbaren Arbeitsmarktgeschehens und seiner
Rahmenbedingungen zum Gegenstand.“ Weiter ist sie vorrangig Aufgabe des Staates, der
dem Anspruch gerecht zu werden versucht, durch quantitative wie qualitative Beeinflussung
des Arbeitsmarktes (z.B. Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften) kompensatorische
Effekte auf dem Markt zu fördern und der Entstehung von Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken
resp. vorhandene abzubauen. Es stehen aber auch verbesserte Beschäftigungsmöglichkeiten
für Arbeitssuchende im Vordergrund der aufgestellten Ziele. Es ist zu unterscheiden zwischen aktiven und passiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik:
Passive Arbeitsmarktpolitik dient der materiellen Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit,
aktive Arbeitsmarktpolitik zielt hingegen mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf die
Beseitigung von Ungleichgewichten am Arbeitsmarkt ab. Unter aktive Maßnahmen sind
Instrumente wie z.B. Entgeltsicherung, Eingliederungszuschuss oder Förderung der
Weiterbildung zu subsumieren, wohingegen unter passive Maßnahmen z.B. Altersteilzeit,
Anhebung des Renteneintrittsalters als auch die Verringerung der maximalen Dauer des
Anspruchs auf Arbeitslosengeld fallen. Da aktive Instrumente die passiven im Laufe der Zeit
zurückdrängen scheinen, ergibt sich somit die Momentaufnahme, dass sich die jüngeren
Reformen der Arbeitsmarktpolitik am Leitbild der „Aktivierung“ orientieren – insbesondere
am Primat des „Förderns und Forderns“ – und diese sich daher als bedeutungsvoller im
Vergleich zu den passiven Maßnahmen für diese Arbeit auszeichnen. Aufgrund dessen stehen
aktive Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik für Ältere in Deutschland im Zentrum dieser
Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Gegenstand
- 2. Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland
- 3. Situation Älterer auf dem deutschen Arbeitsmarkt
- 3.1. Alterstypisches Qualifikationsrisiko
- 3.2. Alterstypisches Krankheitsrisiko
- 3.3. Alterstypisches Motivationsrisiko
- 3.4. Betriebliche Nachfrage nach Älteren
- 4. Instrumente der Arbeitsmarktpolitik
- 4.1. Qualifizierung
- 4.2. Beschäftigung begleitende Maßnahmen
- 4.3. Beschäftigung schaffende Maßnahmen
- 5. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation älterer Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt und analysiert die Wirksamkeit aktiver Arbeitsmarktpolitik zur Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die mit dem demografischen Wandel und dem steigenden Anteil älterer Arbeitskräfte verbunden sind.
- Herausforderungen für ältere Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt
- Entwicklung und Paradigmenwechsel der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland
- Wirkungsweise aktiver Arbeitsmarktpolitischer Instrumente für ältere Arbeitnehmer
- Alterstypische Risiken im Hinblick auf Qualifikation, Krankheit und Motivation
- Betriebliche Nachfrage nach älteren Arbeitnehmern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung und Gegenstand Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Arbeitsmarktpolitik. Das Problem der Frühverrentung und Langzeitarbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer wird als Ausgangspunkt der Arbeit genannt.
Kapitel 2: Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland Dieses Kapitel beleuchtet die paradigmatischen Veränderungen der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, insbesondere die Verschiebung von passiven zu aktiven Maßnahmen und die damit verbundenen Zielsetzungen.
Kapitel 3: Situation Älterer auf dem deutschen Arbeitsmarkt Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Herausforderungen, denen ältere Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt gegenüberstehen. Es werden alterstypische Risiken in Bezug auf Qualifikation, Krankheit und Motivation erörtert, sowie die betriebliche Nachfrage nach älteren Arbeitskräften betrachtet. Der Abschnitt zu alterstypischen Krankheitsrisiken wird behandelt, wobei der Fokus auf die oft irrige Annahme liegt, dass biologische Alterungsprozesse die Hauptursache für Krankheiten sind.
Schlüsselwörter
Aktive Arbeitsmarktpolitik, Ältere Arbeitnehmer, demografischer Wandel, Qualifikationsrisiko, Krankheitsrisiko, Motivationsrisiko, Arbeitslosigkeit, Frühverrentung, Beschäftigung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel aktiver Arbeitsmarktpolitik für Ältere?
Ziel ist die Beseitigung von Ungleichgewichten am Arbeitsmarkt durch Maßnahmen wie Qualifizierung und Eingliederungszuschüsse, um Langzeitarbeitslosigkeit und Frühverrentung entgegenzuwirken.
Welche Risiken haben ältere Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt?
Die Arbeit identifiziert vier Hauptrisiken: das Qualifikationsrisiko (veraltetes Wissen), das Krankheitsrisiko, das Motivationsrisiko und eine sinkende betriebliche Nachfrage.
Was unterscheidet aktive von passiver Arbeitsmarktpolitik?
Passive Maßnahmen dienen der materiellen Absicherung (z.B. Arbeitslosengeld), während aktive Maßnahmen (z.B. Weiterbildung) darauf abzielen, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen.
Wie wirkt sich der demografische Wandel aus?
Durch die Zunahme älterer und die Abnahme jüngerer Menschen muss die Politik neue Strategien entwickeln, um das Arbeitskräftepotenzial der Älteren länger und effektiver zu nutzen.
Was bedeutet das Prinzip „Fördern und Fordern“?
Es ist das Leitbild moderner Reformen, bei dem staatliche Unterstützung (Fördern) an die Eigeninitiative und Verpflichtungen des Arbeitslosen (Fordern) geknüpft wird.
- Arbeit zitieren
- Marcus Gießmann (Autor:in), 2008, Aktive Arbeitsmarktpolitik für Ältere, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125278