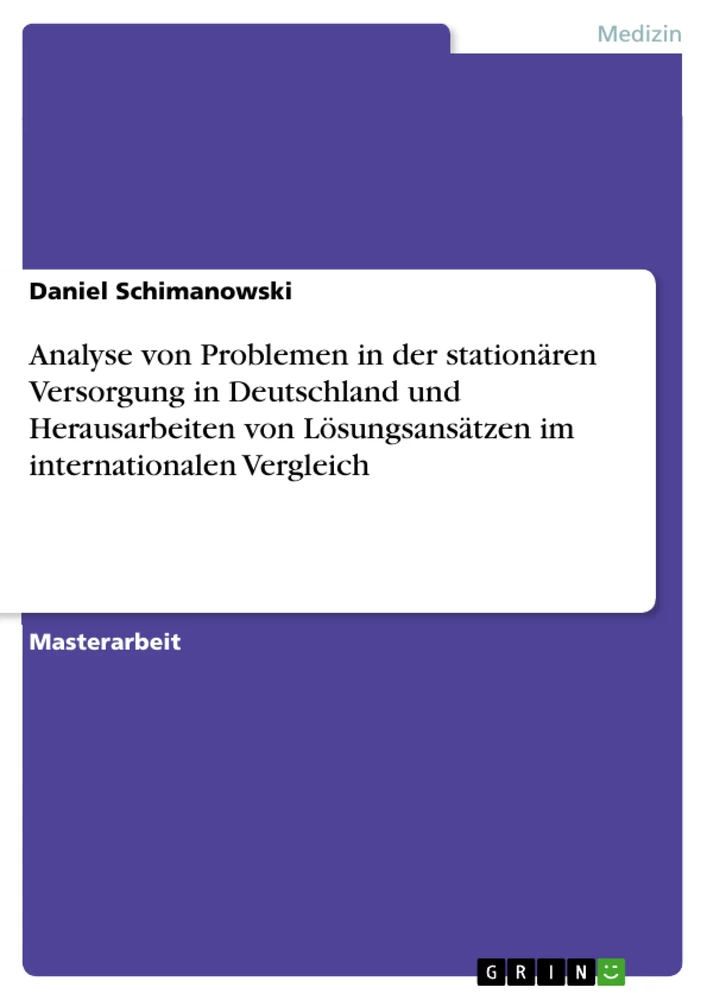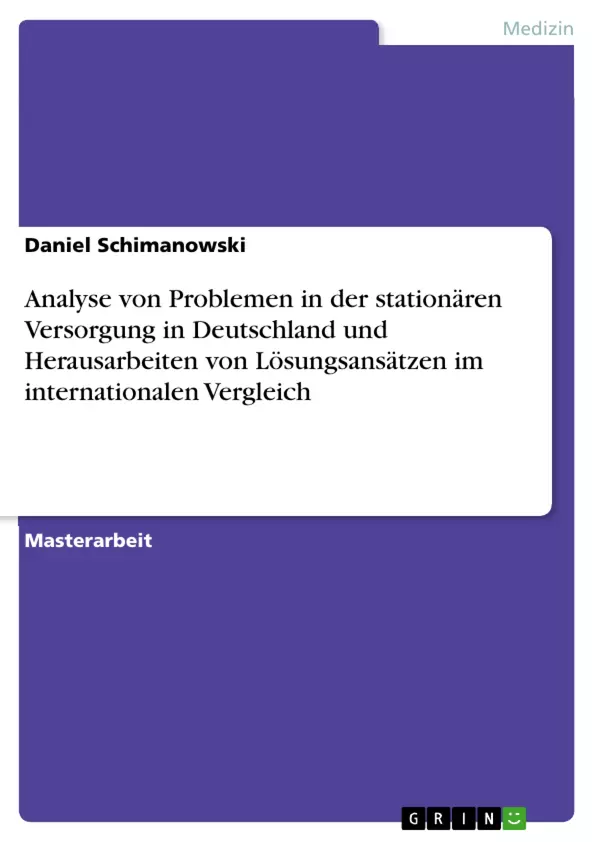Ziel der Arbeit ist es, die in der stationären Versorgung in Deutschland bestehenden Probleme herauszuarbeiten und einen internationalen Vergleichsrahmen zu erstellen. Darauf aufbauend sollen die Daten analysiert werden, um Handlungsempfehlungen zu treffen und Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das deutsche Gesundheitssystem erfreut sich im internationalen Vergleich eines guten Ansehens. Auch die Statistik belegt die hohe Relevanz, die diesem Sektor in Deutschland beigemessen wird. So fließen 11,2 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in das Gesundheitswesen, was EU-weit den größten Anteil entspricht.
Die Lebenserwartung liegt im Vergleich zur Schweiz um 2,3 Jahre zurück. Das fanden Harvard-Wissenschaftler in einer Untersuchung von elf OECD Ländern heraus. Allerdings werden die eingesetzten Mittel oftmals nicht effizient genutzt und die erhaltene Versorgungsqualität ist bisweilen mangelhaft. Das deutsche Gesundheitssystem leidet unter einer Vielzahl von, oftmals auch überflüssigen Operationen, zu häufigen Untersuchungen, zu vielen verfügbaren Krankenhausbetten (Überkapazitäten), vielen wahrgenommenen Arztbesuchen, Schnittstellenproblemen zwischen den einzelnen Sektoren und dem Pflegenotstand.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Das deutsche Gesundheitssystem
- 3.1.1 Die Geschichte des deutschen Gesundheitssystems
- 3.1.2 Das Sozialversicherungssystem in Deutschland
- 3.1.3 Grundprinzipien der sozialen Sicherung
- 3.1.3.1 Solidarprinzip
- 3.1.3.2 Subsidiaritätsprinzip
- 3.1.3.3 Bedarfsdeckungsprinzip
- 3.1.3.4 Sachleistungsprinzip
- 3.1.3.5 Versicherungspflicht
- 3.1.3.6 Selbstverwaltung
- 3.1.4 Grundstrukturen des deutschen Gesundheitssystems
- 3.1.4.1 Regulierung
- 3.1.4.2 Finanzierung
- 3.1.4.3 Leistungserbringung
- 3.1.4.4 Zusammenspiel von Regulierung, Finanzierung und Leistungserbringung
- 3.1.5 Gesetzliche und private Krankenversicherung
- 3.1.6 Das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich
- 3.2 Die stationäre Krankenhausversorgung in Deutschland
- 3.2.1 Das System der stationären Versorgung
- 3.2.2 Strukturdaten
- 3.2.2.1 Finanzierungsträger
- 3.2.2.2 Aufgaben
- 3.2.3 Basisdaten
- 3.2.3.1 Krankenhäuser und Betten
- 3.2.3.2 Leistungen
- 3.2.3.3 Personal
- 3.2.3.4 Ausgaben
- 3.2.4 Organisation
- 3.2.4.1 Krankenhausbehandlung
- 3.2.4.2 Krankenhausplanung
- 3.2.5 Kosten und Finanzierung
- 3.2.5.1 Kosten
- 3.2.5.2 Finanzierung
- 3.2.6 Das deutsche DRG-Fallpauschalensystem
- 3.2.6.1 Budgetverhandlungen
- 3.3 Problempunkte der stationären Versorgung in Deutschland
- 3.1 Das deutsche Gesundheitssystem
- 4 Methodik
- 4.1 Grundlagen und Möglichkeiten des Vergleichs von Gesundheitssystemen
- 4.1.1 OECD Health Data
- 4.1.2 Commonwealth Fund
- 4.1.3 European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC)
- 4.1.4 Eurobarometer der EU Kommission
- 4.2 Erstellung des Vergleichsrahmens
- 4.3 Vorgehen bei der Auswahl der Vergleichsstrukturen
- 4.4 Datenerhebung
- 4.1 Grundlagen und Möglichkeiten des Vergleichs von Gesundheitssystemen
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Darstellung der Ergebnisse im Rahmen des Datenvergleichs
- 6 Diskussion
- 6.1 Diskussion der Methodik
- 6.2 Diskussion der Ergebnisse
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert Probleme der stationären Gesundheitsversorgung in Deutschland und untersucht im internationalen Vergleich mögliche Lösungsansätze. Das Ziel ist es, Schwachstellen des deutschen Systems aufzuzeigen und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.
- Analyse der Kostenstrukturen im deutschen Gesundheitssystem
- Bewertung des Personalschlüssels und des Personalmangels im Gesundheitswesen
- Untersuchung der Effizienz der stationären Versorgung
- Auswertung internationaler Vergleichsdaten zu Gesundheitssystemen
- Identifikation von Lösungsansätzen zur Verbesserung der stationären Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung präsentiert eine Übersicht über das deutsche Gesundheitssystem, welches trotz guter internationaler Bewertung Ineffizienzen und Qualitätsmängel aufweist. Hervorgehoben werden hohe Kosten, Überkapazitäten an Krankenhausbetten und Schnittstellenprobleme. Die Arbeit fokussiert auf die Analyse dieser Probleme und die Suche nach Lösungsansätzen im internationalen Vergleich.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das deutsche Gesundheitssystem, seine Geschichte, Grundprinzipien (Solidarität, Subsidiarität etc.), Finanzierung, und Leistungserbringung. Es analysiert die Strukturen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung und vergleicht das deutsche System mit anderen internationalen Gesundheitssystemen. Ein Schwerpunkt liegt auf der stationären Krankenhausversorgung, einschließlich Strukturdaten, Basisdaten (Krankenhäuser, Betten, Personal, Ausgaben), Organisation, Kosten und Finanzierung, sowie dem DRG-System. Die Kapitelteile 3.2 und 3.3 bilden den Kern der Analyse und beschreiben detailliert die Probleme der stationären Versorgung, u.a. hohe Ausgaben, Personalmangel, Überlastung und Schnittstellenprobleme.
4 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Es werden die verwendeten Datenquellen (OECD Health Data, Commonwealth Fund, ECDC, Eurobarometer) und das Vorgehen bei der Auswahl von Vergleichsstrukturen erläutert. Das Kapitel detailliert den methodischen Ansatz zum Vergleich verschiedener Gesundheitssysteme.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse des Datenvergleichs, aufbauend auf der beschriebenen Methodik.
Schlüsselwörter
Stationäre Versorgung, Gesundheitssystem Deutschland, Internationaler Vergleich, Kosten, Personalmangel, Effizienz, DRG, Gesundheitsausgaben, Krankenhausplanung, Qualität der Versorgung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Analyse der stationären Gesundheitsversorgung in Deutschland im internationalen Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit analysiert Probleme der stationären Gesundheitsversorgung in Deutschland und untersucht im internationalen Vergleich mögliche Lösungsansätze. Schwerpunkte sind die hohen Kosten, der Personalmangel, Überkapazitäten und Ineffizienzen im System.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand (mit detaillierter Beschreibung des deutschen Gesundheitssystems und der stationären Versorgung), Methodik (einschließlich der verwendeten Datenquellen wie OECD Health Data, Commonwealth Fund, ECDC und Eurobarometer), Ergebnisse des Datenvergleichs, Diskussion der Methodik und Ergebnisse sowie eine Zusammenfassung.
Welche Aspekte des deutschen Gesundheitssystems werden behandelt?
Die Arbeit behandelt umfassend das deutsche Gesundheitssystem, einschließlich seiner Geschichte, Grundprinzipien (Solidarität, Subsidiarität etc.), Finanzierung, Leistungserbringung, gesetzlicher und privater Krankenversicherung und einen detaillierten Blick auf die stationäre Krankenhausversorgung (Strukturdaten, Basisdaten, Organisation, Kosten, Finanzierung und das DRG-System).
Welche Probleme der stationären Versorgung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere hohe Kosten, Personalmangel, Überlastung, Schnittstellenprobleme und Ineffizienzen in der stationären Versorgung in Deutschland.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik umfasst den Vergleich verschiedener Gesundheitssysteme basierend auf Daten aus OECD Health Data, Commonwealth Fund, ECDC und Eurobarometer. Die Arbeit beschreibt detailliert das Vorgehen bei der Auswahl von Vergleichsstrukturen und der Datenerhebung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse des internationalen Datenvergleichs, basierend auf der beschriebenen Methodik. Die konkreten Ergebnisse werden in der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stationäre Versorgung, Gesundheitssystem Deutschland, Internationaler Vergleich, Kosten, Personalmangel, Effizienz, DRG, Gesundheitsausgaben, Krankenhausplanung, Qualität der Versorgung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Aufdeckung von Schwachstellen im deutschen Gesundheitssystem und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten durch den internationalen Vergleich. Die Arbeit analysiert Kostenstrukturen, den Personalschlüssel, die Effizienz der stationären Versorgung und identifiziert Lösungsansätze.
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist detailliert und hierarchisch aufgebaut, beginnend mit einer Einleitung und Problemstellung, gefolgt von der Zielsetzung, dem gegenwärtigen Kenntnisstand (unterteilt in das deutsche Gesundheitssystem und die stationäre Krankenhausversorgung), der Methodik, den Ergebnissen, der Diskussion und der Zusammenfassung. Es verwendet eine tiefgreifende Gliederung mit mehreren Ebenen.
- Citar trabajo
- Daniel Schimanowski (Autor), 2018, Analyse von Problemen in der stationären Versorgung in Deutschland und Herausarbeiten von Lösungsansätzen im internationalen Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1252919