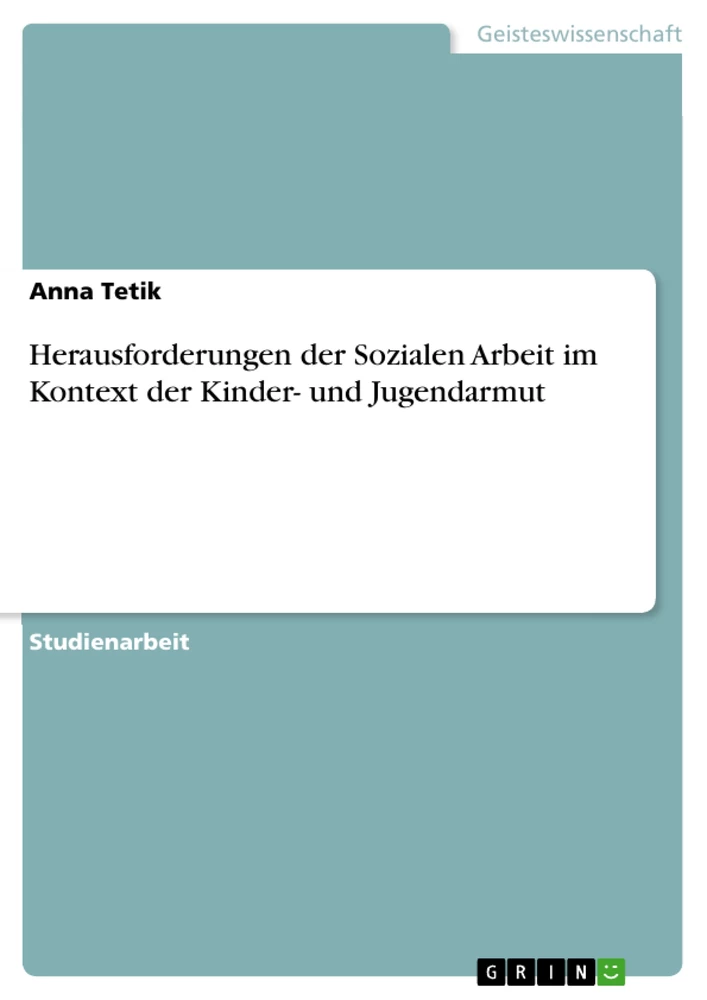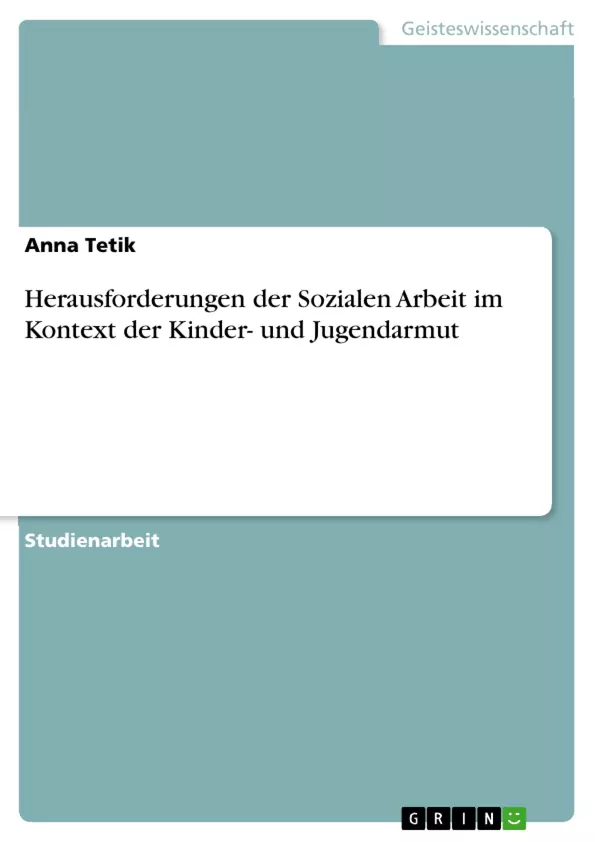Die vorliegende Studienarbeit behandelt die Herausforderungen der Sozialen Arbeit in Bezug auf Kinder und Jugendarmut. Hierbei werden vorerst die Hauptbegriffe Armut und Kinderarmut definiert und deren Zusammenhänge deutlich gemacht. Um den Rahmen der Studienarbeit beizubehalten werden nur zwei der vielen unterschiedlichen Armutsrisikogruppen vorgestellt und näher erläutert. Der Fokus wurde auf Familien mit Migrationshintergrund und arme Erwerbstätige gelegt. Bei der Betrachtung von familiärer Armut, in Bezug auf Kinder und Jugendliche, wird auf deren Auswirkungen auf die Bereiche Gesundheit, Sicherheit und Bildung eingegangen. Auch die damit einhergehenden eingeschränkten Teilhabe- und Chancenmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen werden aufgegriffen. Abschließend wird auf den wissenschaftlichen Diskurs der Herausforderungen der jeweiligen zuständigen Fachdisziplinen sowie deren Handlungsfelder. Der Schwerpunkt wird hierbei auf die Soziale Arbeit sowie auf die Betrachtung und Überprüfung der Existenz von Interdisziplinarität und Netzwerkarbeit zwischen den verschiedenen zuständigen Disziplinen im Bereich der Kinder und Jugendarmut gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinitionen
- 2.1 Allgemeine Begriffsdefinitionen von Armut
- 2.2 Begriffsdefinition in Bezug auf Kinderarmut
- 3 Armutsrisikogruppen
- 3.1 Familien mit Migrationshintergrund
- 3.2 Arme Erwerbstätige
- 4 Auswirkungen von familiärer Armut auf Kinder und Jugendliche
- 4.1 Gesundheit und Sicherheit
- 4.2 Bildung
- 5 Herausforderungen der Sozialen Arbeit
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit untersucht die Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendarmut. Sie beleuchtet die Definitionen von Armut und Kinderarmut, analysiert ausgewählte Armutsrisikogruppen und untersucht die Auswirkungen familiärer Armut auf Kinder und Jugendliche in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Bildung.
- Definitionen von Armut und Kinderarmut
- Analyse von Armutsrisikogruppen (z.B. Familien mit Migrationshintergrund, arme Erwerbstätige)
- Auswirkungen von familiärer Armut auf Kinder und Jugendliche
- Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendarmut
- Diskussion von Handlungsfeldern und interdisziplinären Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Kinder- und Jugendarmut für die Soziale Arbeit heraus. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe Armut und Kinderarmut definiert und in ihren Kontext gesetzt. Kapitel 3 befasst sich mit zwei ausgewählten Armutsrisikogruppen: Familien mit Migrationshintergrund und arme Erwerbstätige. Kapitel 4 analysiert die Auswirkungen von familiärer Armut auf Kinder und Jugendliche in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Bildung. Abschließend widmet sich Kapitel 5 den Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendarmut und diskutiert Handlungsfelder und interdisziplinäre Ansätze.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Jugendarmut, Soziale Arbeit, Armutsrisikogruppen, Familien mit Migrationshintergrund, arme Erwerbstätige, Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Teilhabe, Chancen, Handlungsfelder, Interdisziplinarität, Netzwerkarbeit
Häufig gestellte Fragen
Welche Gruppen sind in Deutschland besonders von Armut bedroht?
Besonders betroffen sind Familien mit Migrationshintergrund, arme Erwerbstätige (Working Poor) sowie Alleinerziehende.
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die Gesundheit aus?
Armut führt oft zu schlechterer Ernährung, eingeschränktem Zugang zu Sportangeboten und einer höheren psychischen Belastung, was die körperliche und seelische Entwicklung beeinträchtigt.
Welchen Einfluss hat Armut auf die Bildungschancen?
Kinder aus armen Familien haben oft weniger Zugang zu Lernmaterialien oder außerschulischer Förderung, was zu geringeren Teilhabe- und Aufstiegschancen führt.
Was sind die Herausforderungen für die Soziale Arbeit bei Kinderarmut?
Die Soziale Arbeit muss interdisziplinär agieren, Netzwerke zwischen Schulen, Ämtern und Gesundheitswesen knüpfen und präventive Angebote schaffen.
Was versteht man unter dem Begriff "Working Poor"?
Es bezeichnet Menschen, die trotz einer Erwerbstätigkeit über ein Einkommen verfügen, das unter der Armutsgrenze liegt und somit keine soziale Sicherheit bietet.
- Quote paper
- Anna Tetik (Author), 2020, Herausforderungen der Sozialen Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendarmut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1253018