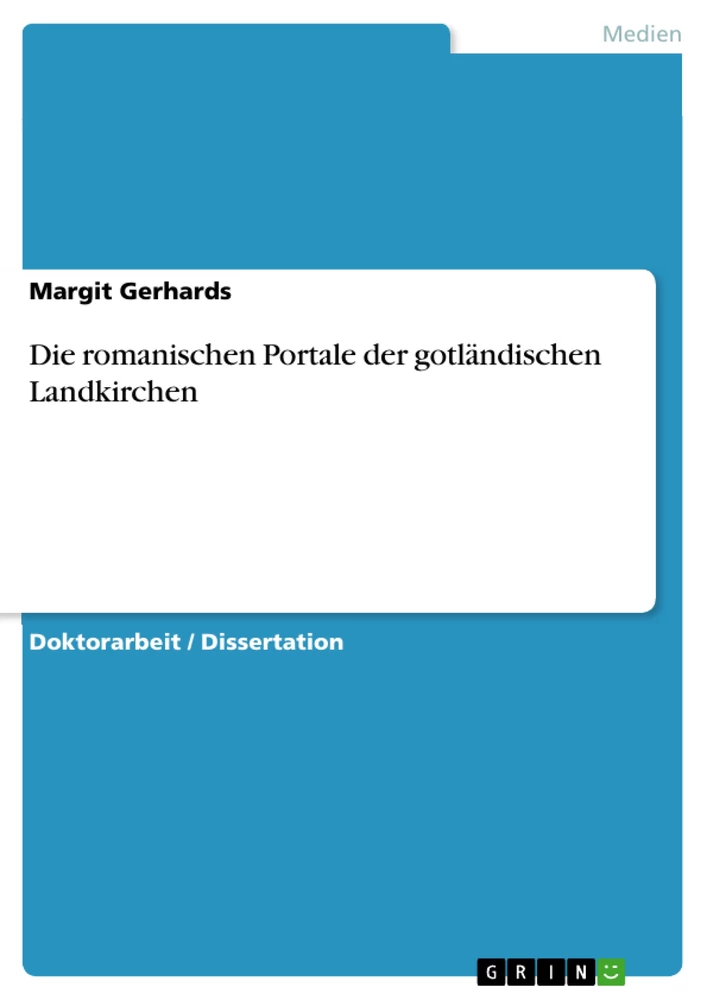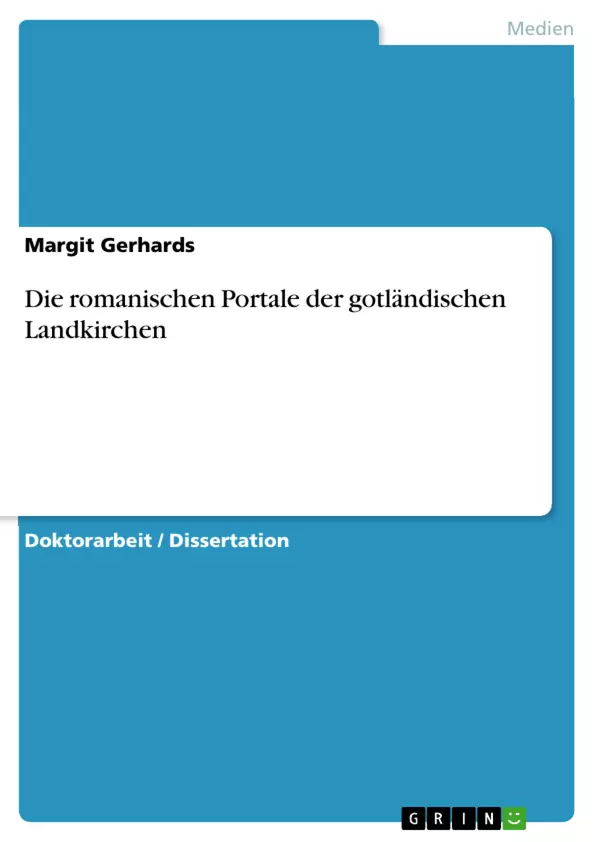Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile auf. Der erste allgemeine Teil erläutert den geschichtlichen und kirchenhistorischen Hintergrund des gotländischen Mittelalters. Weiterhin wird die allgemeine Baugeschichte der Landkirchen mit einigen gotländischen Eigentümlichkeiten behandelt. Ein Kapitel ist den einzelnen Portalarten und deren Bedeutung gewidmet, zwei Kapitel befassen sich mit ikonographischen und stilgeschichtlichen Hintergründen und Besonderheiten sowie internationalen Vergleichen. Eine erstmalige Zusammenstellung, detaillierte Beschreibung und Einordnung aller mittelalterlichen Portale von Gotlands Landkirchen bildet im zweiten Teil den Kernpunkt dieser Arbeit. Zur Übersicht erfolgt dies in Form eines ausführlichen Katalogs, in alphabetischer Reihenfolge der Ortsnamen geordnet.
Für jedes Portal wurden folgende Inhalte erarbeitet: Position, Datierung, Material, Maßangaben, Foto, Aufbau im Detail, kurze Einordnung oder Vergleich mit anderen Portalen der Landkirchen, Fotos von wichtigen Details oder Vergleichen. Um der umfangreichen Materialfülle eine schnelle Übersichtsmöglichkeit zu geben, ist dem Katalog eine tabellarische Aufstellung aller Kirchenportale vorangestellt. In Katalog und Tabelle findet jedes gegenwärtige oder ehemalige Außenportal der gotländischen Landkirchen Berücksichtigung.
Die schwedische Insel Gotland befindet sich in strategisch günstiger Lage mitten in der Ostsee und stellt mit einer Fläche von 3140 Quadratkilometern zugleich die größte Insel im Baltikum dar. Gute Einnahmen aus Handel und Landwirtschaft ermöglichten ab etwa 1140 bis 1360 den kostspieligen Bau von über 100 Steinkirchen. Oftmals wurden nach nur etwa 50 bis 60 Jahren die romanischen Kirchen durch gotische Neubauten ersetzt, weil man es sich leisten konnte. Diese intensive Kirchenbauphase dauerte insgesamt etwa 200 Jahre an und wurde dann durch ein Kriegsereignis unvermittelt zum Erliegen gebracht. Aufgrund der großen Anzahl der Kirchen ergibt sich eine außerordentliche, kunsthistorisch hochinteressante Materialfülle in geographisch isoliertem Raum. Einen besonders augenfälligen Aspekt stellen die Kirchenportale dar. Vor allem überrascht die Anzahl der Eingänge, selbst die kleinste Kirche verfügt über mindestens drei, oftmals vier Außenportale. Die genaue Untersuchung beschränkt sich auf die romanischen Portale. Die gotischen Portale finden der Vollständigkeit halber in dieser Arbeit ebenfalls Berücksichtigung.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Hintergrund und Zielsetzung
- Forschungsstand
- Gotländische Landkirchen im Mittelalter
- Historischer Hintergrund
- Die Christianisierung Schwedens
- Die Christianisierung Gotlands
- Kirchenhistorischer Hintergrund
- Die Christianisierung Schwedens
- Die Christianisierung Schwedens
- Die Christianisierung Gotlands
- Die Christianisierung Gotlands
- Die Christianisierung Gotlands
- Baugeschichte der Landkirchen
- Holzkirchen
- Romanische Steinkirchen
- Der zisterziensische Einfluß
- Gotländische Spezifika
- Patrozinien und Konsekrationen
- Die gotländischen Taufsteine
- Labyrinthe auf Gotland
- Kastale
- Gebetskammern
- Der zisterziensische Einfluß
- Gotländische Spezifika
- Patrozinien und Konsekrationen
- Die gotländischen Taufsteine
- Labyrinthe auf Gotland
- Kastale
- Gebetskammern
- Bedeutung und ikonographische Aussage des mittelalterlichen Kirchenportals
- Romanische Portale Gotlands - Allgemeine Anmerkungen
- Die verschiedenen Portale
- Chorportale - Brautportale - Priesterportale?
- Südliche Langhausportale - Kennzeichen der Schaufassade
- Nordportale - Frauenportale?
- Turmportale - Nebeneingänge
- Sakristeiportale und weitere Spolienportale
- Ikonographische Aussagen
- Fardhems Chorportal
- Nordportal und Sakristeiportal in Väte
- Tympanon des Sakristeiportals von Lärbro
- Calcarius oder Globus
- Lombardische Einflüsse im Norden und Hablingbos Nordportal
- Gotland und Dänemark
- Relationen zwischen Gotland und dem Rheinland, Westfalen und Sachsen
- Adlerkapitelle
- Tropfen oder Nasen
- Gotland und Öland
- Gotland und Estland
- Gotland und Rußland
- Gotland, eine Architektur- und Kunstlandschaft?
- Portale der gotländischen Landkirschen - tabellarische Aufstellungen
- Tabelle 1: Portale der gotländlischen Landkirchen - tabellarische Aufstellung
- Tabelle 2: Spolienportale: Auflistung in tabellarischer Form
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit widmet sich der umfassenden Untersuchung aller romanischen Portale an gotländischen Landkirchen aus der Zeit zwischen 1140 und 1360. Dabei werden die Portale in ihren verschiedenen Positionen und Funktionen untersucht, um so zu einem tieferen Verständnis ihrer Bedeutung im Kontext des gotländischen Kirchenbaus zu gelangen. Die Arbeit beleuchtet zudem die internationale Vernetzung gotländischer Steinskulptur und zeichnet die komplexen Einflüsse aus Skåne, Dänemark, Italien, Westfalen und Rußland nach. Die Arbeit wird unterstützt durch eine ausführliche Katalogisierung aller mittelalterlichen Kirchenportale der Insel Gotland und durch zwei tabellarische Übersichtstabellen.
- Die Bedeutung der gotländischen Landkirchenportale als architektonische Elemente und ihre Funktionen im Kirchenbau.
- Die Entwicklung der gotländischen Kirchenportale in der Zeit der Romanik und Gotik.
- Die internationalen Einflüsse auf die gotländische Steinskulptur mit besonderem Augenmerk auf die lombardische Romanik und byzantinische Kunst.
- Die Bedeutung der gotländischen Landkirchen im Kontext der regionalen und überregionalen Kulturlandschaft.
- Die Verwendung von Spolien in der gotländischen Architektur und ihre Bedeutung für die Erhaltung des mittelalterlichen Kulturerbes.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel dieser Arbeit erläutert den historischen Hintergrund der gotländischen Landkirchen. Die Beschreibung der schwedischen Insel Gotland setzt mit dem Hinweis auf ihre strategisch günstige Position mitten in der Ostsee an und beleuchtet die intensive agrarwirtschaftliche Nutzung der Insel sowie den Handel und die Entstehung einer großen Anzahl von Kirchen. Das Kapitel beleuchtet den Übergang der Gotländer zum Christentum und die sich daraus entwickelnde Kirchenorganisation, insbesondere die Entstehung von Kirchenspielen. Die Beschreibung der Kirchenbauphase endet mit der dänischen Eroberung Gotlands im Jahr 1361, einem Ereignis, das einen tiefgreifenden Einschnitt in die gotländische Geschichte und Kultur darstellte.
Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung der gotländischen Kirchenportale im umfassenden Kontext der Architekturlandschaft der Insel beleuchtet. Die allgemeine Bedeutung des Kirchenportals als Übergangsbereich zwischen Sakralem und Profanem wird zunächst erläutert. Dann werden die verschiedenen Formen der Kirchenportale mit ihren ikonographischen Aussagen, ihrer Bedeutung für die Architekturgeschichte der Landkirchen und der internationalen Einflüsse auf die gotländische Steinskulptur dargestellt.
Das dritte Kapitel behandelt die Baugeschichte der gotländischen Landkirchen, beginnend mit der Zeit der Holzkirchen. Der Übergang zu steinernen Kirchenbauten wird beschrieben, die unterschiedlichen Bauphasen werden erläutert und die Besonderheiten der gotländischen Baukunst werden mit Hilfe von spezifischen Beispielen hervorgehoben. Im Zusammenhang mit den Kirchenportalen werden die Spolienportale und ihr Vorkommen in der gotländischen Architektur detailliert untersucht. Der Fokus des Kapitels liegt auf der Bedeutung von Gotland als Zentrum der mittelalterlichen Kirchenarchitektur und -kunst im Ostseeraum.
Im vierten Kapitel werden ausgewählte Kirchenportale im Kontext der Ikonographie behandelt. Die Bedeutung der Darstellungen auf Kapitellen und Tympana für das Verständnis der mittelalterlichen Symbolsprache wird mit Hilfe von Beispielen aus der deutschen Romanik und dem byzantinischen Raum erläutert. In diesem Zusammenhang werden die engen Beziehungen zwischen Gotland und Dänemark, Italien, Westfalen und Rußland deutlich.
Das fünfte Kapitel setzt sich mit der verschwundenen ersten Steinkirche von Väte auseinander, deren Relikte in Form von zwei besonderen Portalen erhalten geblieben sind. Das Nordportal und das Sakristeiportal werden bezüglich ihrer Ikonographie, stilspezifischen Merkmale und ihres Zusammenhangs zu den Taufsteinen einiger gotländischer Kirchen detailliert untersucht. Weitere Beispiele aus dem gotländischen Kontext werden herangezogen, um die Entstehung der Steinskulptur in einem internationalen Kontext zu verorten.
Das sechste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Stileinflüsse auf die gotländische Steinskulptur. Der Fokus liegt dabei auf den lombardischen Einflüssen, die mit der Einrichtung der Dombauhütte in Lund in den Ostseeraum gelangt sind. Die Arbeit verfolgt die Verbreitung lombardischer Motive und Formen in Dänemark und Schweden. Besondere Bedeutung kommt dem Nordportal der Kirche von Hablingbo zu, welches in seiner komplexen Ikonographie den stilistischen Austausch zwischen Gotland und dem übrigen Ostseeraum symbolisiert.
Das siebte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit. Das Kapitel greift die Ergebnisse der Einzelstudien zur Baugeschichte der Kirchenportale und zur Bedeutung der Steinskulptur im internationalen Kontext auf und betont die Rolle Gotlands als eigenständiges Zentrum der mittelalterlichen Architektur und Kunst im Ostseeraum.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Hauptthemen dieser Arbeit umfassen die gotländischen Landkirchenportale und die mittelalterliche Steinskulptur Gotlands in ihren Verbindungen zu den Kulturlandschaften Europas. Diese Themen erschließen sich mit den Schlüsselbegriffen wie Romanik, Gotik, Kirchenportal, Steinskulptur, Ikonographie, Stil, Symbol, Architekturlandschaft, Kunstlandschaft, Lombardische Romanik, Byzantinische Kunst, Gotland, Skåne, Dänemark, Westfalen, Rußland, Calcarius-Werkstatt, Majestatis-Werkstatt, Byzantios-Werkstatt, Globus-Werkstatt, Hegvald, Sigraf, Donatoren, Patrozinien, Asylkirche, Gebetskammer, Hagioskop, Spolien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an den romanischen Portalen auf Gotland?
Gotland besitzt eine außergewöhnliche Dichte an mittelalterlichen Steinkirchen mit kunstvoll skulptierten Portalen, die Einflüsse aus ganz Europa (Italien, Deutschland, Russland) vereinen.
Welche Funktion hatten die verschiedenen Portale einer Kirche?
Es gab spezialisierte Eingänge wie Chorportale (oft für Priester), Südportale (Hauptschaufassaden) und Nordportale, die traditionell oft als Fraueneingänge galten.
Welche internationalen Stileinflüsse finden sich in der gotländischen Steinskulptur?
Man findet lombardische Romanik, byzantinische Motive sowie deutliche Bezüge zur Architektur im Rheinland, Westfalen und Sachsen.
Was sind Spolienportale?
Spolienportale sind Bauteile älterer Kirchen, die beim Neubau oder Umbau einer Kirche wiederverwendet wurden, oft um Kosten zu sparen oder Traditionen zu bewahren.
Wer waren die bedeutendsten Steinmetz-Werkstätten auf Gotland?
Bekannte Werkstätten und Meister sind unter anderem die von Byzantios, Majestatis, Calcarius sowie die Meister Hegvald und Sigraf.
- Arbeit zitieren
- Margit Gerhards (Autor:in), 2016, Die romanischen Portale der gotländischen Landkirchen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1253056