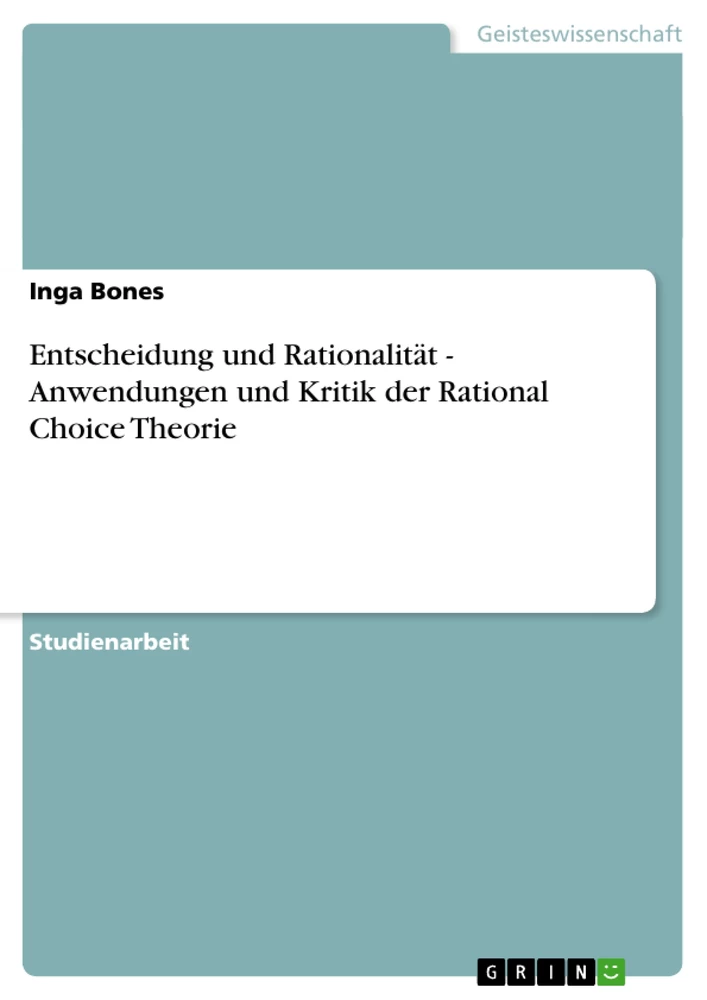Unter einer Handlung versteht man die Umsetzung eines gewollten oder gesollten Zweckes in die Realität. Immer dann, wenn für die Realisierung eines Zieles mehrere Handlungsalternativen zur Wahl stehen, geht der Umsetzung einer Handlung eine Entscheidung für eine bestimmte Handlungsalternative voraus.
Unsere Entscheidungen im Alltag mögen – wie die Wahl zwischen einer Tasse Kaffee oder Tee beim Frühstück – banal erscheinen, oder weitreichende Konsequenzen
nach sich ziehen. Einige Entscheidungen – die Individualentscheidungen – treffen wir alleine, andere – die Kollektiventscheidungen – sind das Ergebnis der Summe aller Entscheidungen der Mitglieder einer Gruppe. Manchmal müssen wir in einem Entscheidungsprozess lediglich die Umwelt berücksichtigen, häufig stehen wir jedoch vor der Aufgabe,
das Entscheidungsverhalten eines rationalen Gegenspielers in unsere Überlegungen einzubeziehen. Selten kennen wir alle möglichen Konsequenzen der Handlungsalternativen, die sich uns bieten; den Großteil unserer Entscheidungen treffen wir vielmehr in Risikosituationen, in denen wir die Konsequenzen unserer Handlungen und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten nur grob abschätzen können. Unter dem Begriff „Entscheidungstheorie“ werden verschiedene interdisziplinäre Forschungsansätze
zusammengefasst, die Entscheidungen unter verschiedenen Gesichtspunkten – einige Aspekte wurden im vorhergehenden Absatz grob umrissen – systematisieren, modellieren und untersuchen. Gegenstand dieser Arbeit ist die Theorie rationaler Entscheidung, eine präskriptive Entscheidungstheorie. Im Gegensatz zu deskriptiven Entscheidungstheorien, deren Hauptanliegen die empirische
Erforschung, Beschreibung und Erklärung realer Entscheidungen ist, wollen präskriptive (oder normative) Theorien in erster Linie „zeigen, wie Entscheidungen „rational“ getroffen werden können.“ Entsprechend stark abstrahieren präskriptive Theorien von der realen Entscheidungssituation; untersucht werden „Grundprobleme [...], die in allen oder
zumindest in zahlreichen Entscheidungssituationen entstehen.“
Einige dieser Grundprobleme werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter Rückgriff auf die Rational Choice Theorie behandelt. Im Vordergrund steht die Frage, wie die Theorie rationaler Entscheidung menschliches Handeln rekonstruiert: Von welchen
Prämissen geht sie aus? Welche Faktoren beeinflussen die Wahl einer bestimmten Handlungsalternative?
Was macht eine Entscheidung zu einer „guten“ Entscheidung?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rational Choice Theorie
- 2.1 Nutzentheorie und SEU-Modell
- 2.2 Individuelles Handeln
- 2.2.1 Entscheidungen ohne rationalen Gegenspieler
- 2.2.2 Entscheidungen mit rationalem Gegenspieler
- 2.3 Kollektives Handeln
- 2.3.1 Klimaschutz und globale Wettbewerbsfähigkeit - ein soziales Dilemma. Kann Kooperation gefördert werden?
- 2.3.2
- 3 Prospect Theory
- 3.1 Abweichungen von den Annahmen der Nutzentheorie
- 3.2 Reale Entscheidungen verstehen und modellieren: Die Neue Erwartungstheorie
- 4 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie rationaler Entscheidungen (Rational Choice Theorie) als präskriptive Entscheidungstheorie. Sie analysiert die zugrundeliegenden Prämissen, Faktoren, die die Wahl einer Handlungsalternative beeinflussen, und Kriterien für eine "gute" Entscheidung. Im Fokus stehen sowohl individuelle als auch kollektive Entscheidungen, letztere am Beispiel sozialer Dilemmata. Die Arbeit beleuchtet auch kritische Aspekte der Rational Choice Theorie und präsentiert alternative Ansätze.
- Analyse der Rational Choice Theorie und ihrer Kernannahmen
- Untersuchung individuellen Handelns mit und ohne rationalen Gegenspieler
- Analyse kollektiven Handelns am Beispiel von sozialen Dilemmata
- Kritik an der Rational Choice Theorie
- Einführung und Erläuterung der Prospect Theory als Alternative
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Entscheidungstheorie ein und definiert den Begriff „Handlung“ im Kontext von Zielsetzung und Handlungsalternativen. Sie hebt die Komplexität von Entscheidungsprozessen hervor, die von banalen bis hin zu weitreichenden Konsequenzen reichen können und sowohl individuelle als auch kollektive Aspekte umfassen. Die Arbeit konzentriert sich auf die präskriptive Theorie rationaler Entscheidung und grenzt diese von deskriptiven Ansätzen ab. Sie kündigt die Behandlung zentraler Grundprobleme der Entscheidungstheorie im Rahmen der Rational Choice Theorie an und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Rational Choice Theorie: Dieses Kapitel analysiert die Rational Choice Theorie (RCT) als interdisziplinären Ansatz zur Erklärung und Modellierung individuellen und sozialen Handelns. Es erläutert die Kernannahmen der RCT, die auf dem methodologischen Individualismus basieren und von zielgerichtetem Handeln, Knappheit und Nutzenmaximierung ausgehen. Das Kapitel untersucht sowohl individuelles Handeln (mit und ohne rationalen Gegenspieler, letzteres unter Verwendung des Gefangenendilemmas als Beispiel) als auch kollektives Handeln, anhand des sozialen Dilemmas von Klimaschutz und globaler Wettbewerbsfähigkeit.
3 Prospect Theory: Kapitel 3 widmet sich der Kritik an der Rational Choice Theorie und stellt die Prospect Theory von Kahneman und Tversky als potenziell realistischere Alternative vor. Der Fokus liegt auf den Abweichungen der Prospect Theory von den Annahmen der Nutzentheorie und der damit verbundenen Möglichkeiten, reale Entscheidungen besser zu verstehen und zu modellieren. Die Neue Erwartungstheorie wird als Weiterentwicklung vorgestellt, welche die Limitationen des klassischen Ansatzes zu beheben versucht.
Schlüsselwörter
Rational Choice Theorie, Entscheidungstheorie, Nutzentheorie, SEU-Modell, Individuelles Handeln, Kollektives Handeln, Soziales Dilemma, Prospect Theory, Nutzenmaximierung, Gefangenendilemma, Knappheit, Präferenzen, methodologischer Individualismus, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Analyse der Rational Choice Theorie
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Rational Choice Theorie (RCT) als präskriptive Entscheidungstheorie. Er analysiert die zugrundeliegenden Annahmen, untersucht individuelles und kollektives Handeln (inkl. sozialer Dilemmata) und beleuchtet kritische Aspekte der RCT. Zusätzlich wird die Prospect Theory als Alternative vorgestellt.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die Rational Choice Theorie, ihre Kernannahmen (Nutzenmaximierung, methodologischer Individualismus), individuelles Handeln (mit und ohne rationalen Gegenspieler), kollektives Handeln (am Beispiel sozialer Dilemmata wie Klimaschutz), Kritik an der RCT und die Prospect Theory als alternatives Entscheidungsmodell. Das SEU-Modell und das Gefangenendilemma werden als Beispiele verwendet.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Rational Choice Theorie, ein Kapitel zur Prospect Theory und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Thematik ein. Das Kapitel zur Rational Choice Theorie analysiert die Theorie, individuelles und kollektives Handeln. Das Kapitel zur Prospect Theory kritisiert die RCT und stellt die Prospect Theory als Alternative vor. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Arbeit untersucht die Rational Choice Theorie, analysiert ihre Prämissen und Faktoren, die die Wahl einer Handlungsalternative beeinflussen. Der Fokus liegt auf individuellen und kollektiven Entscheidungen, insbesondere auf sozialen Dilemmata. Kritische Aspekte der RCT werden beleuchtet und alternative Ansätze, wie die Prospect Theory, vorgestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rational Choice Theorie, Entscheidungstheorie, Nutzentheorie, SEU-Modell, Individuelles Handeln, Kollektives Handeln, Soziales Dilemma, Prospect Theory, Nutzenmaximierung, Gefangenendilemma, Knappheit, Präferenzen, methodologischer Individualismus, Kooperation.
Wie wird die Rational Choice Theorie im Text dargestellt?
Die RCT wird als interdisziplinärer Ansatz zur Erklärung und Modellierung individuellen und sozialen Handelns dargestellt. Ihre Kernannahmen, basierend auf methodologischem Individualismus, zielgerichtetem Handeln, Knappheit und Nutzenmaximierung, werden erläutert. Sowohl individuelles als auch kollektives Handeln wird im Kontext der RCT analysiert.
Welche Kritik an der Rational Choice Theorie wird geübt?
Der Text kritisiert die Rational Choice Theorie und ihre Annahmen. Diese Kritik wird im Kapitel zur Prospect Theory vertieft und führt zur Vorstellung der Prospect Theory als Alternative, die realere Entscheidungsprozesse besser abbilden soll.
Was ist die Prospect Theory und wie unterscheidet sie sich von der Rational Choice Theorie?
Die Prospect Theory von Kahneman und Tversky wird als realistischere Alternative zur RCT vorgestellt. Sie unterscheidet sich in ihren Annahmen zur Nutzentheorie und bietet Möglichkeiten, reale Entscheidungen besser zu verstehen und zu modellieren. Die Neue Erwartungstheorie wird als Weiterentwicklung erwähnt.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) Inga Bones (Author), 2009, Entscheidung und Rationalität - Anwendungen und Kritik der Rational Choice Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125330