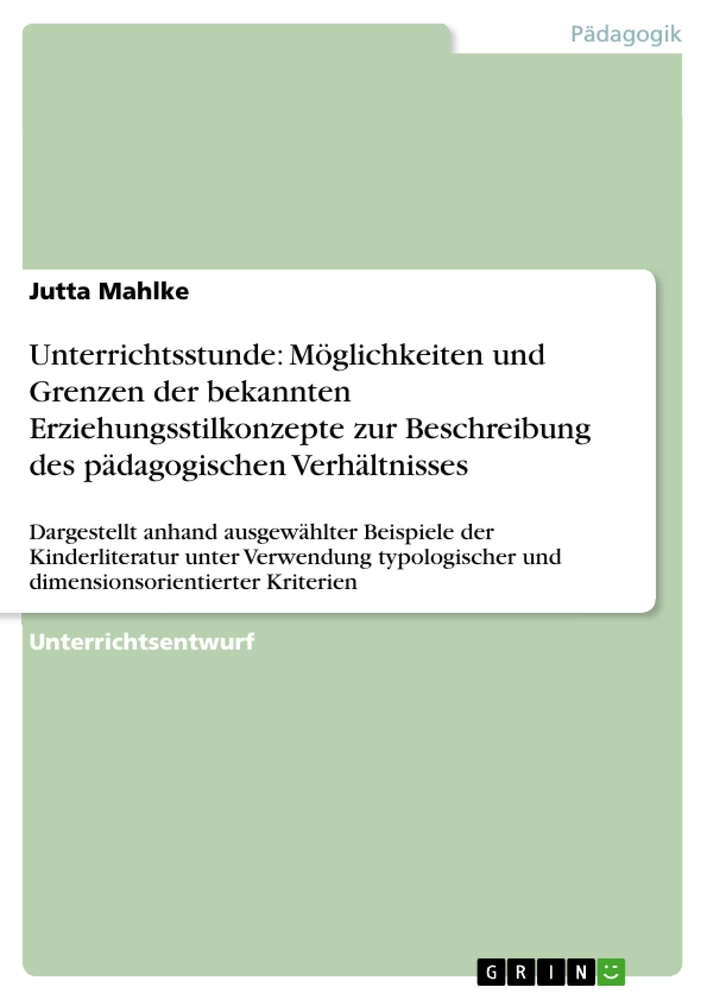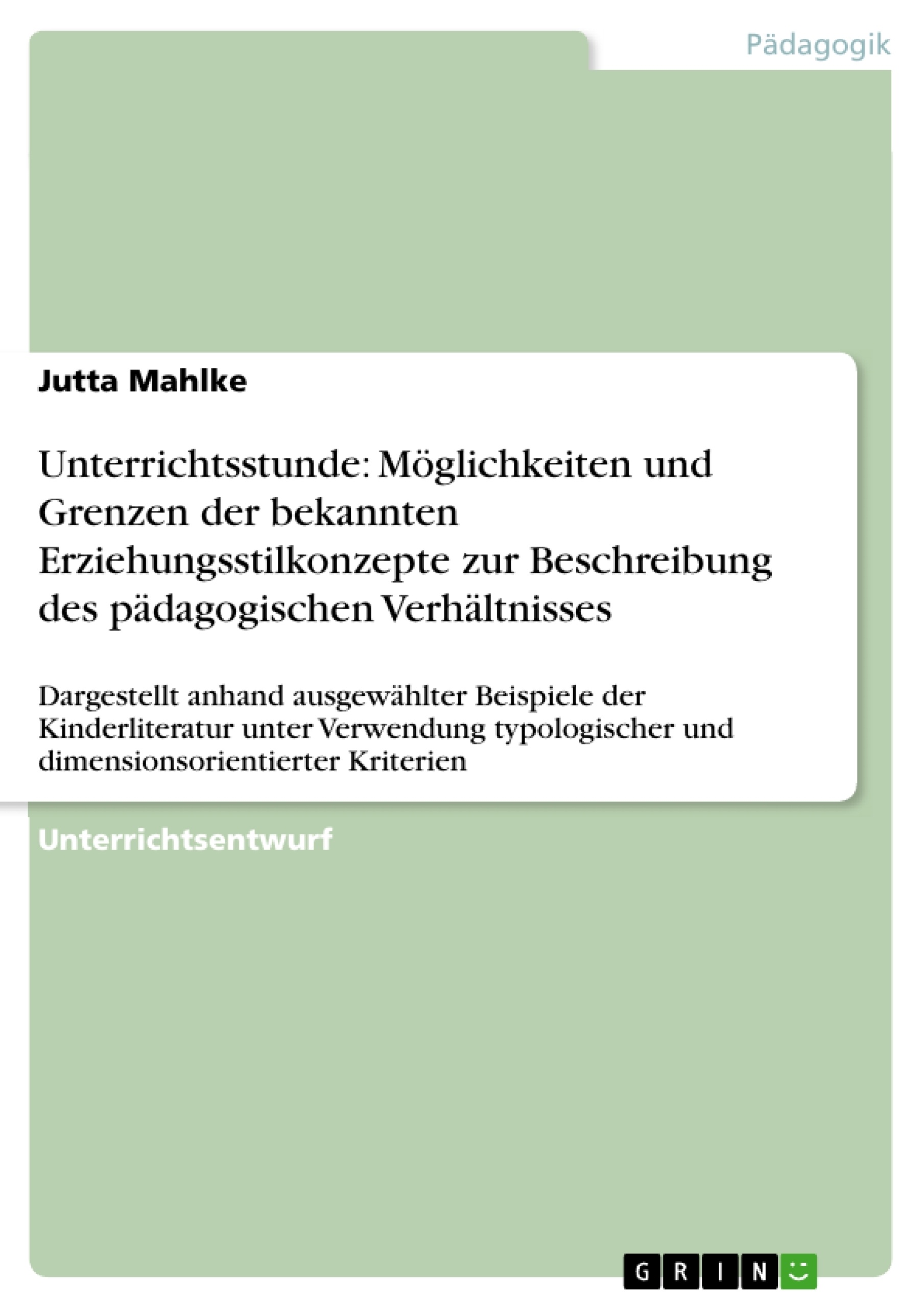Die SuS sollen Möglichkeiten und Grenzen der Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses anhand bekannter typologischer und dimensionsorientierter Konzepte zum Erziehungsstil aufdecken können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thematischer Zusammenhang
- 1.1 Thema des Unterrichtsvorhabens: Das pädagogische Verhältnis
- 1.2 Themen der Einheiten
- 1.2.1 Das pädagogische Verhältnis nach Hermann Nohl am Fallbeispiel des Schülers Werner Heckmann nach W. Klafki im Rollenspiel (2 Std.)
- 1.2.2 Die Bedeutung der Interaktion in der Beziehung als Grundmuster pädagogischen Handelns an einem Fallbeispiel der Supernanny (2 Std.)
- 1.2.3 Erziehungsstile - dimensionsorientierte Konzepte nach Tausch/Tausch und Hurrelmann (2 Std.)
- 1.2.4 Erziehungsstile und ihre Wirkung - Führungsstile und Leiterrollen im typologischen Konzept nach Kurt Lewin (2 Std.)
- 1.2.5 Typologische und dimensionsorientierte Erziehungsstile im Streitgespräch anhand der Plädoyers nach Hurrelmann und Elisabeth C. Gründler (2 Std.)
- 1.2.6 Möglichkeiten und Grenzen der bekannten Erziehungsstilkonzepte zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses anhand ausgewählter Beispiele der Kinderliteratur unter Verwendung typologischer und dimensionsorientierter Kriterien (1 Std.)
- 1.2.7 Klausur
- 1.3 Thema der Stunde: Möglichkeiten und Grenzen der bekannten Erziehungsstilkonzepte zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses anhand ausgewählter Beispiele der Kinderliteratur unter Verwendung typologischer und dimensionsorientierter Kriterien (1 Std.)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Unterrichtseinheit zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern (SuS) ein Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Konzepte zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses zu vermitteln. Die SuS sollen lernen, typologische und dimensionsorientierte Kriterien zur Analyse von Erziehungsstilen anzuwenden und kritisch zu reflektieren.
- Anwendung typologischer Kriterien (Lewin) zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses in Kinderbüchern.
- Anwendung dimensionsorientierter Kriterien (Tausch/Tausch und Hurrelmann) zur Analyse von Erziehungsstilen.
- Erkennen und Beschreiben der Grenzen bekannter Konzepte zur Beschreibung von Erziehungsstilen.
- Analyse des pädagogischen Verhältnisses in ausgewählten Kinderbüchern.
- Kooperative Teamarbeit und Präsentation der Ergebnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thematischer Zusammenhang: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Unterrichtseinheit und skizziert den Gesamtkontext. Es präsentiert das übergeordnete Thema des pädagogischen Verhältnisses und beschreibt die einzelnen Unterrichtseinheiten, die sich mit verschiedenen Aspekten dieses Themas auseinandersetzen, von der Betrachtung nach Hermann Nohl bis hin zur Analyse von Erziehungsstilen nach Lewin und Tausch/Tausch und Hurrelmann. Der Fokus liegt auf der methodischen Herangehensweise, die sowohl typologische als auch dimensionsorientierte Ansätze umfasst und die Anwendung dieser Konzepte auf ausgewählte Kinderbücher beinhaltet. Die einzelnen Unterkapitel bilden einen strukturierten Lernpfad, der die SuS schrittweise an die komplexe Thematik heranführt.
Schlüsselwörter
Pädagogisches Verhältnis, Erziehungsstile, Typologie, Dimensionsorientierung, Kurt Lewin, Tausch/Tausch, Hurrelmann, Kinderliteratur, Analysemethoden, Grenzen von Konzepten.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsvorhaben: Das pädagogische Verhältnis
Was ist das Thema des Unterrichtsvorhabens?
Das übergeordnete Thema des Unterrichtsvorhabens ist das pädagogische Verhältnis. Es werden verschiedene Konzepte und Ansätze zur Beschreibung und Analyse dieses Verhältnisses behandelt.
Welche Themen werden in den einzelnen Unterrichtseinheiten behandelt?
Die Unterrichtseinheiten befassen sich mit verschiedenen Aspekten des pädagogischen Verhältnisses. Dies beinhaltet das pädagogische Verhältnis nach Hermann Nohl, die Bedeutung der Interaktion, verschiedene Erziehungsstile (dimensionsorientiert nach Tausch/Tausch und Hurrelmann, typologisch nach Kurt Lewin), die Anwendung typologischer und dimensionsorientierter Kriterien zur Analyse von Erziehungsstilen in der Kinderliteratur, und die kritische Reflexion der Grenzen der verwendeten Konzepte.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Es werden sowohl typologische als auch dimensionsorientierte Kriterien zur Analyse von Erziehungsstilen eingesetzt. Methoden umfassen Rollenspiele, Fallbeispiele (Supernanny, W. Klafki), Streitgespräche, die Analyse von Kinderbüchern und kooperative Teamarbeit mit Präsentationen.
Welche Autoren und Theorien werden behandelt?
Die Unterrichtseinheit bezieht sich auf die Theorien von Hermann Nohl, Kurt Lewin, Tausch/Tausch und Hurrelmann. Die Analyse von Erziehungsstilen erfolgt anhand dimensionsorientierter und typologischer Kriterien dieser Autoren.
Welche Ziele werden mit dem Unterricht verfolgt?
Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Konzepte zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses entwickeln. Sie sollen lernen, typologische und dimensionsorientierte Kriterien zur Analyse von Erziehungsstilen anzuwenden und kritisch zu reflektieren, sowie das pädagogische Verhältnis in verschiedenen Kontexten (z.B. Kinderliteratur) zu analysieren.
Wie wird das Thema in der Kinderliteratur behandelt?
Ausgewählte Beispiele aus der Kinderliteratur dienen als Grundlage zur Analyse des pädagogischen Verhältnisses unter Anwendung typologischer und dimensionsorientierter Kriterien. Die Schüler sollen die Grenzen bekannter Konzepte zur Beschreibung von Erziehungsstilen anhand dieser Beispiele erkennen und beschreiben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Unterrichtsvorhabens?
Schlüsselwörter sind: Pädagogisches Verhältnis, Erziehungsstile, Typologie, Dimensionsorientierung, Kurt Lewin, Tausch/Tausch, Hurrelmann, Kinderliteratur, Analysemethoden, Grenzen von Konzepten.
Wie ist der Ablauf der Unterrichtseinheiten strukturiert?
Der Ablauf ist strukturiert in verschiedene Unterkapitel, die einen schrittweisen Lernprozess ermöglichen, beginnend mit einer Einführung in das Thema und den Gesamtkontext, gefolgt von der Behandlung verschiedener Aspekte des pädagogischen Verhältnisses und schliesslich der Anwendung der erlernten Konzepte und Methoden.
- Quote paper
- M. A. Jutta Mahlke (Author), 2003, Unterrichtsstunde: Möglichkeiten und Grenzen der bekannten Erziehungsstilkonzepte zur Beschreibung des pädagogischen Verhältnisses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125435