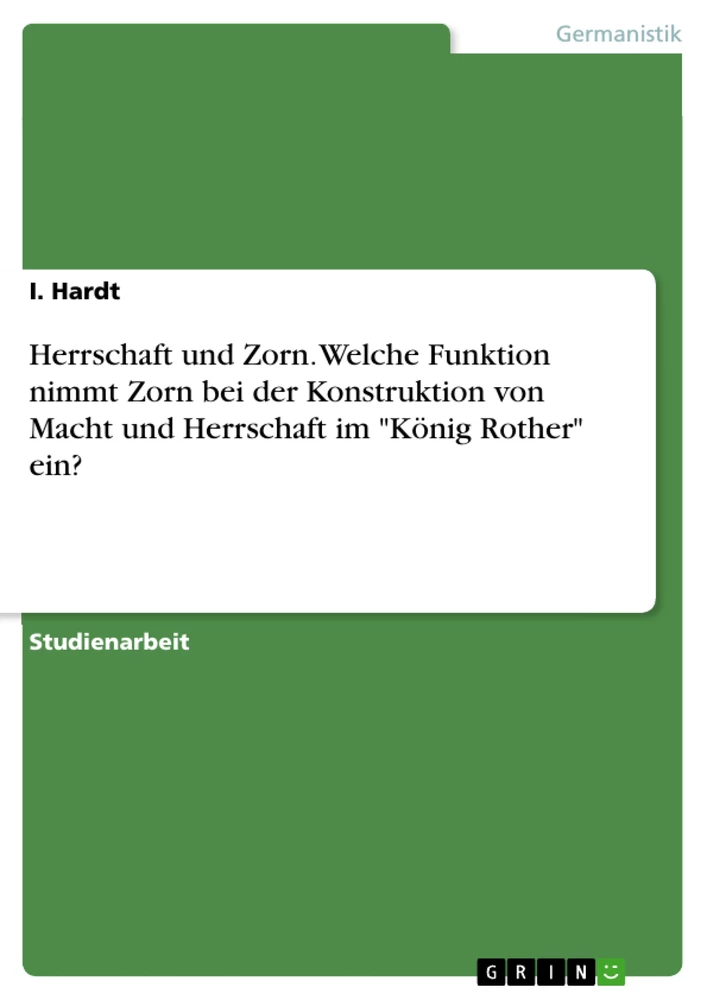Gegenstand der Arbeit soll also die Frage nach der Funktion von Zorn bei der Konzeptualisierung von Macht und Herrschaft im König Rother sein. Dafür werden nach einer Definition der wichtigsten Begrifflichkeiten zunächst antike Thesen untersucht, die Aufschluss darüber geben sollen, welchen Anteil Zorn überhaupt am Herrscherideal des 12. Jahrhunderts innehat.
Im Zuge dieser Thesen-Betrachtung werden auch zwei Konzepte – Herrscherzorn und Kampfzorn – genauer beleuchtet. In den letzten drei Analysepunkten soll besonderes Augenmerk auf König Rother als einem Idealherrscher und König Konstantin als dessen Kehrseite liegen, die jeweils von machtvollem Zorn freigehalten werden, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Für König Rother spielen in dieser Hinsicht die treuen Riesen eine wichtige Rolle, deren Wirkung in Abschnitt 5 Gegenstand der Analyse sein soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definitionen
- 2. Das Herrscherideal und Zorn
- 2.1 Antike Thesen
- 2.2 Herrscherzorn- und Kampfzorn-Konzept
- 3. König Rother - Ein Plädoyer für ein zornfreies Herrschen?
- 4. Riesen Rothers zornige Vollstrecker?
- 5. Der unterlegene Basileus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Analyse untersucht die Funktion von Zorn in der Konstruktion von Macht und Herrschaft im mittelhochdeutschen Epos "König Rother". Die Arbeit beleuchtet, wie Zorn die Machtausübung beeinflusst, Machtverhältnisse entstehen und aufrechterhalten werden und wie diese unterlaufen werden können. Sie analysiert die Darstellung von Zorn bei König Rother im Kontext des Herrscherideals des 12. Jahrhunderts.
- Die Rolle des Zorns im Herrscherideal des Mittelalters
- Die verschiedenen Ausprägungen von Zorn (Herrscherzorn, Kampfzorn) im Kontext der Macht
- Die Darstellung von Macht und Herrschaft im "König Rother"
- Der Vergleich der Herrscherfiguren König Rother und König Konstantin
- Die Bedeutung der Riesen als zornige Vollstrecker Rothers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Analyse ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion von Zorn bei der Konstruktion von Macht und Herrschaft im "König Rother" vor. Sie beleuchtet die Bedeutung von Zorn für die Machtausübung und die Sicherung der Herrschaft im mittelalterlichen Kontext und kündigt die Struktur der folgenden Analyse an, die Definitionen, antike Thesen zum Herrscherideal, die Rolle Rothers und Konstantins sowie die Bedeutung der Riesen untersuchen wird.
1. Definitionen: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Begriffe der Analyse fest: Zorn wird als mehrdimensionale Emotion definiert, die eine Kränkung und das Streben nach Vergeltung umfasst. Es wird auf Aristoteles Bezug genommen, der Zorn als hierarchisierenden Effekt beschreibt. Macht wird als Vermögen definiert, sich gegen fremde Kräfte durchzusetzen, und von Gewalt abgegrenzt. Herrschaft wird als übergeordneter Begriff vorgestellt, der sich in konkreten Begrifflichkeiten und der expliziten Ausformulierung der Herrscherposition niederschlägt.
Häufig gestellte Fragen zu "König Rother": Zorn und Herrschaft im mittelhochdeutschen Epos
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Analyse untersucht die Funktion von Zorn in der Konstruktion von Macht und Herrschaft im mittelhochdeutschen Epos "König Rother". Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Zorn die Machtausübung beeinflusst, Machtverhältnisse entstehen und aufrechterhalten (oder unterlaufen) werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet die Rolle des Zorns im Herrscherideal des Mittelalters, die verschiedenen Ausprägungen von Zorn (Herrscherzorn, Kampfzorn) im Kontext der Macht, die Darstellung von Macht und Herrschaft im "König Rother", einen Vergleich der Herrscherfiguren König Rother und König Konstantin und die Bedeutung der Riesen als zornige Vollstrecker Rothers.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Definitionen zentraler Begriffe (Zorn, Macht, Herrschaft), ein Kapitel zum Herrscherideal und Zorn (inkl. antiker Thesen und des Herrscherzorn-/Kampfzorn-Konzepts), ein Kapitel zu König Rother als möglichem Beispiel zornfreien Herrschens, ein Kapitel zu den Riesen als zornige Vollstrecker, ein Kapitel zum unterlegenen Basileus und ein Fazit.
Wie wird Zorn definiert?
Zorn wird als mehrdimensionale Emotion definiert, die eine Kränkung und das Streben nach Vergeltung umfasst. Es wird auf Aristoteles Bezug genommen, der Zorn als hierarchisierenden Effekt beschreibt.
Wie werden Macht und Herrschaft definiert?
Macht wird als Vermögen definiert, sich gegen fremde Kräfte durchzusetzen und von Gewalt abgegrenzt. Herrschaft wird als übergeordneter Begriff vorgestellt, der sich in konkreten Begrifflichkeiten und der expliziten Ausformulierung der Herrscherposition niederschlägt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Funktion hat Zorn bei der Konstruktion von Macht und Herrschaft im "König Rother"?
Welche Quellen werden herangezogen?
Die Analyse bezieht sich auf das mittelhochdeutsche Epos "König Rother" und verwendet konzeptionelle Ansätze aus der antiken Philosophie (Aristoteles).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion von Zorn in der Konstruktion von Macht und Herrschaft im Kontext des mittelhochdeutschen Epos "König Rother" zu analysieren und zu verstehen.
- Quote paper
- I. Hardt (Author), 2020, Herrschaft und Zorn. Welche Funktion nimmt Zorn bei der Konstruktion von Macht und Herrschaft im "König Rother" ein?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254360