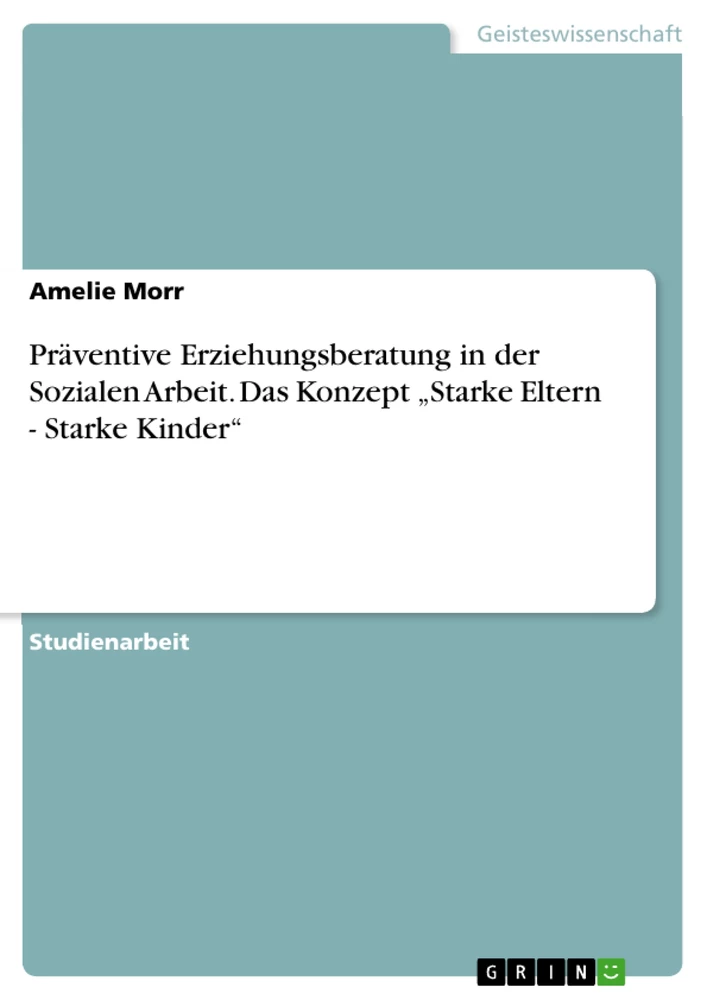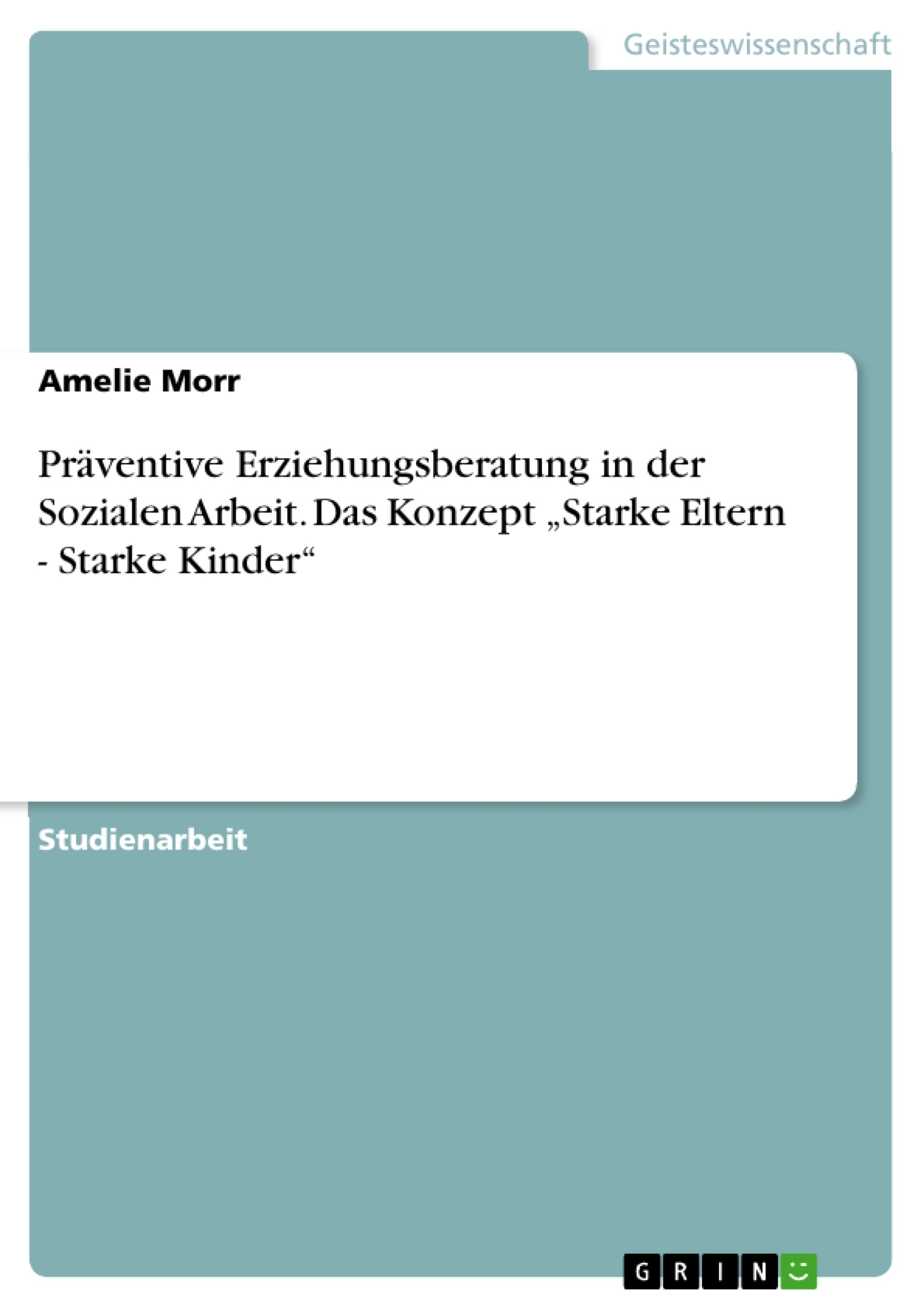Diese Arbeit behandelt präventive Erziehungsberatung in der sozialen Arbeit am Beispiel des Konzeptes "Starke Eltern - Starke Kinder“. Der Schwerpunkt liegt in der Beschreibung von Beratung im Allgemeinen und der Erziehungsberatung im Speziellen. In Kapitel 2 wird eine Begriffsbestimmung von Erziehung vorgenommen. Im Anschluss wird das Konzept "Starke Eltern - Starke Kinder“ erläutert und analysiert. Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsbestimmung Beratung
- 1.1. Beratung in der Sozialen Arbeit
- 1.2. Prävention in der Beratung
- 1.3. Erziehungsberatung in der Sozialen Arbeit
- 1.3.1. Empowerment in der Erziehungsberatung
- 1.3.2. Gruppenberatung in der Erziehungsberatung
- 2. Begriffsbestimmung Erziehung
- 2.1. Erziehung in der Familie
- 2.2. Eltern in der Erziehung
- 3. Analyse des Konzeptes „Starke Eltern, Starke Kinder“
- 3.1. Ziele, Inhalte und Methoden
- 3.1.1. Ablauf des Elternkurses
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der präventiven Erziehungsberatung in der Sozialen Arbeit anhand des Konzeptes „Starke Eltern - Starke Kinder“. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung von Beratung im Allgemeinen und Erziehungsberatung im Speziellen.
- Begriffsbestimmung von Beratung und Erziehungsberatung
- Analyse des Konzeptes „Starke Eltern - Starke Kinder“
- Rolle von Prävention in der Beratung
- Empowerment als Ansatz in der Erziehungsberatung
- Gruppenberatung als Format in der Erziehungsberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Fokus der Arbeit auf präventive Erziehungsberatung und stellt das Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“ vor. Kapitel 1 definiert den Begriff „Beratung“ im Kontext der Sozialen Arbeit und beleuchtet die Rolle von Prävention in der Beratung. Kapitel 1.3 konzentriert sich auf die Erziehungsberatung und untersucht die Ansätze von Empowerment und Gruppenberatung. Kapitel 2 widmet sich der Definition von Erziehung und untersucht die Rolle der Eltern in der Erziehung. Kapitel 3 analysiert das Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“ im Detail, einschließlich seiner Ziele, Inhalte und Methoden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Erziehungsberatung, Prävention, Empowerment, Gruppenberatung, „Starke Eltern - Starke Kinder“, soziale Arbeit, Familienhilfe und pädagogische Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“?
Es ist ein Elternkurs des Kinderschutzbundes, der die Erziehungskompetenz stärkt und ein gewaltfreies Miteinander in der Familie fördert.
Was bedeutet Empowerment in der Erziehungsberatung?
Empowerment zielt darauf ab, Eltern zu befähigen, ihre eigenen Stärken zu entdecken und Probleme selbstbestimmt zu lösen.
Warum ist Prävention in der Sozialen Arbeit wichtig?
Prävention soll Überlastungen und Erziehungskrisen verhindern, bevor sie entstehen, um das Kindeswohl langfristig zu sichern.
Wie läuft ein solcher Elternkurs ab?
Der Kurs findet meist in Gruppen statt und nutzt Methoden wie Austausch, Reflexion und praktische Übungen zu Erziehungsalltag und Kommunikation.
Welche Ziele verfolgt die präventive Erziehungsberatung?
Ziele sind die Verbesserung des Familienklimas, die Stärkung des Selbstvertrauens der Eltern und die Förderung der kindlichen Entwicklung.
- Citar trabajo
- Dipl.-Berufspäd. Amelie Morr (Autor), 2008, Präventive Erziehungsberatung in der Sozialen Arbeit. Das Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254780