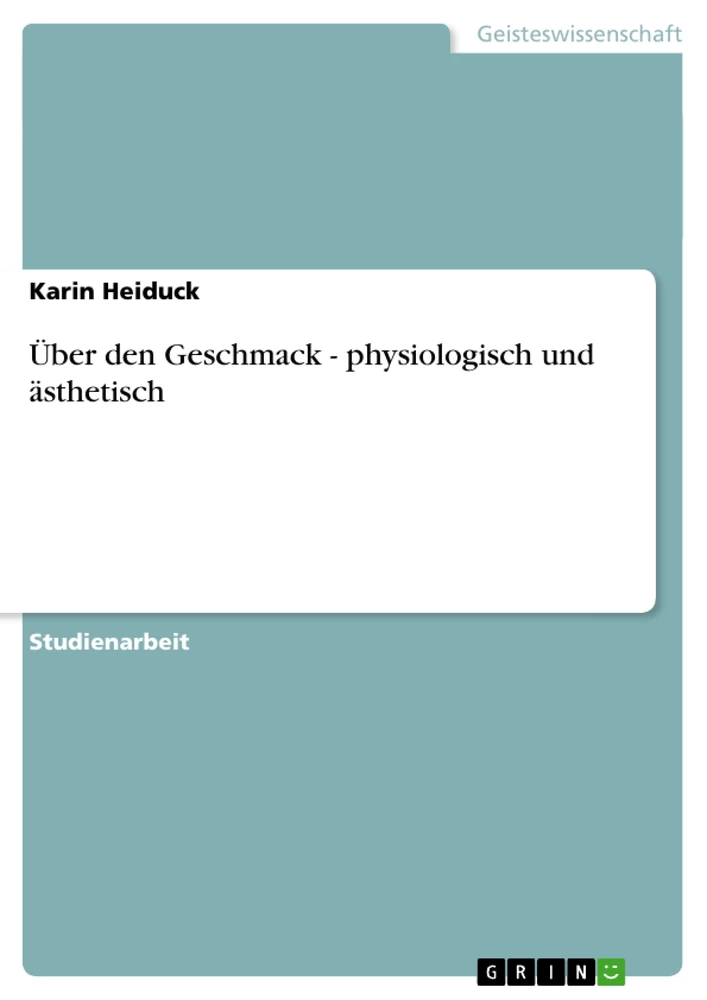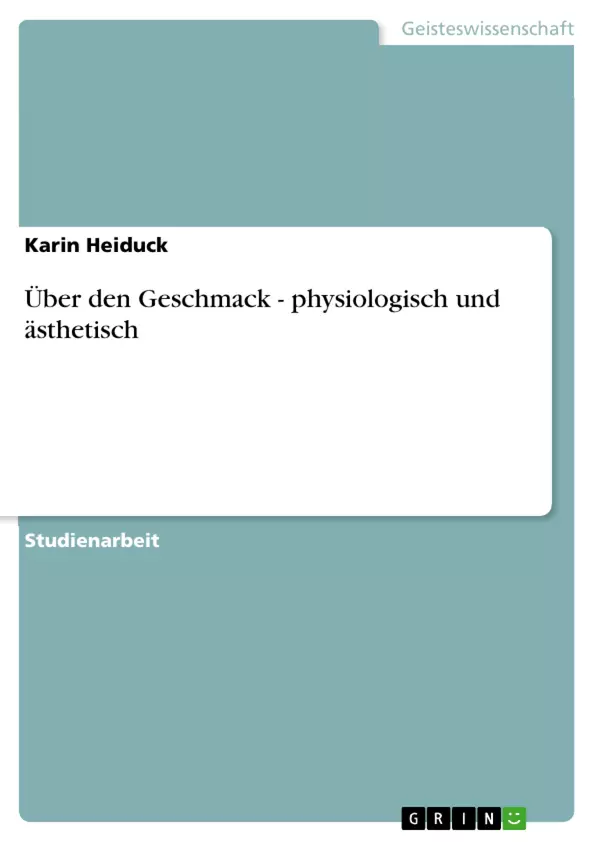In der vorliegenden Hausarbeit sollen sowohl der physiologische als auch der ästhetische
Geschmack sowie deren gegenseitige Beeinflussung betrachtet werden. Der Geschmackssinn,
der in den meisten Sinnestheorien zu den niederen, leibnahen und gefühlsgebundenen Sinnen
gezählt wird, steht in dem Ruf, verglichen mit anderen Sinnen, physiologisch extrem
unterentwickelt zu sein und nur einen geringen Beitrag zum Erkennen der Welt leisten zu
können. In deutlichem Widerspruch zu diesen wissenschaftlichen Charakterisierungen steht
der gesellschaftliche Gebrauch des Geschmacks, der „eng mit der ästhetischen Urteilskraft
und dem Vermögen, zu verallgemeinerungsfähigen Urteilen zu gelangen“, verbunden ist
(Barlösius 2000: 59-62).
Die vorliegende Arbeit wurde vom Reader zum Präsenzseminar „Philosophie des
Kulinarischen“ (Röttgers/Konersmann 2008) inspiriert und kann nicht umhin, sich einen
Vergleich einzuverleiben, den Rigotti zwischen Philosophie und Kochen zieht. Nach Rigotti
ist die Wechselbeziehung zwischen Einheit und Vielfalt, aus der die Philosophie ihre Themen
und ihre disziplinäre Besonderheit entwickelt hat, das „Zergliedern, Entgegensetzen und neu
Zusammenfügen, unter dem Einfluss von Ahnungen, Eingebungen und tiefen
Notwendigkeiten“, auch in der Küche zu beobachten: „Bestehen Zubereitung des Essens und
Kochen nicht eben im Zerlegen und neu Zusammensetzen, im Mahlen und Verrühren, im
Schneiden und Vermischen?“ (2003: 52-54) Genau diese Operationen sollen auch in dieser
philosophischen Hausarbeit Anwendung finden und eine Vielfalt an gedanklichen Zutaten,
sprichwörtlich „Kraut und Rüben“, zu einer abgerundeten Einheit zusammenfügen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Physiologie des Geschmacks und beleuchtet zum
einen Sinnestheorien, die den Geschmack als „niederen“ Sinn klassifizieren und zum anderen
Meinungen, die den Geschmack zu „Höherem“ berufen sehen. Weiters stehen die Aufgaben
des Geschmackssinns im Mittelpunkt der Betrachtung.
Das dritte Kapitel nimmt den kulinarischen Geschmack in den Blick. Im ersten Unterkapitel
wird Plessners Theorie der künstlichen Horizontverengung auf den Bereich der
Nahrungsmittelauswahl umgelegt und beschrieben, warum Esskulturen selektiv, isoliert und
interessensgebunden sind. Im zweiten Unterkapitel wird die kulturelle Formung des
Geschmacks, die eng mit gastronomischen Traditionen, gesundheitlichen, religiösen, moralischen und gruppen-dynamischen Aspekten verbunden ist, betrachtet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Begriffsbestimmung
- 2. Zur Physiologie des Geschmacks
- 2.1. Geschmack als „niederer“ Sinn
- 2.2. Die Aufgaben des Geschmackssinns
- 3. Der kulinarische Geschmack
- 3.1. Die künstliche Horizontverengung
- 3.2. Die kulturelle Formung des Geschmacks
- 3.3. Präferenzen und Aversionen beim Essen
- 3.4. Essgeschmack und Essgenuss
- 4. Der soziale Gebrauch des Geschmacks
- 4.1. Geschmack als soziales Ordnungskriterium
- 4.2. Geschmack als Lebensstil
- 4.3. Geschmack als Mittel zur Ausgrenzung
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Geschmack sowohl physiologisch als auch ästhetisch und beleuchtet deren gegenseitige Beeinflussung. Sie analysiert den Geschmackssinn im Kontext unterschiedlicher Sinnestheorien und betrachtet seine Rolle in der Gesellschaft. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Geschmack kulturell geformt wird und welche soziale Bedeutung ihm zukommt.
- Physiologie des Geschmackssinns und seine Einordnung in Sinnestheorien
- Der kulinarische Geschmack und seine kulturelle Konditionierung
- Geschmackspräferenzen und -aversionen: biologische und kulturelle Faktoren
- Der soziale Gebrauch des Geschmacks als Ordnungskriterium und Mittel der Ausgrenzung
- Die Wechselwirkung zwischen physiologischem und ästhetischem Geschmack
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Begriffsbestimmung: Die Einleitung definiert den Begriff "Geschmack" in seinen physiologischen und ästhetischen Dimensionen. Sie skizziert die zwei Hauptbereiche der Untersuchung: die physiologische Wahrnehmung von Geschmacksqualitäten und die ästhetische Beurteilung von Geschmack als Vermögen, Schönes und Hässliches zu unterscheiden. Die Arbeit vergleicht die scheinbar gegensätzlichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auffassungen vom Geschmack und kündigt die Verbindung von philosophischen und kulinarischen Perspektiven an, inspiriert durch Rigottis Vergleich von Philosophie und Kochen.
2. Zur Physiologie des Geschmacks: Dieses Kapitel befasst sich mit der physiologischen Basis des Geschmackssinns. Es diskutiert Sinnestheorien, die den Geschmack als „niederen“ Sinn einstufen und andere, die ihm eine höhere Bedeutung beimessen. Ein zentraler Aspekt ist die Analyse der Aufgaben des Geschmackssinns, insbesondere seine Rolle bei der Nahrungsaufnahme und der Unterscheidung von Geschmacksqualitäten wie süß, sauer, bitter, salzig und umami. Der Unterschiedliche Stellenwert des Geschmacks in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten wird herausgestellt.
3. Der kulinarische Geschmack: Dieses Kapitel analysiert den kulinarischen Geschmack, indem es Plessners Theorie der künstlichen Horizontverengung auf die Nahrungsmittelauswahl anwendet. Es untersucht die selektive Natur von Esskulturen und deren Verbundenheit mit gastronomischen Traditionen, gesundheitlichen, religiösen und moralischen Aspekten sowie gruppendynamischen Faktoren. Der Einfluss von Präferenzen und Aversionen, die auf Neophilie und Neophobie, aber auch auf kulturelle, soziale, genetische und biologische Bedingungen zurückzuführen sind, wird ausführlich beleuchtet. Schließlich werden die Voraussetzungen für Essgeschmack und Essgenuss sowie die Dynamik zwischen individuellen und kulturellen Geschmackszuschreibungen untersucht.
4. Der soziale Gebrauch des Geschmacks: Das vierte Kapitel widmet sich dem sozialen Aspekt des Geschmacks. Es untersucht Nahrungsmittel als Symbole gesellschaftlicher Differenzierung und die Verwendung von Geschmack als Ausdrucksmittel sozialer Unterschiede. Bourdieus Studie „Die feinen Unterschiede“ und Schulzes Theorie der Erlebnisgesellschaft werden herangezogen, um soziale Gruppen und Milieus zu analysieren, die sich durch ihren Geschmack und Lebensstil unterscheiden. Der Einsatz des Geschmacks als Mittel der Ausgrenzung wird am Beispiel des Adels, der Bourdieuschen Theorie der Distinktion, des ostentativen Konsums und der Abwertung fremder Kochpraktiken in Migrationsküchen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geschmack, Physiologie, Ästhetik, Sinnestheorie, Kulinarischer Geschmack, Kulturelle Formung, Soziale Differenzierung, Lebensstil, Ausgrenzung, Esskultur, Präferenzen, Aversionen, Bourdieu, Plessner.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Geschmack – Physiologie, Ästhetik und sozialer Gebrauch
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Geschmack umfassend, sowohl seine physiologischen als auch ästhetischen Aspekte und deren gegenseitige Beeinflussung. Sie analysiert den Geschmackssinn im Kontext verschiedener Sinnestheorien und beleuchtet seine gesellschaftliche Rolle. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Geschmack kulturell geprägt wird und welche soziale Bedeutung er hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: die Physiologie des Geschmackssinns und seine Einordnung in Sinnestheorien; den kulinarischen Geschmack und seine kulturelle Konditionierung; Geschmackspräferenzen und -aversionen (biologische und kulturelle Faktoren); den sozialen Gebrauch von Geschmack als Ordnungskriterium und Mittel der Ausgrenzung; und die Wechselwirkung zwischen physiologischem und ästhetischem Geschmack.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 definiert den Begriff "Geschmack" in seinen physiologischen und ästhetischen Dimensionen und skizziert den Forschungsansatz. Kapitel 2 behandelt die physiologische Basis des Geschmackssinns und diskutiert unterschiedliche Sinnestheorien. Kapitel 3 analysiert den kulinarischen Geschmack, unter anderem im Kontext von Plessners Theorie der künstlichen Horizontverengung und kulturellen Einflüssen. Kapitel 4 widmet sich dem sozialen Aspekt des Geschmacks, unter Bezugnahme auf Bourdieu und Schulze. Kapitel 5 bildet den Schluss.
Welche Theorien und Autoren werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Theorien und Autoren, darunter Plessner (zur künstlichen Horizontverengung), Bourdieu (zu sozialen Distinktionen und Geschmack), Schulze (zur Erlebnisgesellschaft) und Rigotti (zum Vergleich von Philosophie und Kochen). Die Arbeit vergleicht auch unterschiedliche wissenschaftliche und gesellschaftliche Auffassungen zum Thema Geschmack.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Geschmack, Physiologie, Ästhetik, Sinnestheorie, Kulinarischer Geschmack, Kulturelle Formung, Soziale Differenzierung, Lebensstil, Ausgrenzung, Esskultur, Präferenzen, Aversionen, Bourdieu, Plessner.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin/der Autor?
Die Zielsetzung der Arbeit besteht darin, den Geschmack sowohl physiologisch als auch ästhetisch zu untersuchen und die gegenseitige Beeinflussung dieser Aspekte zu beleuchten. Sie analysiert die Rolle des Geschmacks in der Gesellschaft und untersucht, wie er kulturell geformt wird und welche soziale Bedeutung er hat.
- Arbeit zitieren
- Karin Heiduck (Autor:in), 2008, Über den Geschmack - physiologisch und ästhetisch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125525