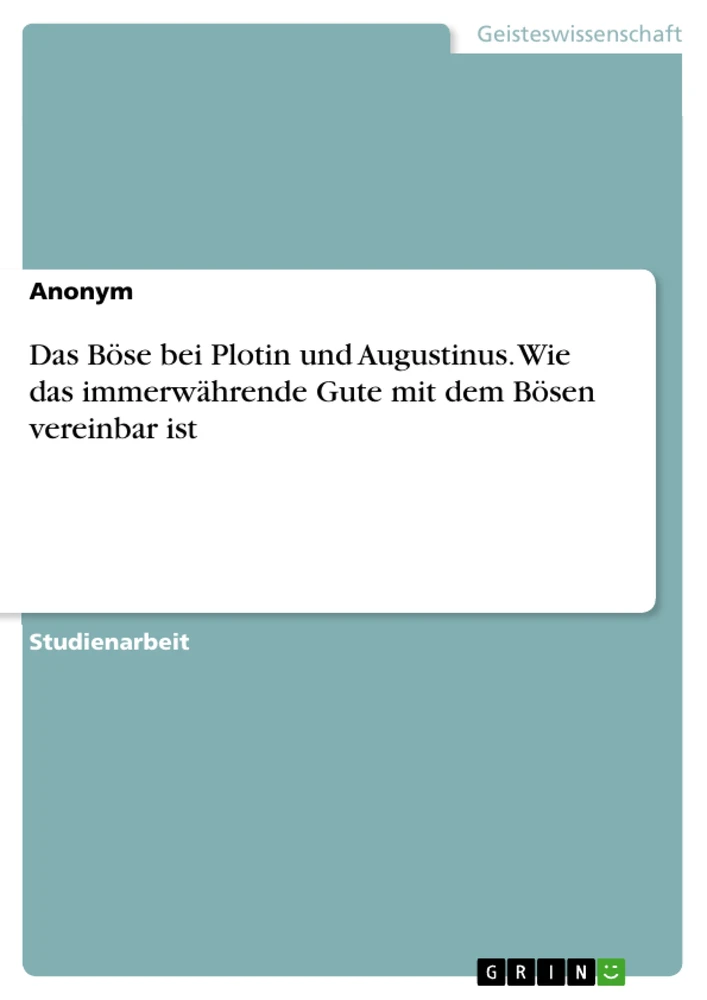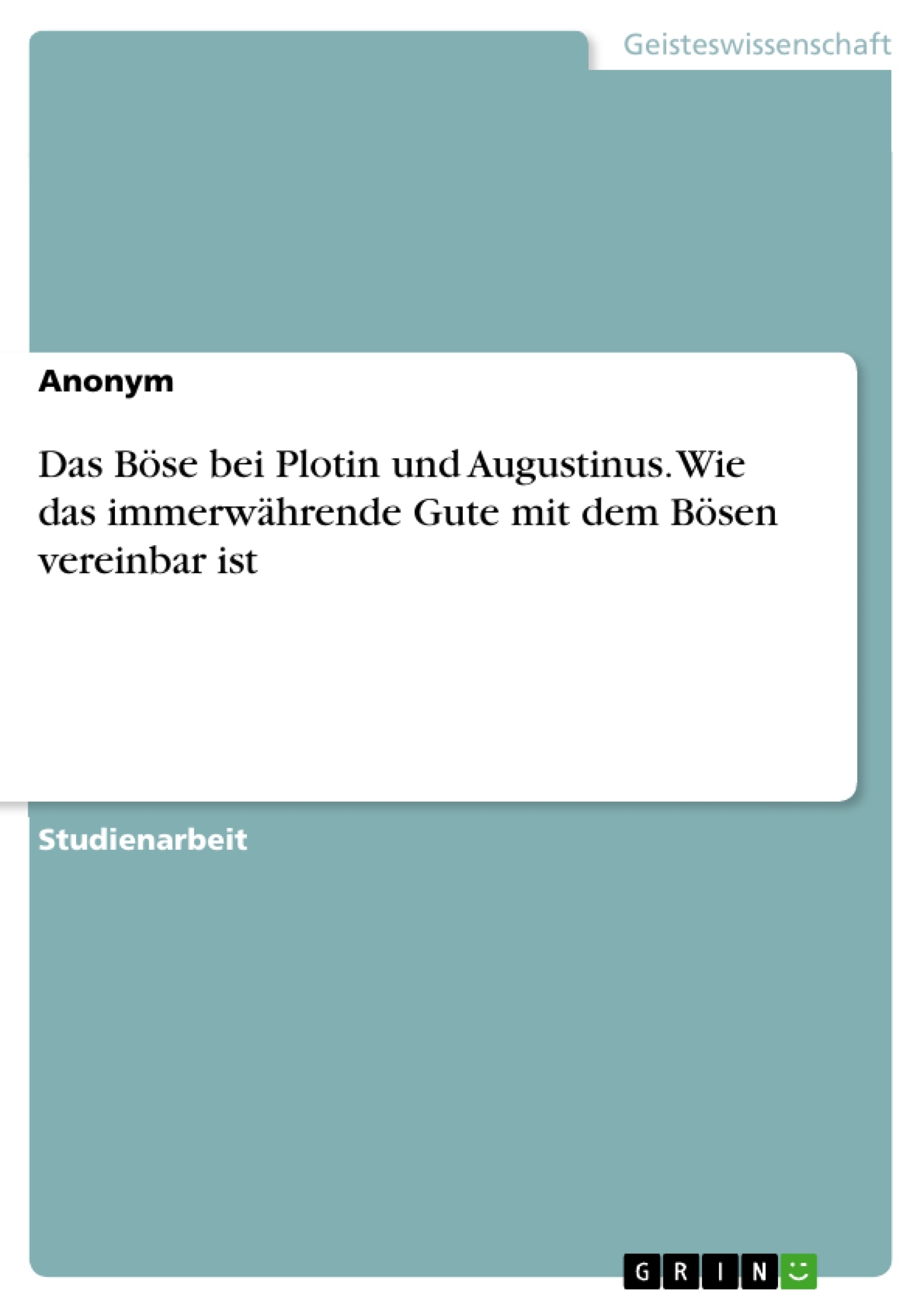In der vorliegenden Arbeit soll sich damit befasst werden, wie die beiden Philosophen das Sein einer höchsten guten Instanz mit der Existenz des Bösen miteinander vereinbaren können und worin in ihrer Argumentation Gemeinsamkeiten und Unterschiede auftreten.
Um diese Frage zu beantworten, soll mit einer ausgiebigen Betrachtung der jeweiligen Positionen begonnen werden um im Anschluss eine strukturierte Gegenüberstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der beiden Texte ansprechend darstellen zu können.
Die Literaturrecherche umfasste sich zu Beginn mit der Suche nach geeigneten Primärquellen. Dazu wurden sowohl die Aufzeichnungen aus dem Seminar „Das Böse“ von Herr Sebastian Böhme herangezogen, als auch die Bestände der sächsischen Landes und Universitätsbibliothek in Dresden.
Als Primärquellen bezieht sich diese Arbeit folglich auf „Plotins Schriften Band Va“ und Augustinus „13 Bücher Bekenntnisse“. Als Sekundärquelle wurden das „Malum“ von Ingolf Dalferth, sowie von Christian Schäfer die Texte zur Betrachtung des Bösen in „Was ist das Böse?“ herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Plotins Betrachtung des Bösen
- Beschreibung des Guten
- Das resultierende notwendige Böse
- Das Böse bei Augustinus
- Die Beschreibung des Guten
- Das Vorhandensein und Nichtvorhandensein des Bösen
- Vergleichende Betrachtung der Argumentationen
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Plotin und Augustinus die Existenz des Bösen mit dem Konzept eines höchsten, reinen Guten vereinbaren. Sie analysiert die jeweiligen Argumentationslinien und identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen.
- Die Definition des Guten bei Plotin und Augustinus
- Die Natur des Bösen und seine Beziehung zum Guten
- Die Rolle der Materie in der Entstehung des Bösen
- Die Verbindung zwischen dem Bösen und der menschlichen Natur
- Die ethischen Implikationen der jeweiligen Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Bösen ein und stellt die Problematik des Theodizeeproblems dar. Sie erläutert die Positionen von Plotin und Augustinus als Grundlage für die folgende Analyse.
Kapitel 2 befasst sich mit Plotins Sichtweise auf das Böse. Hier wird die Definition des Guten als Grundlage für die Ableitung des Bösen dargestellt. Weiterhin wird untersucht, wie Plotin das Böse als „Bastardschluss“ versteht und in der Materie als „Schattenbild“ lokalisiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des Guten und des Bösen, insbesondere die philosophischen Konzepte von Plotin und Augustinus. Weitere zentrale Begriffe sind Neuplatonismus, Theodizee, Materie, Seele, und Geist.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Plotin das "Gute"?
Für Plotin ist das Gute das "Ene" – die höchste, absolute Instanz, aus der alles Sein hervorgeht, die selbst aber jenseits des Seins steht.
Was ist das Böse laut Plotin?
Plotin sieht das Böse nicht als eigenständige Substanz, sondern als Mangel an Gutem. Er lokalisiert es in der Materie, die er als das am weitesten vom "Einen" entfernte "Schattenbild" betrachtet.
Wie erklärt Augustinus die Existenz des Bösen?
Augustinus argumentiert ebenfalls, dass das Böse kein eigenes Wesen hat (Privatio Boni), sondern eine Abkehr des Willens vom höheren Guten hin zum niederen Gut darstellt.
Was ist das Theodizeeproblem?
Das Theodizeeproblem ist die Frage, wie ein allmächtiger, allgütiger und allwissender Gott die Existenz des Bösen und des Leidens in der Welt zulassen kann.
Welche Gemeinsamkeiten haben Plotin und Augustinus in ihrer Argumentation?
Beide Philosophen lehnen den Dualismus (zwei gleichstarke Mächte von Gut und Böse) ab und definieren das Böse als einen Mangel oder eine Abwesenheit des Guten.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Das Böse bei Plotin und Augustinus. Wie das immerwährende Gute mit dem Bösen vereinbar ist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1255451