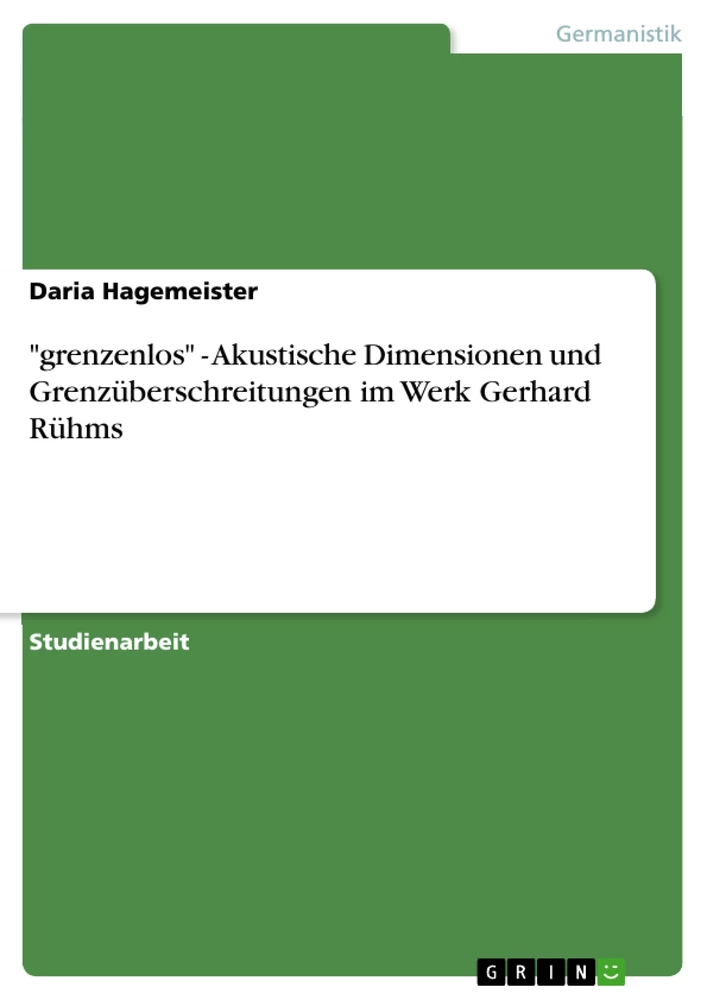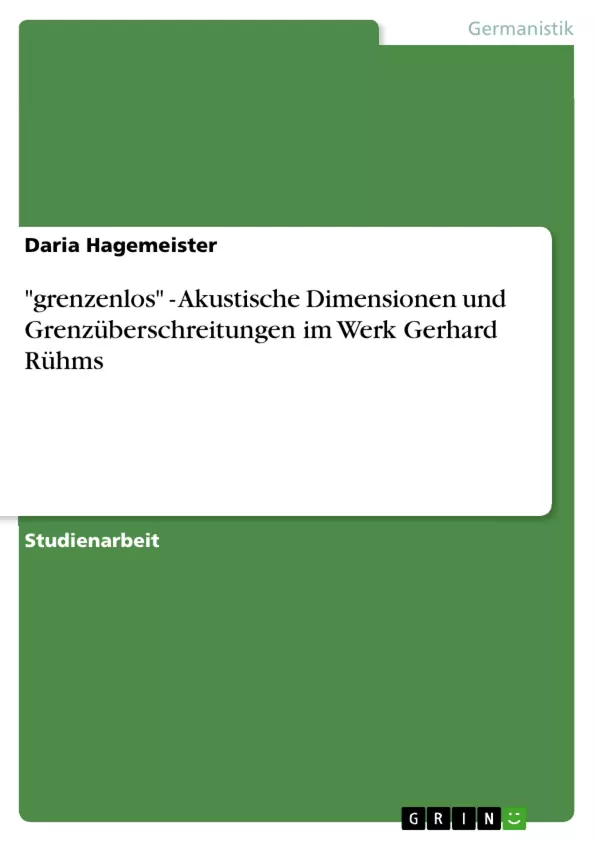Die gemeinsame Wurzel von Musik und Sprache begründet Rühm damit, dass die Momente der Stimmgebung phylogenetisch und ontogenetisch älter sind als die Zeichensprache. Die Lautdichtung etwa lässt sich bis in die Frühgeschichte der Menschheit zurückverfolgen. Der Mitteilungscharakter von Lautgesten ist ein weiterer Aspekt der Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache. Auch die Sprache folgt musikalischen Parametern, wie Sprachmelodie, Phrasierung, Rhythmus, Tempo, Dynamik (=Lautstärke) und Klangfarbe, die wiederum abhängig von den Obertönen, genauer gesagt vom Obertonspektrum ist. Diese Parameter aber sagen etwas über die Stimmung der Sprecher aus. Unbegriffliche Lautäußerungen sind Ausdruck einer aufgerührten Seele, ähnlich einer religiösen Ekstase, Gemütsbewegung verpackt sich nicht in Wörter, deshalb wird auf den emotional artikulierten Einzellaut als kleinste sprachliche Einheit zurückgegriffen und mit allen Nuancen der Sprechstimme (Tonlage, Tempo, etc.) gearbeitet. Durch den Einfluss Wittgensteins wollte man zu einer reinen „Urform“ der Sprache, die keinen Sinn und Inhalt hat, aber Assoziationen zulässt, zurückkehren.
Besonders hervorzuheben sind jedoch die Einflüsse des „Sturm“-Expressionismus auf die akustischen Komponenten der Dichtung Gerhard Rühms. Rühms musikalische Kompositionen bewegen sich zwischen seriellen Verfahren und radikaler Reduktion bis hin zu synthetisch produzierten Tonbandstücken. Gerhard Rühms „auditive poesie“ bewegt sich im Grenzbereich zwischen Musik und Sprache. „textmusik“ und „tondichtungen“ sind Auseinandersetzungen mit Grenzbereichen des Ausdrucks, hier vollzieht sich eine Sublimierung der Sprache in Musik, d.h. Sprache geht in Musik über, wodurch sich eine Verwandlung des Definitiven ins Vieldeutige vollzieht, eine Verwandlung des bloß Repräsentierenden in Präsentation. Gegenständliche Titel schaffen allerdings Assoziationsfelder. Bei der Verschmelzung zwischen Musik und Sprache entsteht etwas „metasprachliches“, bzw. etwas „metamusikalisches“. [...]
Im Werk Gerhard Rühms kam es im Laufe der Jahre zu immer zahlreicheren Grenzüberschreitungen zwischen den einzelnen Künsten, wie etwa zwischen Literatur und Musik, aber auch bildender Kunst und Musik. Collagen, bei denen es zu einem Zusammenwirken von Text, Bild und Musik kommt, bezeichnet Rühm als "liederbilder". Diese Werke stellen eine absolute Aufhebung der Grenzen zwischen den drei Künsten dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intermediale Aspekte im Werk Gerhard Rühms
- Zur Musik von Gerhard Rühm: Eintonstück und Zwölftonspiele
- Von der Lautdichtung zur „radiophonen Poesie“
- Die Ursprünge der Lautdichtung
- „auditive Poesie“
- „Tondichtungen“
- „Klangmodelle“ oder „Konzeptionelle Musik“
- „Visuelle Musik“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die akustischen Dimensionen und Grenzüberschreitungen im Werk Gerhard Rühms. Das Hauptziel besteht darin, die intermedialen Aspekte in Rühms Schaffen zu analysieren und den Einfluss verschiedener kultureller und künstlerischer Vorläufer aufzuzeigen. Dabei wird auf den Zusammenhang zwischen Musik und Sprache im Kontext seiner „auditiven Poesie“ eingegangen.
- Intermedialität in Gerhard Rühms Werk
- Die Beziehung zwischen Musik und Sprache bei Rühm
- Einflüsse von Lautdichtung und „radiophoner Poesie“
- Analyse der „visuellen Musik“ Rühms
- Grenzüberschreitungen zwischen verschiedenen Kunstformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext intermedialer Kunst und führt in die Thematik der Grenzüberschreitungen zwischen Musik und Sprache ein. Der erste Hauptteil analysiert die intermedialen Aspekte im Werk Gerhard Rühms, mit Fokus auf die gemeinsamen Wurzeln von Musik und Sprache und die Entwicklung der „visuellen Musik“. Der zweite Hauptteil befasst sich mit der Entwicklung der Lautdichtung und der „auditiven Poesie“ bei Rühm, unter Einbezug von „Tondichtungen“ und „Klangmodellen“. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Zusammenhänge zwischen musikalischen Parametern und sprachlicher Gestaltung.
Schlüsselwörter
Gerhard Rühm, Intermedialität, auditive Poesie, visuelle Musik, Lautdichtung, Musik und Sprache, Grenzüberschreitungen, Klangmodelle, Tondichtungen, intermediale Kunst.
Häufig gestellte Fragen zum Werk von Gerhard Rühm
Was versteht Gerhard Rühm unter "auditiver Poesie"?
Auditive Poesie ist ein Grenzbereich zwischen Musik und Sprache, in dem die klanglichen Parameter der Sprache (Rhythmus, Melodie, Dynamik) künstlerisch im Vordergrund stehen.
Wie hängen Musik und Sprache laut Rühm zusammen?
Beide haben eine gemeinsame Wurzel in der Stimmgebung, die älter ist als die Zeichensprache. Sprache folgt musikalischen Parametern wie Phrasierung und Klangfarbe.
Was sind "Liederbilder" im Kontext von Rühms Werk?
Liederbilder sind Collagen, die Text, Bild und Musik vereinen und somit die Grenzen zwischen Literatur, bildender Kunst und Musik vollständig aufheben.
Welchen Einfluss hatte der Expressionismus auf Gerhard Rühm?
Besonders der "Sturm"-Expressionismus prägte die akustischen Komponenten seiner Dichtung und förderte die Hinwendung zum emotional artikulierten Einzellaut.
Was ist "visuelle Musik"?
Visuelle Musik bezeichnet Werke Rühms, bei denen musikalische Strukturen optisch dargestellt werden oder die visuelle Gestaltung selbst musikalischen Gesetzen folgt.
- Quote paper
- Dr. phil. Daria Hagemeister (Author), 2008, "grenzenlos" - Akustische Dimensionen und Grenzüberschreitungen im Werk Gerhard Rühms, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125649