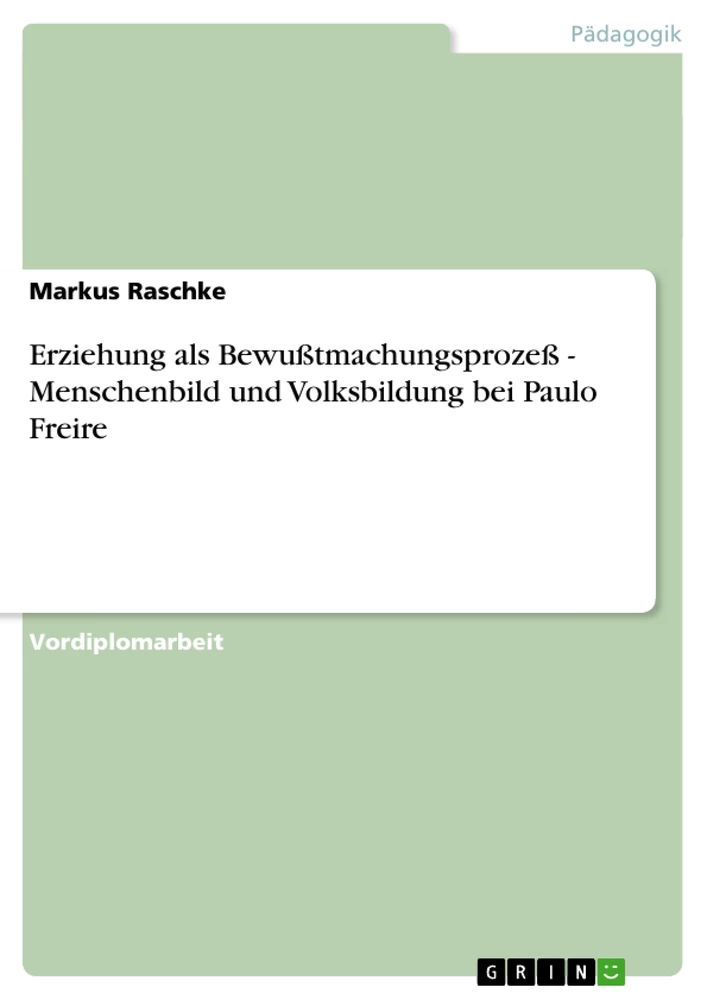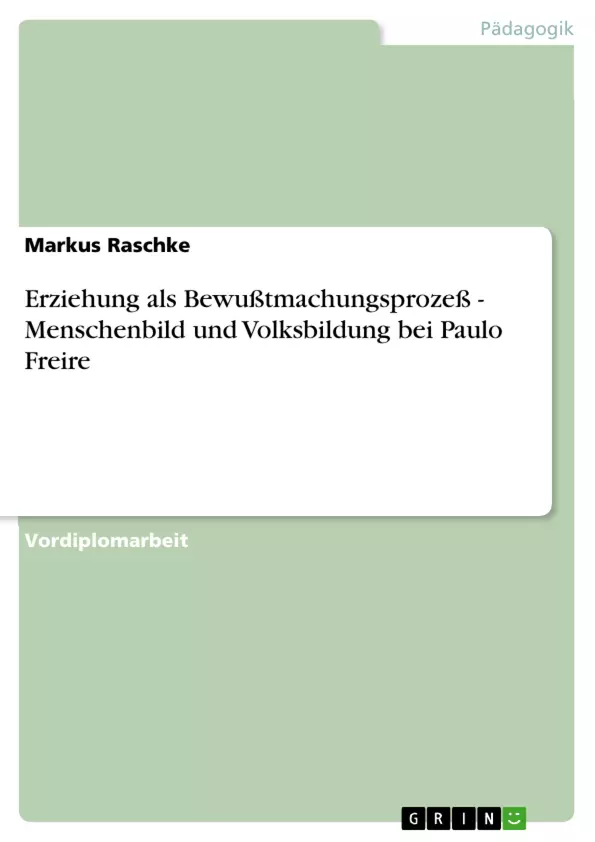Erziehung soll Menschen zu Mündigkeit und Selbstbestimmung befähigen. Dies ist von zentralem Stellenwert für eine Pädagogik, die sich als „kritisch“ begreift und dies entsprechend auch zum Ziel von Erziehung und Bildung erklärt. Nicht nur für eine fortschrittliche Pädagogik sind diese Grundsätze ausschlaggebend, sie erhalten im Kontext der volksnahen Bildungsanstrengungen in den Entwicklungsgesellschaften der südlichen Hemisphäre eine noch größere Bedeutung.
Neben einer Reihe von deutschsprachigen Vertretern dieses Ansatzes einer „Kritischen Erziehungswissenschaft“ hat sich insbesondere der Brasilianer Paulo Freire diesen Gedankenansatz zu eigen gemacht und auf seine ganz eigene Weise ausgearbeitet. Zwar ist bei Paulo Freire kaum von „Mündigkeit“ oder „Emanzipation“ die Rede, jedoch verfolgt sein Konzept der „problemformulierenden Bildung“ und der ,,Bewusstmachung“ eben diese Ziele im Sozialraum bildungsbenachteiligter und armer sozialer Schichten. Mündigkeit ist für den Volkspädagogen Freire dabei ein Zwischenziel, auf dem der emanzipatorische Prozess der Befreiung aufgebaut werden kann.
Beachtenswert ist bei Paulo Freire die Radikalität, mit der er seine Methodologie vertritt und mit der er sich bis ins Detail seiner Überzeugung hingibt. Dafür leitend ist ein Grundpostulat der Freireschen Pädagogik, nämlich dass seine Erziehungstheorie aus der konkreten Bildungs- und Erziehungsarbeit heraus erwächst und auf diese hin zurückorientiert ist.
Das so beschriebene Bildungsverständnis fußt nicht nur auf einer bestimmten gesellschaftlichen Analyse, sondern mehr noch auf Freires Menschenbild, das der Autor im Überblick herausarbeitet. In der Folge legt der Autor die von Freire entwickelte und praktizierte Bildungsmethode dar, die er in der Verflochtenheit von theoretischen Implikationen und praktischen Vollzügen diskutiert. Abschließend wird das Impulspotential für eine europäische Pädagogik skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Vorgehensweise
- Analyse der lateinamerikanischen Lebenswirklichkeit: die „Kultur des Schweigens“
- Die Entdeckung der „Kultur des Schweigens“
- Die Rolle der Kolonialsprache und die „kulturelle Invasion“
- „Themen einer Epoche“
- Die psychologischen Grundlagen des Unterdrückungsmechanismus: „Mythen und Manipulation“
- Das koloniale Bildungssystem: depositäre „Bankiers-Erziehung“
- Depositäre „Bankiers-Erziehung“
- Der Lehrer-Schüler-Widerspruch
- Das Menschenbild und das Bildungsverständnis von P. Freire
- Der Mensch ist Subjekt
- als Wesen der Grenzüberschreitung
- als kulturelles und geschichtliches Wesen
- als verwandelndes und schöpferisches Wesen
- als Wesen des Dialogs
- als Wesen der Praxis
- Die problemformulierende Bildungsmethode
- „Enthüllung der Wirklichkeit“
- Der „Lehrer-Schüler“ und der „Schüler-Lehrer“ - die Aufhebung des Widerspruchs
- Der Mensch ist Subjekt
- Die Realisierung der „problemformulierenden Bildung“ im Alphabetisierungsprozeß
- Untersuchung des Sprach- und Themenuniversums (generative Wörter / Themen)
- Kodierung
- Dekodierung
- Der „Kulturzirkel“
- Dekodierung während der Alphabetisierung
- Dekodierung in der postalphabethischen Phase
- Wiederkodierung
- Zur Bedeutung Paulo Freires für die Pädagogik in der 'Ersten Welt'
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Menschenbild und das Bildungsverständnis des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire. Sie beleuchtet insbesondere die problemformulierende Bildungsmethode, die Freire für die Befreiung der Unterdrückten aus ihrer Unterdrückung durch Bewusstseinsbildung propagiert. Der Fokus liegt auf der Kritik des kolonialen Bildungssystems und der Analyse der "Kultur des Schweigens" in lateinamerikanischen Kontexten.
- Das Menschenbild von Paulo Freire als Subjekt, das sich durch Grenzüberschreitung, kulturelle und geschichtliche Prägung, sowie schöpferische und dialogische Fähigkeiten auszeichnet.
- Die Kritik des traditionellen, depositären Bildungssystems, das Freire als "Bankiers-Erziehung" bezeichnet.
- Die problemformulierende Bildungsmethode als Instrument der Bewusstseinsbildung und Emanzipation.
- Die Rolle der Sprache und der Alphabetisierung in der Befreiung von Unterdrückung.
- Die Relevanz von Paulo Freires Theorie für die Pädagogik in der "Ersten Welt".
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den theoretischen Kontext der "Kritischen Erziehungswissenschaft" und die Bedeutung des Begriffs der "Emanzipation" für die Pädagogik darlegt. Anschließend wird die Fragestellung der Arbeit definiert und die Vorgehensweise erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse der lateinamerikanischen Lebenswirklichkeit, indem es die "Kultur des Schweigens" als Folge der Kolonialisierung und der kulturellen Invasion beschreibt. Die Rolle der Kolonialsprache und die psychologischen Grundlagen des Unterdrückungsmechanismus werden untersucht. Im vierten Kapitel wird das Menschenbild und das Bildungsverständnis von Paulo Freire vorgestellt. Es wird argumentiert, dass der Mensch als Subjekt mit vielfältigen Fähigkeiten zur Selbstbestimmung und Veränderung der Welt befähigt ist. Im fünften Kapitel wird die problemformulierende Bildungsmethode in ihrem praktischen Einsatz im Alphabetisierungsprozess analysiert. Die Rolle der Sprache, die Dekodierung von Realitäten und die Entwicklung von Bewusstseinsbildung werden in diesem Kontext untersucht. Abschließend wird im sechsten Kapitel die Bedeutung Paulo Freires für die Pädagogik in der "Ersten Welt" reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Kernaussagen der Arbeit lassen sich durch die folgenden Schlüsselbegriffe zusammenfassen: Paulo Freire, problemformulierende Bildungsmethode, "conscientização", Bewusstseinsbildung, Emanzipation, Unterdrückung, Kolonialismus, "Kultur des Schweigens", depositäre Bildung, "Bankiers-Erziehung", Subjekt, Sprache, Alphabetisierung, "Erste Welt".
- Quote paper
- Markus Raschke (Author), 1996, Erziehung als Bewußtmachungsprozeß - Menschenbild und Volksbildung bei Paulo Freire, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12566