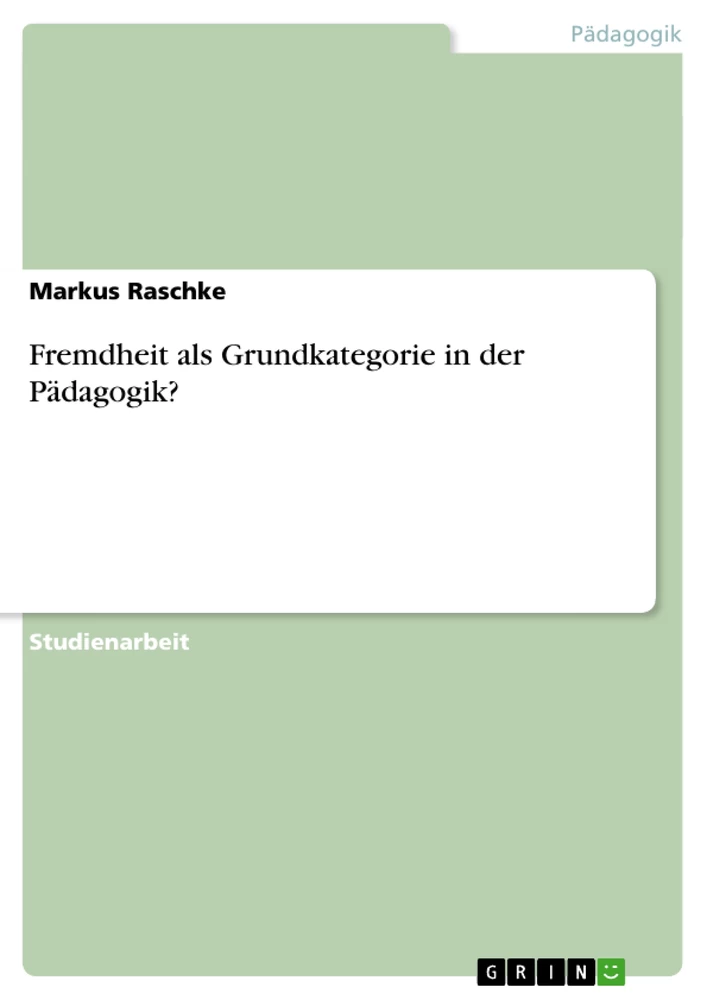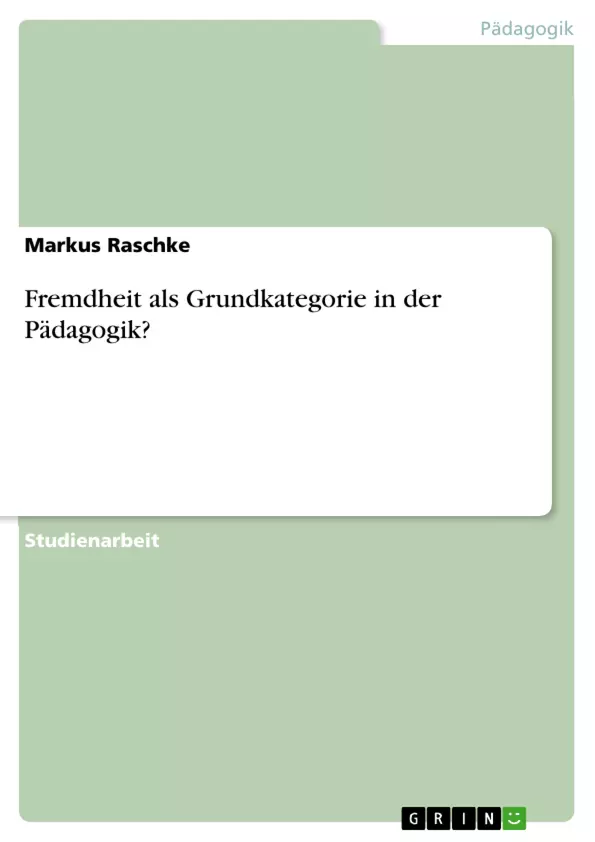Der Begriff der „Fremdheit“ erscheint zunächst einmal gerade nicht als ein zentraler Sachverhalt in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion. Dies verwundert nicht, insofern man den Hervorgang der Pädagogik aus der familiären Erziehung zur Kenntnis nimmt. In den Anfängen der professionellen und wissenschaftlich reflektierten Erziehung wird davon ausgegangen, daß der (berufsmäßige) Erzieher in seiner pädagogischen Beziehung zum Kind freundschaftlich oder väterlich diesem begegnen solle (Vgl. Giesecke, S. 100f).
Unter dem Begriff des „pädagogischen Bezugs“ ist in der Erziehungswissenschaft das ausführlich diskutiert worden, was ich im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit unter der Perspektive des Begriffs der „Fremdheit“ verhandeln und (das ergibt sich damit bereits aus der Themenstellung) kritisch hinterfragen und diskutierten möchte. Diese Auseinandersetzung geschieht in den folgenden Schritten: Zunächst sollen die Grundgedankengänge umrissen werden, die das Thema der pädagogischen Beziehung bestimmt haben. Aus der Kritik dieser Diskussion soll der Begriff der „Fremdheit“ als Element dieses Themas dargestellt und akzentuiert werden. Hierzu soll, zur kritisch-konstruktiven Entwicklung dieses Ansatzes, auf philosophische - insbesondere erkenntnistheoretische - Positionen Bezug genommen werden, welche es ermöglichen, dem Element der Fremdheit in der Erziehung eine profilierte Rolle und Aufgabe zuzuweisen, aber auch seine Grenzen zu benennen. Dieser Rückgriff erscheint m.E. auch dadurch erforderlich, daß eher phänomenologisch orientierte, deskriptive Annäherungen zwar zu einer Problematisierung des Sachverhalts beizutragen vermögen, weniger aber zu einer nachfolgenden (reflexiven) Konzeptionierung verhelfen. Damit dabei aber nicht der Bezug zum Feld pädagogischer Problemstellung verloren geht, muß entsprechend von der philosophisch-abstrakten Auseinandersetzung mit dem Thema der Blick stufenweise zunächst wieder auf die pädagogische Theorie allgemeinen und schließlich auf das Thema des pädagogischen Bezugs als Ausgangsthema gerichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertrautheit statt Fremdheit - Die traditionelle Grundkategorie zum pädagogischen Bezug
- Philosophische Anknüpfungspunkte für ‘Fremdheit als alternative Grundkategorie in der Pädagogik
- „Ent-eignung“ als Auslieferung an das Fremde - Diltheys Hermeneutik
- ,,An-eignung“ als Bändigung der Fremdheit - Hegels Dialektik
- ,,So-sein-lassen\" von Eigenem und Fremdem - Adornos Negative Dialektik
- Fremdes,,nicht-im-Stich-lassen“ - Lévinas” Humanismus des anderen Menschen
- Folgerungen für eine pädagogische Theorie des Umgangs mit Fremdheit
- Die sozialkonstruktivistische Sicht von Fremdheit
- ... und,,Fremdheitskompetenz“ als ihr Bewältigungsmodell
- Kinder als Fremde „aus der Perspektive von Kindern“ verstehen? - Rückwirkungen auf das Konzept des pädagogischen Bezugs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Begriff der „Fremdheit“ und dessen Relevanz für die pädagogische Beziehung. Ziel ist es, die traditionelle Vorstellung von Vertrautheit in der Pädagogik zu hinterfragen und eine alternative Grundkategorie in Form von „Fremdheit“ zu entwickeln. Die Arbeit analysiert philosophische Positionen zur Thematik und leitet daraus Folgerungen für die pädagogische Theorie ab.
- Kritik an der traditionellen Vorstellung von Vertrautheit in der Pädagogik
- „Fremdheit“ als alternative Grundkategorie im pädagogischen Bezug
- Philosophische Ansätze zur Thematik der Fremdheit
- Entwicklung einer pädagogischen Theorie des Umgangs mit Fremdheit
- Rückwirkungen auf das Konzept des pädagogischen Bezugs aus der Perspektive von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit befasst sich mit dem Begriff der „Fremdheit“ als einem zentralen Thema in der Erziehungswissenschaft. Sie argumentiert, dass die traditionelle Vorstellung von Vertrautheit in der Pädagogik, die aus der familiären Erziehung entstanden ist, einer kritischen Überprüfung bedarf. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Umgang mit Fremdheit im pädagogischen Kontext verstanden werden kann.
Vertrautheit statt Fremdheit - Die traditionelle Grundkategorie zum pädagogischen Bezug
Dieses Kapitel analysiert die traditionelle Vorstellung von Vertrautheit in der pädagogischen Beziehung, die auf dem Familienmodell basiert. Es wird argumentiert, dass die Idealisierung des Familienmodells als Grundlage jeglicher pädagogischen Beziehung problematisch ist, da sie nicht der komplexen Realität von Erziehung gerecht wird.
Philosophische Anknüpfungspunkte für ‘Fremdheit als alternative Grundkategorie in der Pädagogik
Dieses Kapitel stellt verschiedene philosophische Positionen vor, die sich mit der Thematik der Fremdheit auseinandersetzen. Es werden Konzepte wie „Ent-eignung“ (Dilthey), „An-eignung“ (Hegel), „So-sein-lassen“ (Adorno) und „nicht-im-Stich-lassen“ (Lévinas) in Bezug auf das Thema der pädagogischen Beziehung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind: pädagogische Beziehung, Fremdheit, Vertrautheit, Kinderforschung, sozialkonstruktivistische Sichtweise, Fremdheitskompetenz, philosophische Erkenntnistheorie, Hermeneutik, Dialektik, Negative Dialektik, Humanismus.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird „Fremdheit“ als pädagogische Grundkategorie diskutiert?
Traditionell basiert Pädagogik auf „Vertrautheit“ (Familienmodell). Die Arbeit schlägt „Fremdheit“ als Alternative vor, um der Eigenständigkeit und dem „Anderen“ im Kind besser gerecht zu werden.
Was kritisiert der Autor am „pädagogischen Bezug“?
Die Kritik richtet sich gegen die Idealisierung des freundschaftlich-väterlichen Verhältnisses, das die notwendige Distanz und die Realität von Fremdheit oft ausblendet.
Welche Rolle spielt Adornos „Negative Dialektik“ hier?
Adornos Konzept des „So-sein-lassens“ dient als philosophische Stütze, um das Eigene und das Fremde nebeneinander bestehen zu lassen, ohne das Fremde gewaltsam anzugleichen.
Was bedeutet „Fremdheitskompetenz“?
Es ist das Modell zur Bewältigung von Fremdheit, bei dem Erzieher lernen, das Unbekannte im Kind nicht als Defizit, sondern als zu respektierende Eigenheit zu begreifen.
Wie sieht Lévinas den „Anderen“ in der Erziehung?
Lévinas betont den Humanismus des anderen Menschen und die ethische Verantwortung, den Anderen (das Kind) in seiner Fremdheit „nicht im Stich zu lassen“.
- Quote paper
- Markus Raschke (Author), 2000, Fremdheit als Grundkategorie in der Pädagogik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12567