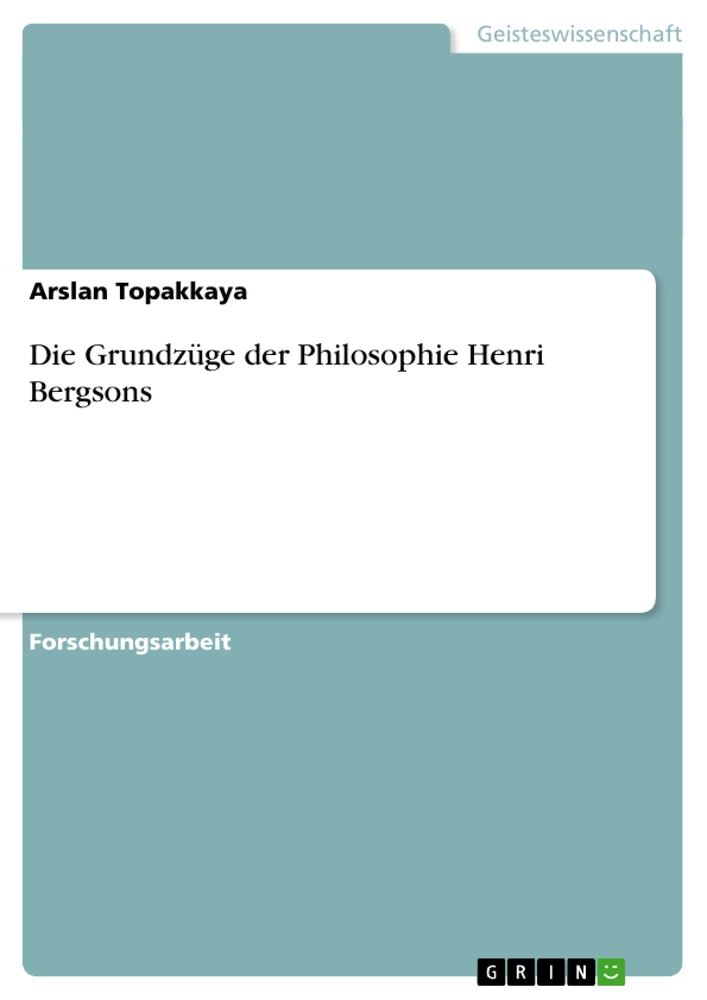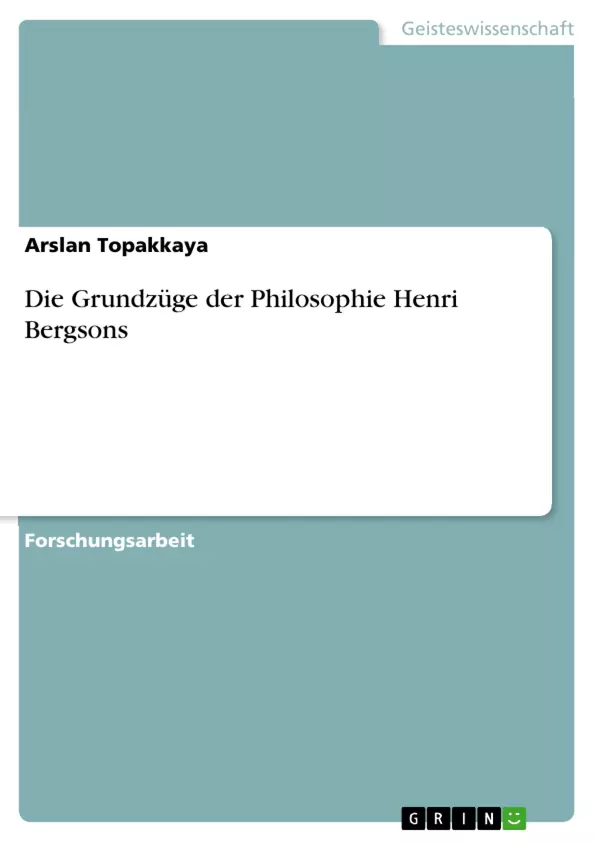Die Analyse der Zeitlehre hat eine unersetzbare Stellung in H. Bergsons Philosophie. Man kann für Bergson sagen, dass ohne die Zeitanalyse seine Philosophie nicht so viel Einfluss auf das nachfolgende Denken hätte haben können. Er widmet seine Philosophie von Anfang bis Ende dem Verständnis des realen Charakters der wirklichen Zeit (der Dauer). Bergson setzt seine Philosophie des Lebens und der Freiheit dem Positivismus und Materialismus entgegen. Seine Zeitlehre positioniert sich vor allem gegen die Kantische und wissenschaftliche Zeitanalyse. Bergson versucht in seiner ganzen Philosophie eine Methode festzulegen und an einem wesentlichen Punkt die Möglichkeit ihrer Anwendung aufleuchten zu lassen. Sein entscheidendes Anliegen ist, zu zeigen, dass Dauer und Raum, Bewusstsein und Materie, Leib und Seele, Gedächtnis und Gehirn nicht gleichzusetzen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Kapitel: Bergsons Auffassung von der Zeit
- Zeit und Zahl
- Verräumlichung der Zeit
- Zeit und Bewegung
- (Homogene) Zeit und inneres Erlebnis
- Die wirkliche Zeit, die Dauer
- Dauer und Raum
- Dauer und Bewusstsein
- Dauer und Gedächtnis
- Die Formen des Gedächtnisses
- Wahrnehmung und Erinnerung im Zusammenhang mit dem Gedächtnis
- Bilder und Wahrnehmung
- Erinnerung
- Dauer in Bezug auf die Zeitmomente
- Die Vergangenheit
- Die Gegenwart
- Die Zukunft
- Dauer und schöpferisches Werden in der Natur
- Dauer und schöpferische Entwicklung des Lebens
- Der élan vital (die Lebensschwungkraft)
- Die Intuition
- Die Geschichte des Intuitionsbegriff bis Bergson
- Das Wesen der Intuition
- Die Intuition und Erkenntnis
- Instinkt und Intellekt in Bezug auf die Intuition
- II. Kapitel: Bergsons Kritik an Kant
- Kants Metaphysiktheorie und deren Kritik durch Bergson
- Bergsons Kritik an Kants Erkenntnistheorie
- Bergsons Kritik an Kants Zeitlehre
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, Bergsons Philosophie, insbesondere seine Auffassung von Zeit und seine Kritik an Kant, umfassend darzustellen. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner Zeitlehre und deren Bedeutung für sein Gesamtwerk. Die Arbeit beleuchtet Bergsons Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Raum und Zeit, der Rolle des Bewusstseins und des Gedächtnisses, sowie seiner Konzeption der Dauer (la Durée).
- Bergsons Zeitlehre und die Konzeption der Dauer
- Kritik an der mechanistisch-materialistischen Weltanschauung
- Die Bedeutung der Intuition als Erkenntnismethode
- Bergsons Auseinandersetzung mit Kant
- Der Einfluss der Dauer auf das schöpferische Werden in der Natur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Bergson als zentralen Vertreter der Lebensphilosophie und Vorläufer des Existenzialismus vor. Sie hebt seine Kritik an der materialistisch-mechanistischen Weltanschauung hervor und betont den Einfluss seines Denkens auf die Lebensphilosophie und andere Denker. Die Einleitung skizziert die zentralen Themen der Arbeit, insbesondere Bergsons Zeitanalyse und seine Kritik an Kant, und gibt einen Überblick über die Kapitelstruktur.
I. Kapitel: Bergsons Auffassung von der Zeit: Dieses Kapitel untersucht Bergsons Konzeption der Zeit, beginnend mit seiner Analyse des Verhältnisses von Zeit und Zahl, der Verräumlichung der Zeit und der Problematik der Bewegung. Es differenziert zwischen homogener Zeit und innerem Erlebnis und führt den zentralen Begriff der "Dauer" (la Durée) ein. Die Dauer wird als wirkliche Zeit, Wesen des Seins und des Universums beschrieben. Das Kapitel analysiert die Beziehung der Dauer zu Raum, Bewusstsein und Gedächtnis, einschließlich der Formen des Gedächtnisses, der Wahrnehmung und der Erinnerung. Schließlich untersucht es die Dauer in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ihre Rolle im schöpferischen Werden der Natur, einschließlich des Begriffs des "élan vital". Die Rolle der Intuition als Methode, die Dauer und das Leben zu verstehen, wird ebenfalls behandelt.
II. Kapitel: Bergsons Kritik an Kant: Dieses Kapitel widmet sich Bergsons Kritik an Kants Metaphysik, Erkenntnistheorie und Zeitlehre. Bergson kritisiert Kants Auffassung der Zeit als homogenes Medium und seine Vermengung von Zeit und Raum. Er sieht in Kants System eine Verkennung der wahren Zeit und eine Verleugnung der Möglichkeit der Metaphysik. Bergson plädiert für eine auf Erfahrung basierende Metaphysik, deren Methode die Intuition ist, und für eine gegenseitige Unterstützung von Wissenschaft und Metaphysik. Er kritisiert auch Kants Unterscheidung von Form und Stoff und die Apriorität der Kategorien. Die Unvereinbarkeit von Kants mathematischer Erkenntnisauffassung mit dem wahren Charakter der Zeit bildet einen weiteren Kritikpunkt.
Schlüsselwörter
Bergson, Zeit, Dauer (la Durée), Intuition, Lebensphilosophie, Kritik an Kant, Metaphysik, Erkenntnistheorie, élan vital, Raum-Zeit-Verhältnis, Gedächtnis, Wahrnehmung, Erinnerung, schöpferisches Werden.
Häufig gestellte Fragen zu: Bergsons Philosophie der Zeit und Kritik an Kant
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Henri Bergsons Philosophie, insbesondere seine Konzeption der Zeit und seine Kritik an Immanuel Kant. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in Bergsons Philosophie behandelt?
Bergsons Philosophie, wie in diesem Dokument dargestellt, konzentriert sich auf seine einzigartige Zeitlehre, die von der traditionellen, mechanistischen Auffassung abweicht. Zentrale Begriffe sind die „Dauer“ (la Durée) als wirkliche Zeit, die im Gegensatz zur räumlich-zeitlichen Wahrnehmung steht, sowie die Rolle des Bewusstseins, des Gedächtnisses und der Intuition als Erkenntnismethode. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist seine Kritik an Kants Philosophie, insbesondere seiner Erkenntnistheorie und Zeitlehre.
Wie unterscheidet sich Bergsons Zeitverständnis von traditionellen Auffassungen?
Bergson kritisiert die traditionelle, verräumlichte Auffassung von Zeit als homogen und linear. Er setzt dem die „Dauer“ (la Durée) entgegen, die er als die eigentliche, innere, qualitative Zeit erlebt. Die Dauer ist nicht in messbare Einheiten zerlegbar, sondern kennzeichnet das fliessende, schöpferische Werden des Lebens und des Bewusstseins.
Welche Rolle spielt die Intuition in Bergsons Philosophie?
Die Intuition ist für Bergson die primäre Erkenntnismethode, um die Dauer und das Wesen des Lebens zu erfassen. Im Gegensatz zum Intellekt, der auf analytisches Denken und die Zerlegung von Phänomenen setzt, ermöglicht die Intuition ein unmittelbares, intuitives Erfassen der Wirklichkeit in ihrer Ganzheit und Dynamik.
Wie kritisiert Bergson Kant?
Bergsons Kritik an Kant richtet sich gegen dessen Erkenntnistheorie und Zeitlehre. Er wirft Kant vor, die Zeit zu verräumlichen und sie als homogenes Medium zu betrachten, wodurch er die eigentliche, qualitative Natur der Zeit verkenne. Bergson kritisiert auch Kants metaphysische Position und dessen Trennung von Form und Stoff.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Bergsons Auffassung von der Zeit, ein Kapitel zu Bergsons Kritik an Kant und eine Schlussbemerkung. Das Kapitel zu Bergsons Zeitverständnis behandelt detailliert seine Konzeption der Dauer, deren Beziehung zu Raum, Bewusstsein und Gedächtnis, sowie die Rolle der Intuition. Das Kapitel zur Kant-Kritik analysiert Bergsons Einwände gegen Kants Metaphysik, Erkenntnistheorie und Zeitlehre.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für Bergsons Philosophie?
Zentrale Begriffe in Bergsons Philosophie sind: Dauer (la Durée), Intuition, élan vital (Lebensschwungkraft), Zeit, Raum-Zeit-Verhältnis, Gedächtnis, Wahrnehmung, Erinnerung, schöpferisches Werden, Kritik an Kant, Lebensphilosophie.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an alle, die sich für Bergsons Philosophie, insbesondere seine Zeitlehre und seine Kritik an Kant, interessieren. Es eignet sich für Studierende der Philosophie, aber auch für alle, die sich einen Überblick über die zentralen Themen seines Denkens verschaffen möchten.
- Quote paper
- PD.Dr. Arslan Topakkaya (Author), 2009, Die Grundzüge der Philosophie Henri Bergsons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125691