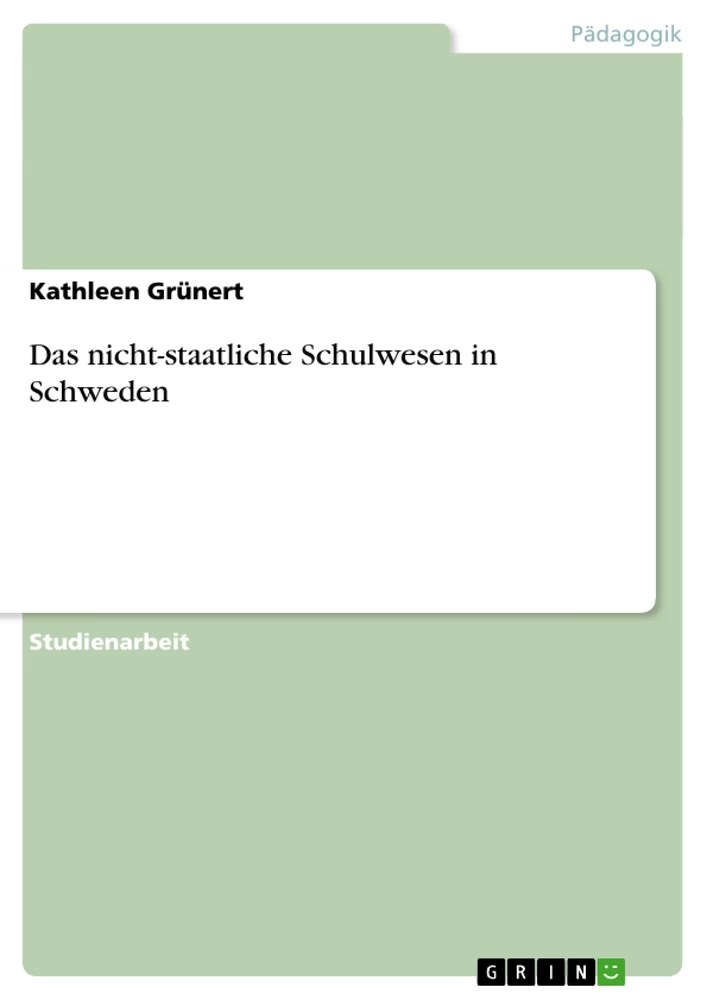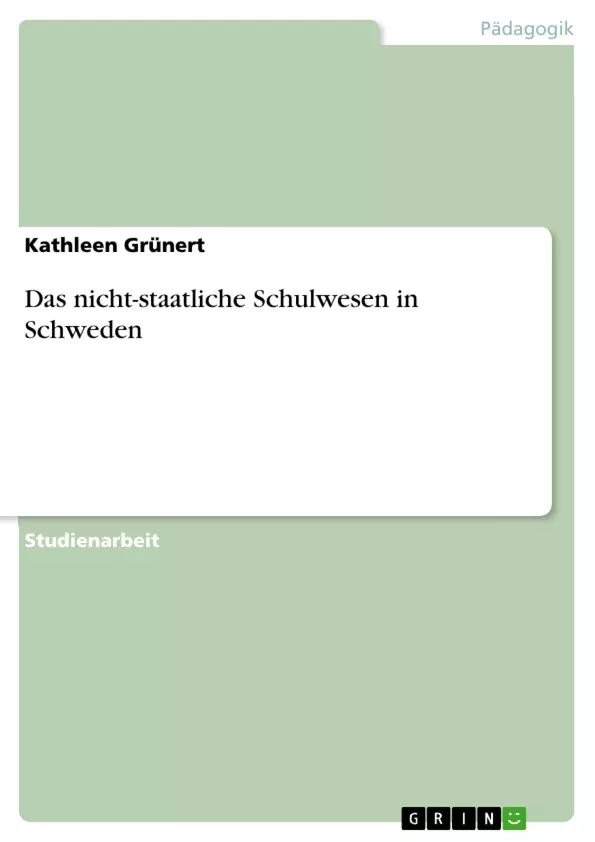Das nicht-staatliche Bildungswesen ist in den einzelnen Ländern Europas sehr unterschiedlich ausgebildet. Besuchen in Deutschland etwa zehn Prozent der Schüler nicht-staatliche Einrichtungen, so sind es in den Niederlanden weit über 70 Prozent.
Mit der folgenden Arbeit soll nun die aktuelle Situation in Schweden dargelegt werden. Hierzu steht zu Beginn eine genaue Betrachtung des Gesamtschulwesens in Schweden im Vordergrund, um die Gesamtproblematik besser verdeutlichen zu können. Im Einzelnen soll hier ein Einblick in die historische Schulentwicklung gegeben werden und auf die gegenwärtige Organisation des Schulsystems sowie dessen Grundaufbau eingegangen werden. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich dann mit den nicht-staatlichen Schulen in Schweden. Auch hier soll ein kurzer historischer Überblick gegeben werden, um die gegenwärtige Situation genauer beleuchten zu können. Welche Auswirkungen sich durch den Einfluss der nicht-staatlichen Schulen ergeben, wird in einem abschließenden Punkt dargestellt.
Eine Schlussbetrachtung fasst dann noch einmal die wichtigsten aktuellen Punkte des schwedischen Bildungssystems zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das schwedische Schulwesen
- 2.1 Ein Abriss der historischen Schulentwicklung
- 2.2 Die Organisation des gegenwärtigen Schulsystems
- 2.3 Der Grundaufbau
- 3. Die nicht-staatlichen Schulen im schwedischen Schulsystem
- 3.1 Ein historischer Überblick
- 3.2 Die gegenwärtige Situation
- 3.3 Auswirkungen auf das bestehende Schulsystem
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das nicht-staatliche Schulwesen in Schweden und dessen Auswirkungen auf das gesamte schwedische Schulsystem. Zunächst wird das schwedische Schulsystem im Allgemeinen beleuchtet, bevor die nicht-staatlichen Schulen im Detail betrachtet werden. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der aktuellen Situation zu liefern.
- Historische Entwicklung des schwedischen Schulsystems
- Organisation des gegenwärtigen schwedischen Schulsystems
- Der Einfluss nicht-staatlicher Schulen auf das schwedische Schulsystem
- Der Grundaufbau des schwedischen Schulsystems
- Gegenwärtige Situation der nicht-staatlichen Schulen in Schweden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des nicht-staatlichen Bildungswesens in Europa ein und hebt die Unterschiede zwischen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden hervor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit: die Darstellung der aktuellen Situation des nicht-staatlichen Schulwesens in Schweden, eingebettet in eine Analyse des Gesamtschulsystems. Die historische Entwicklung, die gegenwärtige Organisation und der Grundaufbau des schwedischen Schulsystems werden als Grundlage für das Verständnis des nicht-staatlichen Sektors vorgestellt. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die nicht-staatlichen Schulen, ihren historischen Überblick und die Auswirkungen auf das bestehende System.
2. Das schwedische Schulwesen: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in das schwedische Schulsystem. Es beginnt mit einem Abriss der historischen Schulentwicklung, der die lange Friedensphase Schwedens seit 1814, den Einfluss des Protestantismus und die lange sozialdemokratische Regierungszeit als prägende Faktoren hervorhebt. Die Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Einführung der neunjährigen Grundschule und die Dezentralisierungsbestrebungen der 1990er Jahre werden umfassend diskutiert. Die Anpassungen an EU-Standards und die Umwandlung der Schulen in Ganztagseinrichtungen werden ebenfalls thematisiert. Das Kapitel analysiert den Einfluss dieser historischen und politischen Entwicklungen auf das heutige Schulsystem.
2.1 Ein Abriss der historischen Schulentwicklung: Dieser Abschnitt beleuchtet die historischen Entwicklungen, die das schwedische Schulsystem geprägt haben. Er konzentriert sich auf die Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere die Einführung der neunjährigen Grundschule (grundskola) im Jahr 1946 als Reaktion auf die Empfehlungen einer Schulkommission. Der Abschnitt untersucht auch die späteren Dezentralisierungsbestrebungen der 1990er Jahre, die den Gemeinden mehr Verantwortung für die Organisation des Bildungswesens übertrugen, sowie die Anpassungen an EU-Standards, die zu einer Verkürzung der Gymnasialzeit führten.
2.2 Die Organisation des gegenwärtigen Schulsystems: Hier wird die Organisation des aktuellen schwedischen Schulsystems beschrieben. Das oberste Ziel ist die Bereitstellung eines nationalen Schulsystems mit gleichem Zugang und gleichen Lernbedingungen für alle Schüler. Die Organisation ist durch staatliche Zielsteuerung und kommunale Verantwortung gekennzeichnet. Der Reichstag und die Regierung bestimmen übergreifende Ziele und Richtlinien, während die Gemeinden für die konkrete Umsetzung verantwortlich sind. Das Kapitel beschreibt die Rolle des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft und des Skolverket (Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung) bei der Aufsicht und der Datenerhebung. Die Rolle des Lehrplans von 1994 und die Rechte der Eltern werden ebenfalls erläutert.
3. Die nicht-staatlichen Schulen im schwedischen Schulsystem: Dieses Kapitel befasst sich mit den nicht-staatlichen Schulen in Schweden. Es beinhaltet einen historischen Überblick über deren Entwicklung und untersucht die gegenwärtige Situation. Der Einfluss dieser Schulen auf das bestehende Schulsystem wird analysiert und kritisch beleuchtet. Das Kapitel wird die komplexen Interaktionen und Auswirkungen dieser Schulen auf das schwedische Bildungssystem im Detail untersuchen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum schwedischen Schulwesen und nicht-staatlichen Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das nicht-staatliche Schulwesen in Schweden und dessen Auswirkungen auf das gesamte schwedische Schulsystem. Sie beleuchtet das schwedische Schulsystem im Allgemeinen und betrachtet anschließend die nicht-staatlichen Schulen detailliert. Ziel ist ein umfassendes Bild der aktuellen Situation.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des schwedischen Schulsystems, die Organisation des gegenwärtigen Systems, den Einfluss nicht-staatlicher Schulen, den Grundaufbau des Systems und die gegenwärtige Situation nicht-staatlicher Schulen in Schweden. Spezifische Aspekte umfassen die Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Dezentralisierung der 1990er Jahre und die Anpassung an EU-Standards.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zum schwedischen Schulwesen (inklusive historischer Entwicklung und Organisation des aktuellen Systems), ein Kapitel zu den nicht-staatlichen Schulen (mit historischem Überblick und Analyse der Auswirkungen) und eine Schlussbetrachtung. Kapitel 2 ist weiter untergliedert in Abschnitte zur historischen Entwicklung und zur Organisation des gegenwärtigen Schulsystems.
Welche Aspekte der historischen Entwicklung des schwedischen Schulsystems werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die lange Friedensphase Schwedens seit 1814, den Einfluss des Protestantismus und die lange sozialdemokratische Regierungszeit als prägende Faktoren. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg (Einführung der neunjährigen Grundschule), den Dezentralisierungsbestrebungen der 1990er Jahre und der Anpassung an EU-Standards (Verkürzung der Gymnasialzeit).
Wie ist das gegenwärtige schwedische Schulsystem organisiert?
Das schwedische Schulsystem zeichnet sich durch staatliche Zielsteuerung und kommunale Verantwortung aus. Der Reichstag und die Regierung legen übergreifende Ziele und Richtlinien fest, während die Gemeinden für die Umsetzung verantwortlich sind. Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft und das Skolverket (Zentralamt für Schule und Erwachsenenbildung) überwachen und sammeln Daten. Der Lehrplan von 1994 und die Rechte der Eltern spielen ebenfalls eine Rolle.
Was wird über nicht-staatliche Schulen in Schweden behandelt?
Das Kapitel zu den nicht-staatlichen Schulen bietet einen historischen Überblick über deren Entwicklung und analysiert die gegenwärtige Situation. Der Schwerpunkt liegt auf den komplexen Interaktionen und Auswirkungen dieser Schulen auf das gesamte schwedische Bildungssystem. Eine kritische Beleuchtung der Einflüsse ist Bestandteil der Analyse.
Welche Länder werden im Vergleich zum schwedischen System erwähnt?
Die Einleitung vergleicht das schwedische System mit anderen europäischen Ländern, insbesondere Deutschland und den Niederlanden, um die Besonderheiten des schwedischen Modells im Kontext des europäischen Bildungssystems hervorzuheben.
- Arbeit zitieren
- Kathleen Grünert (Autor:in), 2007, Das nicht-staatliche Schulwesen in Schweden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125704