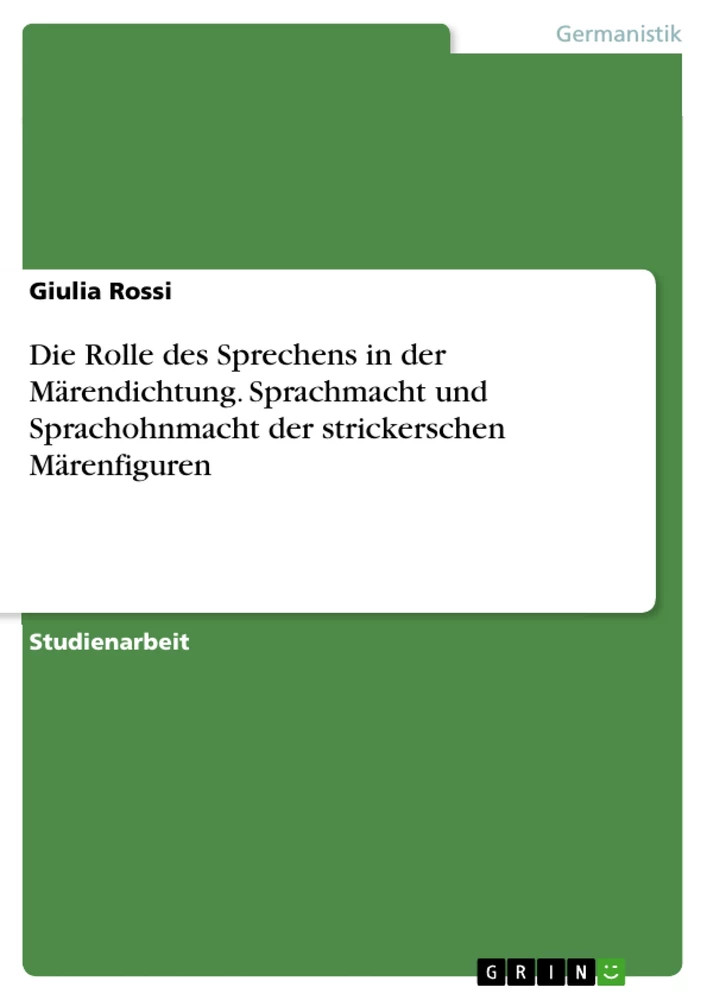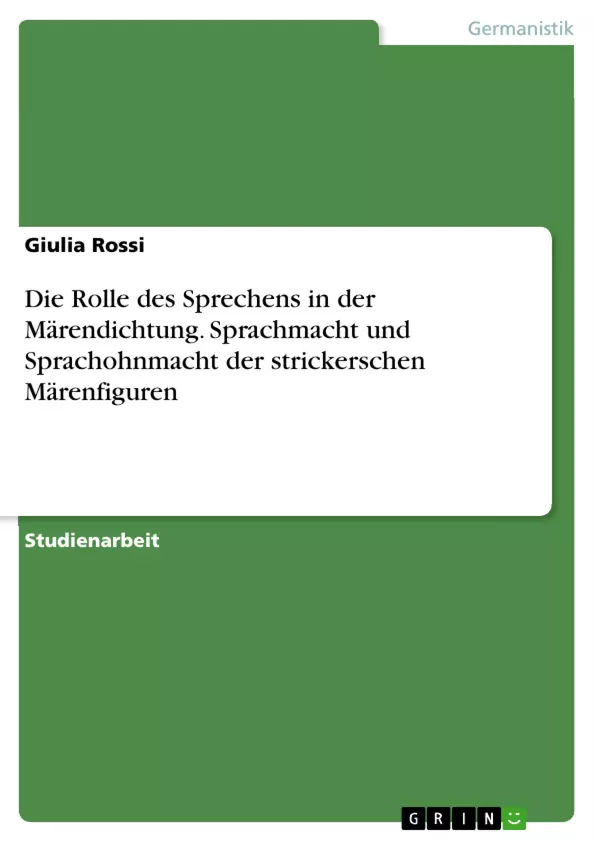Das Sprechen in mittelalterlichen Kurzerzählungen nicht nur der Gattungseinteilung dienlich ist, sondern durch seine Lebensnähe
auch literarische Kompositionen und Konstellationen den Zuhörern begreiflich macht und zu einer "kulturelle[n] Verständigung" führt, scheint einem literaturwissenschaftlichen Konsens nahezukommen. Welche besondere Rolle das Sprechen der Figuren in der Märendichtung spielen kann, wird in dieser Arbeit anhand eines theoretischen Überblicks der mediävistischen Forschungsmeinungen umrissen. Anschließend dient die Bearbeitung der vier Stricker-Mären "Die eingemauerte Frau", "Der begrabene Ehemann", "Das heiße Eisen" sowie "Die drei Wünsche" dazu, deren immanente sprachliche Funktionen zu untersuchen und die zuvor erarbeiteten theoretischen Aussagen gegebenenfalls zu ergänzen. Hierbei wird der These nachgegangen, dass in einigen Mären des Strickers deutlich wird, dass die weibliche Sprachgewandtheit ein entscheidendes, aber auch problematisches, da gegen sich selbst kehrendes Machtinstrument darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Überblick
- Funktion der Figurenrede in Mären
- Geschlechtsspezifische Sprachverwendung
- Analyse des Sprachgebrauchs in ausgewählten Mären des Strickers
- Die eingemauerte Frau (von einem übelen wîbe)
- Der begrabene Ehemann (diz maere ist wie ein wîp iren man lebendic begruop iesan)
- Das heisse Eisen (von dem heizen îsen)
- Die drei Wünsche (ein maere von drîen wünschen)
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion der Sprache in den Mären des Strickers und analysiert, wie die Figuren durch ihre Redehandlungen die Handlung beeinflussen und ihre Machtverhältnisse gestalten. Dabei liegt der Fokus auf der geschlechtsspezifischen Sprachverwendung, insbesondere auf der Rolle der Frau als Sprecherin und ihrer sprachlichen Einflussnahme.
- Die Funktion der Figurenrede in mittelalterlichen Mären
- Die Bedeutung der Sprache als Handlungsinstrument
- Die Rolle der Sprache in der Gestaltung von Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau
- Die Analyse der weiblichen Sprachgewandtheit als Machtinstrument
- Die Frage der Geschlechterrollen und der sprachlichen Dominanz in den Mären des Strickers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Märendichtung im Mittelalter ein und erläutert die Bedeutung der Figurenrede in dieser Literaturform. Es wird auf die grosse Verbreitung von Mären und die Schwierigkeiten bei der Definition der Gattung hingewiesen.
Theoretischer Überblick
Der theoretische Überblick beleuchtet die verschiedenen Funktionen der Figurenrede in Mären. Es wird gezeigt, wie die Rede den Aufbau der Erzählung gliedern, die Personenkonstellation bestimmen und den Witz erzeugen kann. Weiterhin wird die Sprache als Handlungsinstrument betrachtet und die Bedeutung von sprachlicher Gewandtheit in Bezug auf Machtverhältnisse zwischen den Figuren hervorgehoben.
Analyse des Sprachgebrauchs in ausgewählten Mären des Strickers
Dieser Abschnitt behandelt die sprachliche Gestaltung in vier ausgewählten Mären des Strickers: Die eingemauerte Frau, Der begrabene Ehemann, Das heisse Eisen und Die drei Wünsche. Die Analyse fokussiert auf die spezifischen Redehandlungen der Figuren und untersucht, wie die Sprache zur Charakterisierung der Personen beiträgt und die Handlung vorantreibt.
Schlüsselwörter
Märendichtung, Figurenrede, Geschlechtsspezifische Sprachverwendung, Rhetorik, Machtinstrument, Machtverhältnisse, Sprachhandlung, Mittelalter, Stricker.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt das Sprechen in der Märendichtung?
Das Sprechen dient nicht nur der Gattungseinteilung, sondern macht literarische Konstellationen begreiflich und fungiert als zentrales Handlungsinstrument zur Gestaltung von Machtverhältnissen.
Wer war „Der Stricker“?
Der Stricker war ein bedeutender Dichter des 13. Jahrhunderts, der als Wegbereiter der mittelhochdeutschen Kurzerzählung (Märe) gilt.
Wird in den Mären eine geschlechtsspezifische Sprache verwendet?
Ja, die Arbeit untersucht, wie weibliche Sprachgewandtheit als Machtinstrument eingesetzt wird, um Männer zu überlisten, was jedoch oft problematische Folgen für die Frauen selbst hat.
Welche Mären des Strickers werden analysiert?
Analysiert werden: „Die eingemauerte Frau“, „Der begrabene Ehemann“, „Das heiße Eisen“ und „Die drei Wünsche“.
Wie trägt die Figurenrede zum Witz eines Mären bei?
Die Redehandlungen erzeugen oft komische Situationen durch Ironie, Schlagfertigkeit oder das bewusste Missverstehen von Worten, was den Unterhaltungswert der Erzählungen steigert.
- Citar trabajo
- Giulia Rossi (Autor), 2018, Die Rolle des Sprechens in der Märendichtung. Sprachmacht und Sprachohnmacht der strickerschen Märenfiguren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257339