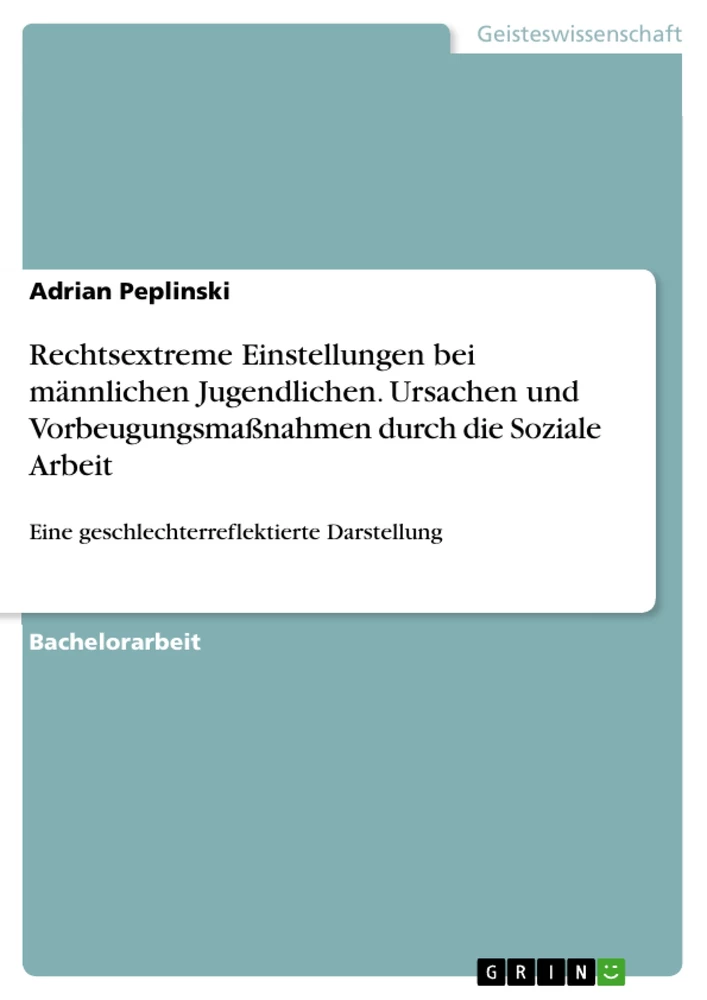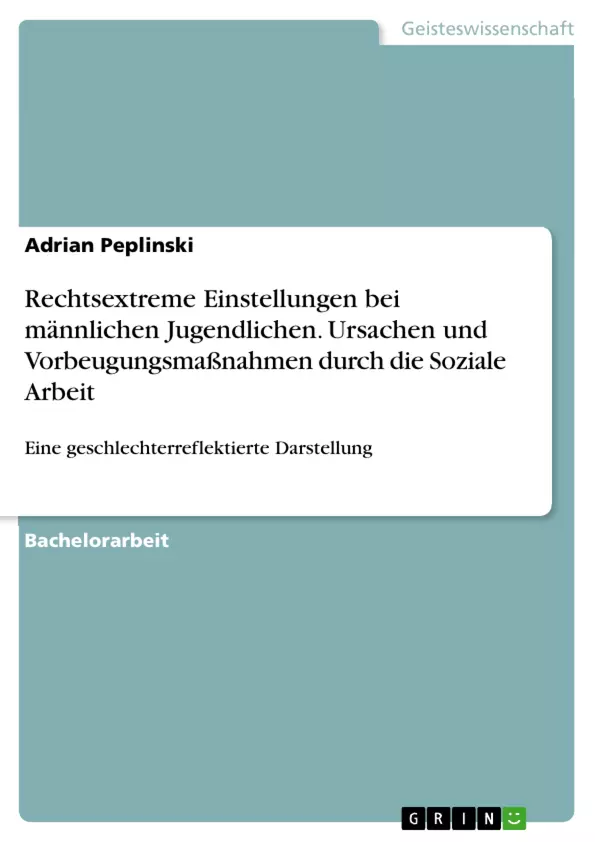Das Ziel der Arbeit besteht darin aufzuführen, welche Kriterien für rechtsextreme Einstellungen bei männlichen Jugendlichen verantwortlich sein können und welche Rolle die Soziale Arbeit übernehmen kann. Dementsprechend wird folgende Forschungsfrage gestellt: Welche Ursachen tragen dazu bei, dass männliche Jugendliche zu rechtsextremen Einstellungen neigen und kann Soziale Arbeit dem vorbeugend und effektiv entgegentreten? Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt.
Wenn von Rechtsextremismus gesprochen wird, dann wird dies meistens mit Bildern von kahlköpfigen und gewaltbereiten Männern in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund erscheint eine geschlechterspezifische Auseinandersetzung notwendig und sinnvoll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Strukturierung der Arbeit
- 2 Forschungsmethodik
- 3 Rechtsextremismusforschung
- 3.1 Einordnung der Begrifflichkeit Rechtsextremismus
- 3.2 Das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF)
- 3.3 Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Mitte-Studie 2021
- 3.3.1 Ergebnisse der Mitte-Studie 20/21
- 3.3.2 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Mitte-Studie
- 4 Kritische Männlichkeitsforschung
- 4.1 Connells Konzept der Männlichkeitskonstruktion
- 4.2 Die männliche Herrschaft nach Pierre Bourdieu
- 4.3 Homosoziale Männergemeinschaften nach Meuser
- 5 Männliche Sozialisation
- 5.1 Sozialisationsinstanz Familie
- 5.2 Sozialisationsinstanz Peer-Group
- 6 Jungenarbeit
- 6.1 Begriffsdefinition
- 6.2 Zielgruppen und Ziele
- 6.3 Lebenslagen von Jungen
- 6.3.1 Die Mikrodimension
- 6.3.2 Die Makrodimension
- 6.4 Angebote und Inhalte
- 7 Geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention
- 7.1 Rollenbewusstsein von Pädagogen und Pädagoginnen
- 7.2 Präventive und geschlechterreflektierte Herangehensweisen
- 8 Zusammenfassung und Diskussion der zentralen Ergebnisse
- 8.1 Zusammenstellung der Ergebnisse
- 8.2 Diskussion zu den Ursachen rechtsextremer Einstellungen bei Jungen
- 8.3 Diskussion hinsichtlich vorbeugender und effektiver Sozialer Arbeit
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen rechtsextremer Einstellungen bei männlichen Jugendlichen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention. Die Forschungsfrage lautet: „Welche Ursachen tragen dazu bei, dass männliche Jugendliche zu rechtsextremen Einstellungen neigen und kann Soziale Arbeit dem vorbeugend und effektiv entgegentreten?“
- Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Gegebenheiten, stereotypischen männlichen Einstellungen und biographischen Ereignissen im Leben männlicher Jugendlicher.
- Das Konzept der Männlichkeit und dessen Einfluss auf rechtsextreme Ideologien.
- Analyse der Rolle von Sozialisationsinstanzen (Familie, Peergroup) in der Entwicklung rechtsextremer Einstellungen.
- Potenzial der Jungenarbeit in der geschlechterreflektierten Rechtsextremismusprävention.
- Bewertung bestehender präventiver Angebote und deren Wirksamkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des rechtsextremen Männerbildes ein und erläutert die Problem- und Zielstellung der Arbeit. Sie verweist auf aktuelle Beispiele aus Medienberichten, die den Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und maskulinen Phänomenen belegen. Die zunehmende mediale Aufmerksamkeit auf rechtsextreme Strukturen innerhalb von Polizei und Bundeswehr unterstreicht die Notwendigkeit einer geschlechterspezifischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Einleitung legt den Grundstein für die Forschungsfrage und die Strukturierung der gesamten Arbeit.
2 Forschungsmethodik: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext. Es muss hier eine Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden eingefügt werden, basierend auf den Informationen im Ausgangstext.)
3 Rechtsextremismusforschung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in die Rechtsextremismusforschung. Es definiert den Begriff Rechtsextremismus, beleuchtet das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) und analysiert die Ergebnisse der FES Mitte-Studie 2021. Die Studie liefert wichtige Daten zur Verbreitung rechtsextremer Einstellungen und deren Zusammenhang mit Geschlecht. Der Fokus liegt auf der überproportionalen Beteiligung von Männern im rechtsextremen Spektrum.
4 Kritische Männlichkeitsforschung: Dieses Kapitel untersucht kritisch verschiedene Konzepte der Männlichkeitskonstruktion. Es analysiert Connells Konzept, Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft und Meusers Arbeit zu homosozialen Männergemeinschaften. Diese Theorien bieten einen theoretischen Rahmen, um die Entstehung und Aufrechterhaltung rechtsextremer Männlichkeit zu verstehen. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen Mechanismen, die bestimmte Männlichkeitsbilder fördern und rechtsextreme Einstellungen begünstigen können.
5 Männliche Sozialisation: Dieses Kapitel befasst sich mit den Sozialisationsprozessen, die zur Entwicklung von Männlichkeit beitragen. Es untersucht die Rolle der Familie und der Peergroup als Sozialisationsinstanzen und analysiert, wie diese Instanzen die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen, die zu Rechtsextremismus führen können, beeinflussen. Die Kapitel analysiert, wie diese frühen Erfahrungen das spätere Verhalten und die Weltanschauung prägen.
6 Jungenarbeit: Das Kapitel definiert den Begriff Jungenarbeit und beschreibt die Zielgruppen und Ziele dieser Arbeit. Es analysiert die Lebenslagen von Jungen, sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene, um die Herausforderungen und Bedarfe zu verstehen. Darüber hinaus werden verschiedene Angebote und Inhalte der Jungenarbeit präsentiert, die in der Prävention von Rechtsextremismus eingesetzt werden können.
7 Geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention: Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Rollenbewusstseins von Pädagogen und Pädagoginnen in der Prävention von Rechtsextremismus. Es präsentiert präventive und geschlechterreflektierte Herangehensweisen, die sich gezielt an männliche Jugendliche richten und die spezifischen Mechanismen von rechtsextremer Männlichkeit berücksichtigen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Interventionen, die auf die Ursachen rechtsextremer Einstellungen eingehen und eine nachhaltige Veränderung bewirken.
Schlüsselwörter
Rechtsextremismus, Männlichkeit, Geschlecht, Jungen, Jungenarbeit, Geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention, Sozialisation, Prävention, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF), Männlichkeitskonstruktionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse rechtsextremer Einstellungen bei männlichen Jugendlichen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen rechtsextremer Einstellungen bei männlichen Jugendlichen und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Prävention. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Welche Ursachen tragen dazu bei, dass männliche Jugendliche zu rechtsextremen Einstellungen neigen und kann Soziale Arbeit dem vorbeugend und effektiv entgegentreten?"
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Gegebenheiten, stereotypischen männlichen Einstellungen und biographischen Ereignissen im Leben männlicher Jugendlicher. Sie analysiert das Konzept der Männlichkeit und dessen Einfluss auf rechtsextreme Ideologien, die Rolle von Sozialisationsinstanzen (Familie, Peergroup), das Potenzial der Jungenarbeit in der geschlechterreflektierten Rechtsextremismusprävention und bewertet bestehende präventive Angebote und deren Wirksamkeit.
Welche Methoden wurden angewendet?
Eine detaillierte Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden fehlt im vorliegenden Text. Diese Information muss ergänzt werden.
Wie wird Rechtsextremismus definiert?
Die Arbeit bietet eine umfassende Einführung in die Rechtsextremismusforschung, inklusive einer Definition des Begriffs Rechtsextremismus. Sie beleuchtet das Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) und analysiert relevante Ergebnisse der FES Mitte-Studie 2021, die die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen und deren Zusammenhang mit Geschlecht aufzeigt.
Welche Rolle spielt die kritische Männlichkeitsforschung?
Die Arbeit untersucht kritische Konzepte der Männlichkeitskonstruktion (Connell, Bourdieu, Meuser), um die Entstehung und Aufrechterhaltung rechtsextremer Männlichkeit zu verstehen. Der Fokus liegt auf gesellschaftlichen Mechanismen, die bestimmte Männlichkeitsbilder fördern und rechtsextreme Einstellungen begünstigen können.
Wie werden die Sozialisationsprozesse betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Familie und der Peergroup als Sozialisationsinstanzen und wie diese die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflussen, die zu Rechtsextremismus führen können. Der Fokus liegt auf den frühen Erfahrungen und deren Einfluss auf das spätere Verhalten und die Weltanschauung.
Welche Rolle spielt die Jungenarbeit?
Die Arbeit definiert Jungenarbeit, beschreibt Zielgruppen und Ziele und analysiert die Lebenslagen von Jungen (Mikro- und Makroebene). Sie präsentiert Angebote und Inhalte der Jungenarbeit in der Rechtsextremismusprävention.
Wie wird geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention behandelt?
Die Arbeit beleuchtet das Rollenbewusstsein von Pädagogen und Pädagoginnen und präsentiert präventive und geschlechterreflektierte Herangehensweisen, die sich an männliche Jugendliche richten und die spezifischen Mechanismen rechtsextremer Männlichkeit berücksichtigen. Der Fokus liegt auf Interventionen, die auf die Ursachen rechtsextremer Einstellungen eingehen.
Welche Ergebnisse werden zusammengefasst und diskutiert?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen, diskutiert die Ursachen rechtsextremer Einstellungen bei Jungen und analysiert vorbeugenden und effektive Ansätze der Sozialen Arbeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Rechtsextremismus, Männlichkeit, Geschlecht, Jungen, Jungenarbeit, Geschlechterreflektierte Rechtsextremismusprävention, Sozialisation, Prävention, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF), Männlichkeitskonstruktionen.
- Quote paper
- Adrian Peplinski (Author), 2022, Rechtsextreme Einstellungen bei männlichen Jugendlichen. Ursachen und Vorbeugungsmaßnahmen durch die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257366