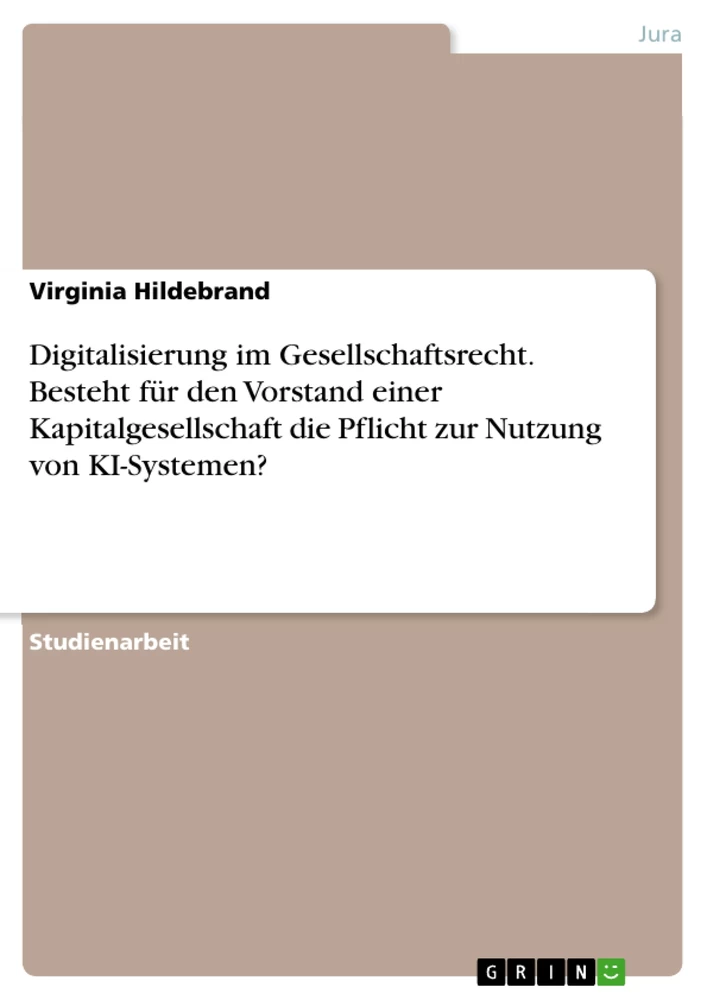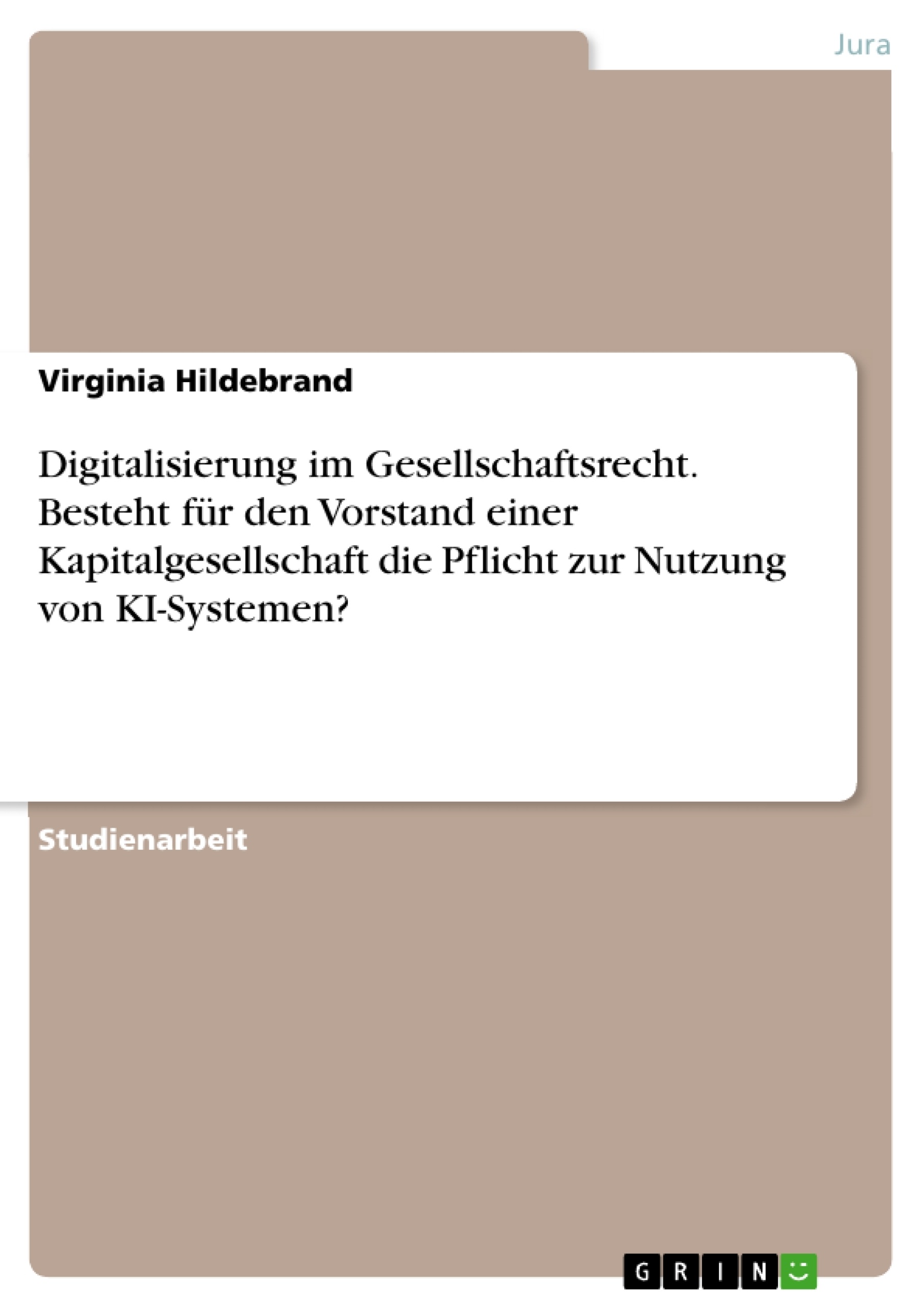Könnte die Delegation von Aufgaben an KI-Systeme für den Vorstand einer Kapitalgesellschaft verpflichtend sein oder werden? Der Vorstand einer Kapitalgesellschaft hat die Entscheidungen für das Unternehmen auf Basis angemessener Informationen zu treffen. Diese Pflicht des Vorstandes geht aus der im Aktienrecht verankerten Business Judgement Rule hervor. Nach § 93 Absatz 1 Satz 2 AktG überschreitet ein Vorstandsmitglied seinen Entscheidungsspielraum, sobald die getroffenen unternehmerischen Entscheidungen nicht auf einer angemessenen Informationsgrundlage basieren. Fraglich ist diesbezüglich, ob sich daraus eine Pflicht zur Nutzung von intelligenten Algorithmen zur Entscheidungsfindung ableiten lässt und welchen Einfluss die zunehmende Genauigkeit und der gängigere Einsatz von KI sowie die mit ihr verbundenen abnehmenden Anschaffungs- und Einsatzkosten haben.
Diese Fragen werden im Rahmen dieser Ausarbeitung beantwortet, um schließlich beantworten zu können, ob für Vorstände eine Pflicht zur Nutzung von KI-Systemen besteht. Dafür wird im zweiten Kapitel auf die Definitionsmöglichkeiten von KI-Systemen eingegangen. Im dritten Kapitel werden die Aufgaben des Vorstands erläutert. Darauf basierend werden die Nutzungsmöglichkeiten von KI-Systemen im Vorstand näher betrachtet. Im ersten Schritt des Kapitels wird dargestellt, aus welchen Gründen KI-Systeme keine Vorstandsmitglieder sein können und im zweiten Schritt wird geprüft, welche anderen rechtlich zulässigen Einsatzmöglichkeiten für KI-Systemen im Vorstand bestehen. Darauf aufbauend wird im Hauptteil die Pflicht zum Einsatz von KI-Systemen im Rahmen der Vorstandstätigkeit geprüft. Hierbei wird zwischen dem Einsatz von KI zur Informationsbeschaffung und dem Einsatz von KI zur Delegation von Aufgaben unterschieden.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- KI-Systeme
- Die Aufgaben eines Vorstands
- Nutzung von KI im Vorstand
- KI als Mitglied des Vorstands
- Zulässigkeit des Einsatzes von KI-Systemen im Vorstand
- Grenzen der Delegation von Leitungsaufgaben
- Technische Beherrschbarkeit von KI-Systemen
- Pflicht zum Einsatz von KI innerhalb des Vorstands
- Einsatz von KI zur Informationsbeschaffung
- Handeln auf Basis angemessener Informationen
- Überlegenheit von Algorithmen im Rahmen der Informationsbeschaffung
- Einsatz von KI-Systemen zur Delegation von Aufgaben
- Bestehender verpflichtender Einsatz von KI-Systemen
- ISION-Grundsätze
- Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Systemen im Rahmen der Aufgabendelegation
- Einsatz von KI zur Informationsbeschaffung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, ob für Vorstände von Kapitalgesellschaften eine Pflicht zur Nutzung von KI-Systemen besteht. Sie untersucht die Möglichkeiten des Einsatzes von KI im Vorstand und analysiert, inwieweit die Delegation von Aufgaben an KI-Systeme rechtlich zulässig und gegebenenfalls verpflichtend ist.
- Definition und Funktionsweise von KI-Systemen
- Aufgaben des Vorstands im Kontext von KI-Systemen
- Rechtliche Zulässigkeit und Grenzen des Einsatzes von KI im Vorstand
- Pflicht zum Einsatz von KI zur Informationsbeschaffung und Aufgaben-Delegation
- Mögliche Auswirkungen von KI-Systemen auf die Entscheidungsfindung im Vorstand
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung von KI im Kontext der Unternehmensführung. Kapitel 2 bietet eine Definition von KI-Systemen und vergleicht sie mit herkömmlicher Software. Kapitel 3 beschreibt die Aufgaben eines Vorstands im Aktienrecht und die Bedeutung der Business Judgement Rule.
Kapitel 4 behandelt die Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von KI im Vorstand. Es wird untersucht, ob KI-Systeme als Vorstandsmitglieder eingesetzt werden können und welche anderen Formen der Einbeziehung von KI im Vorstand rechtlich zulässig sind.
Kapitel 5 befasst sich mit der Pflicht zum Einsatz von KI innerhalb des Vorstands. Es wird zwischen dem Einsatz von KI zur Informationsbeschaffung und dem Einsatz von KI zur Delegation von Aufgaben unterschieden.
Schlüsselwörter
Künstliche Intelligenz (KI), Algorithmen, Vorstand, Kapitalgesellschaft, Business Judgement Rule, Delegation, Informationsbeschaffung, Rechtliche Zulässigkeit, Pflicht, ISION-Grundsätze
Häufig gestellte Fragen
Haben Vorstände eine Pflicht zur Nutzung von KI-Systemen?
Eine direkte gesetzliche Pflicht besteht noch nicht explizit, aber aus der Business Judgement Rule (§ 93 AktG) ergibt sich die Pflicht, Entscheidungen auf Basis angemessener Informationen zu treffen. Wenn KI hierbei überlegene Daten liefert, könnte ihr Einsatz indirekt verpflichtend werden.
Darf eine KI selbst Vorstandsmitglied sein?
Nein, nach aktuellem deutschem Recht können nur natürliche Personen Vorstandsmitglieder einer Kapitalgesellschaft sein. KI-Systeme dienen lediglich als Unterstützungswerkzeuge.
Was ist die Business Judgement Rule im Kontext von KI?
Diese Regel schützt Vorstände bei unternehmerischen Entscheidungen, sofern sie auf einer "angemessenen Informationsgrundlage" basieren. KI kann helfen, diese Grundlage durch Datenanalyse zu verbreitern.
Wo liegen die Grenzen bei der Delegation an KI?
Der Vorstand darf seine Kernaufgaben (Leitungsaufgaben) nicht vollständig delegieren. Er muss die technische Beherrschbarkeit sicherstellen und die Letztentscheidungsgewalt behalten.
Was sind die ISION-Grundsätze?
Dies sind rechtliche Grundsätze zur Compliance und Überwachungspflicht des Vorstands, die auch bei der Einführung komplexer IT- und KI-Systeme zur Risikominimierung herangezogen werden.
- Quote paper
- Virginia Hildebrand (Author), 2021, Digitalisierung im Gesellschaftsrecht. Besteht für den Vorstand einer Kapitalgesellschaft die Pflicht zur Nutzung von KI-Systemen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257370