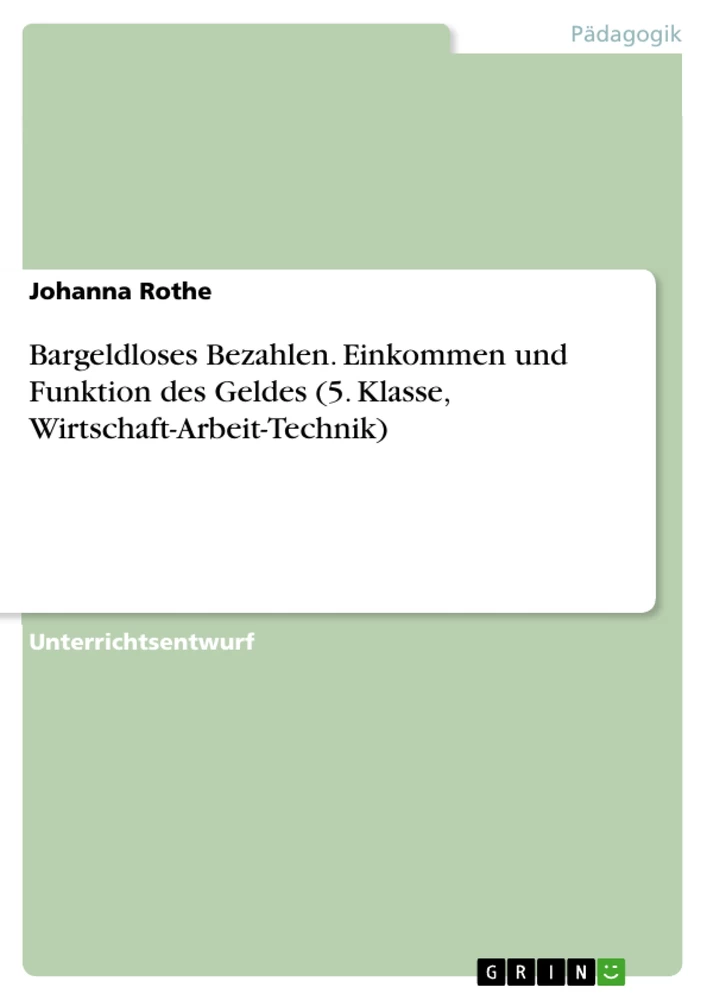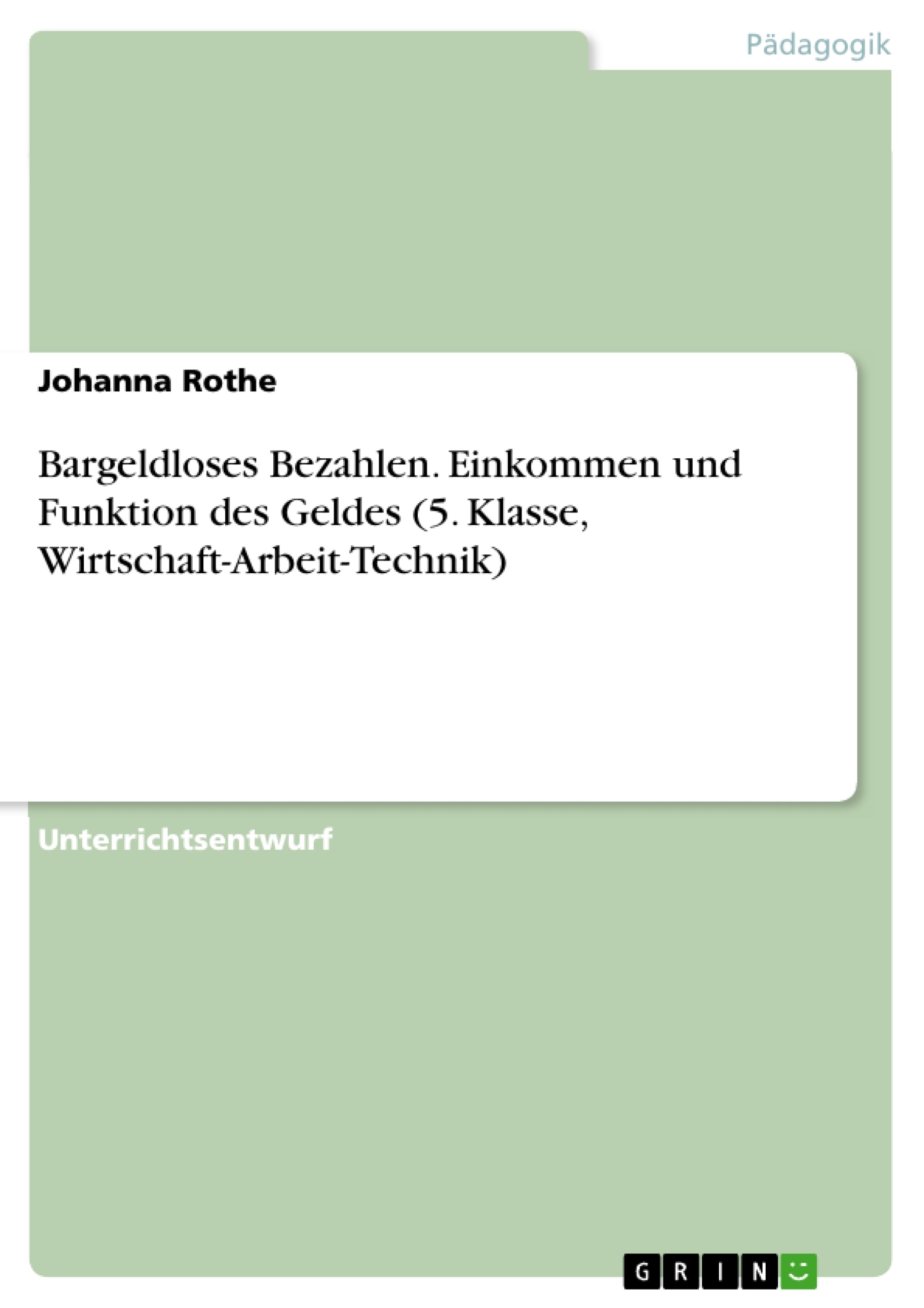Ziel der Unterrichtseinheit hinsichtlich des Rahmenlehrplans ist, dass die Schülerinnen und Schüler einen ersten Zugang zur wirtschaftlichen Grundbildung über den ihnen vertrauten privaten Haushalt in einer Form der Lebensgemeinschaft erhalten.
Die Sequenz verfolgt das Ziel, dass die SchülerInnen das Einkommen und die Funktion des Geldes in einen privaten wirtschaftlichen Zusammenhang bringen, in dem sie sich mit der Geschichte und Entwicklung sowie den verschiedenen Formen und Verwendungszwecken des Geldes auseinandersetzten. Durch die Einbindung vieler Partner- und Gruppenarbeiten, Gruppenpuzzeln oder Rollenspielen, werden die SchülerInnen gefordert eigenständig zu arbeiten. Da die Lerngruppe viele Formen des freien und schülerzentrierten Unterrichts noch nicht gewöhnt ist, dient diese Sequenz zur Heranführung und Eingewöhnung der SchülerInnen sowie zur Übung für uns Studierende. Die Schülerinnen erhalten im Unterricht Freiräume für eigene Ideen und Vorstellungen, solle jedoch anhand von Vorgaben ein bestimmtes Endprodukt abliefern. Ebenfalls sind die Arbeitsaufträge durch helfende Fragestellungen gegliedert, um den SchülerInnen den Einsteig in die Arbeitsphase zu erleichtern und ihnen eine Orientierung über das entstehende Produkt zu geben. Um den SchülerInnen auch einen Sinn in der Bearbeitung zu geben, sind die ausgewählten Aufgaben in den meisten Fällen handlungsorientiert geplant, sodass die SchülerInnen einen Bezug zur Realität erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine und spezielle Lern- und Lehrbedingungen.
- Situationsspezifische Lehrvoraussetzungen und Besonderheiten der unterrichtlichen Situation
- Situationsspezifische Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler.
- Darstellung und Begründung didaktisch – methodischer Entscheidung.
- Kompetenzen und Standards
- Tabellarische Sequenzplanung.
- Didaktische Begründung und Zielvorstellungen zur geplanten Kompetenzentwicklung der Sequenz.
- Didaktisch-methodisches Konzept der Unterrichtsstunde
- Zielformulierung für die Unterrichtsstunde.....
- Grobziel
- Feinziele..........\li>
- Tabellarische Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde
- Quellen- und Literaturverzeichnis.
- Anhänge..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtssequenz befasst sich mit dem Thema Geld und dessen Bedeutung im täglichen Leben. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern einen grundlegenden Einblick in die Wirtschaft und die Funktionsweise des Geldes zu vermitteln.
- Entwicklung des Geldes von Tauschhandel zur Geldwirtschaft
- Formen und Funktionen des Geldes
- Bargeldloses Bezahlen und seine verschiedenen Formen
- Umgang mit Geld und Haushaltsplanung
- Arbeit und Einkommen als Lebensgrundlage
Zusammenfassung der Kapitel
Die erste Einheit der Sequenz behandelt die Entwicklung des Geldes vom Tauschhandel zur Geldwirtschaft und die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung. In der zweiten Einheit werden die verschiedenen Formen und Funktionen von Geld erläutert, während die dritte Einheit die Besonderheiten des Euro als Gemeinschaftswährung der EU beleuchtet. Die vierte Einheit befasst sich mit dem bargeldlosen Bezahlen und seinen verschiedenen Formen. Die fünfte Einheit behandelt das Thema Haushaltsplanung und wie man seine Ausgaben besser im Blick behält. Die sechste Einheit beleuchtet das Thema Taschengeld und die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler damit. Die siebte Einheit definiert Arbeit und Einkommen und beschreibt verschiedene Arbeitsmodelle. Die achte Einheit beleuchtet die Funktionsweise des Wirtschaftskreislaufes.
Schlüsselwörter
Die Unterrichtssequenz befasst sich mit den zentralen Themen Geld, Wirtschaft, Bargeldloses Bezahlen, Haushaltsplanung, Arbeit, Einkommen und Wirtschaftskreislauf. Es werden sowohl historische Aspekte der Entwicklung des Geldes als auch aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr beleuchtet. Weiterhin werden wichtige Aspekte der Finanzbildung und des Umgangs mit Geld im Alltag behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was lernen Schüler der 5. Klasse über die Geschichte des Geldes?
Sie lernen den Übergang vom Tauschhandel (Ware gegen Ware) zur Geldwirtschaft kennen und verstehen die Vorteile eines universellen Tauschmittels.
Welche Funktionen erfüllt Geld in unserem Wirtschaftssystem?
Geld dient als Tausch- und Zahlungsmittel, als Recheneinheit (Vergleichbarkeit von Preisen) und als Wertaufbewahrungsmittel (Sparen).
Was wird im Thema „Bargeldloses Bezahlen“ vermittelt?
Schüler setzen sich mit modernen Zahlungsformen wie Bankkarten und Überweisungen auseinander und diskutieren die Vor- und Nachteile gegenüber Bargeld.
Warum ist Haushaltsplanung ein Unterrichtsthema?
Es soll ein Bewusstsein für begrenzte Ressourcen geschaffen werden. Schüler lernen, Ausgaben zu planen und den Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenshaltungskosten zu verstehen.
Wie hängen Arbeit und Einkommen zusammen?
Der Unterricht zeigt auf, dass Arbeit in der Regel die Grundlage für das Einkommen eines Haushalts bildet, welches wiederum den Konsum im Wirtschaftskreislauf ermöglicht.
- Quote paper
- Johanna Rothe (Author), 2021, Bargeldloses Bezahlen. Einkommen und Funktion des Geldes (5. Klasse, Wirtschaft-Arbeit-Technik), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257892