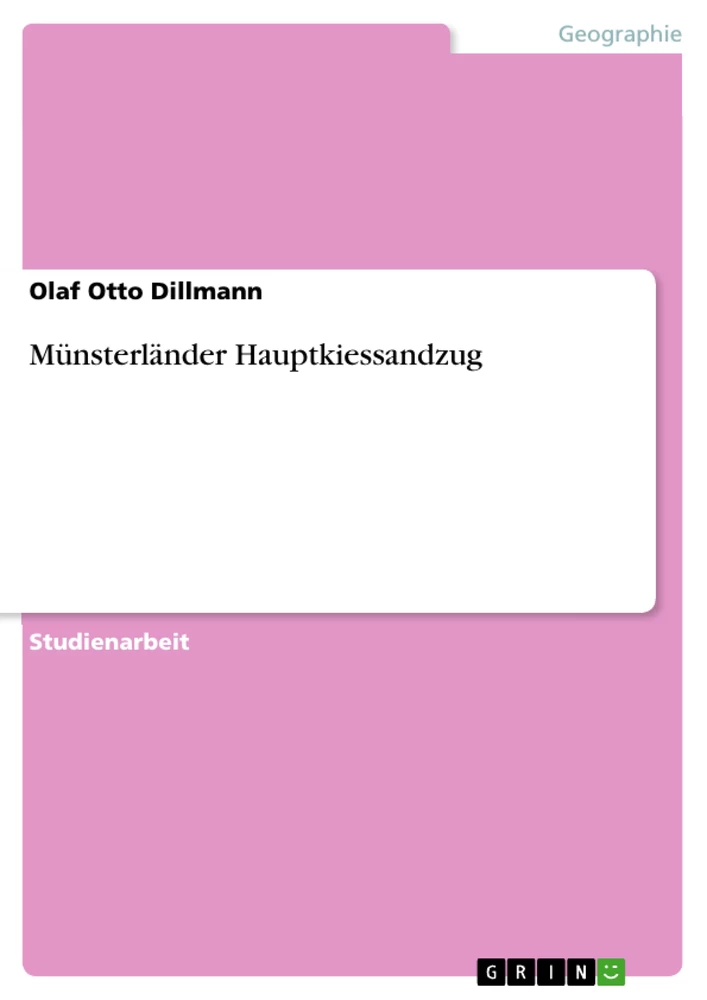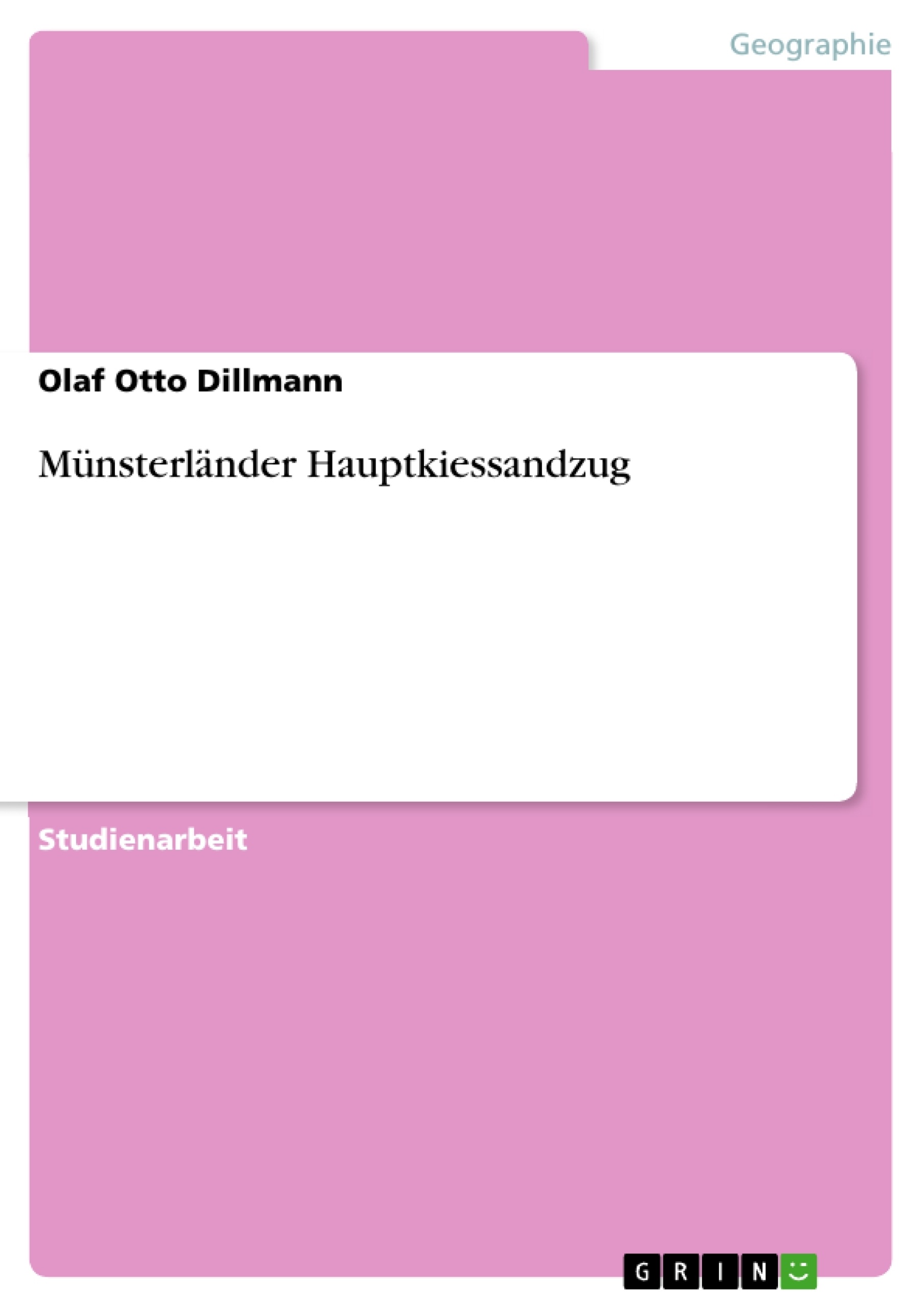Der Vortrag gibt einen Überblick über die Theorien zur Entstehung des Münsterländer Hauptkiessandzuges.
Der Münsterländer Hauptkiessandzug
(von Olaf Otto Dillmann)
Einleitung
Das Landschaftsbild der Westfälischen Bucht und damit des Münsterlandes wurde im Pleistozän, dem Eiszeitalter des Quartärs, geformt. Zweimal stieß das Inlandeis aus Skandinavien nach Westfalen vor, in der Elster-Kaltzeit vor etwa 400.000 Jahren und der Saale-Kaltzeit vor mehr als 200.000 Jahren. Das Inlandeis der Saale-Kaltzeit breitete sich in der gesamten Westfälischen Bucht aus und sein Vorstoß kam erst am Haarstrang und den Randhöhen des Rheinischen Schie- fergebirges zum Stillstand. Das Eis der Weichsel-Kaltzeit, die vor 10.000 Jahren zu Ende ging, erreichte dagegen Westfalen nicht mehr. In dieser letzten Kaltzeit breitete sich eine tundrenähn- liche Kältesteppe, in der es zur Anwehung von Dünen und Flugdecksanden kam, über das Mün- sterland aus.
Vor allem das Wirken des saalezeitlichen Inlandeises hat unübersehbare Spuren im Münsterland hinterlassen. Das Vordringen des Gletschers, das Oszillieren des Eisrandes, der vorübergehende Rückzug und das abermalige Vorstoßen des Inlandeises im Drenthe-Stadium und schließlich das endgültige Abschmelzen der Eismassen schufen eine Landschaft, die durch die Elemente des Glazialen Formenkreises, nämlich Grund- und Endmoränen, Vor- und Nachschüttsande, Sandr- Flächen, urstromtalartige Abflußrinnen, Kames und Oser, geprägt ist.
1. Verlauf und Aufbau
Von den glazialen Formen, deren Entstehung an die Vergletscherung der Westfälischen Bucht vor mehr als 200.000 Jahren geknüpft ist, dürfte der Münsterländer Hauptkiessandzug die auffälligste und hinsichtlich seiner Entstehung die am intensivsten diskutierte sein. Der Münsterländer Haupt- kiessandzug durchzieht als maximal 1km breiter aus Sanden und Kiesen bestehender Sediment- körper mit einer Länge von etwa 80km das Münsterland. Der Kiessandzug nimmt im Westfälischen Tiefland bei Schüttorf seinen Anfang und läuft in südöstliche Richtung auf Ahlintel zu. Bei Haddorf wird die nördliche Aufrichtungszone der Münsterländer Kreidemulde gequert und er tritt in die Westfälische Bucht ein. Südlich Ahlintel wird allmählich eine mehr südliche Richtung eingeschla- gen. Der Kiesandzug erreicht Münster und wendet sich allmählich nach Osten, um von Albersloh an einen Verlauf parallel zur Ems zu nehmen. Östlich von Ennigerloh am Nordrand der Beckumer Berge endet der Kiessandzug.
Der Kiessandzug erhebt sich über weite Strecken als Wallrücken über seine Umgebung. Durch die Abtragung ist der Wallrücken stellenweise eingeebnet oder in ein kuppiges Gelände verwandelt.
Die Sedimente des Kiessandzuges liegen überwiegend in einer Rinne, deren Sohle stellenweise bis weit über 20m in die oberkreidezeitlichen Ablagerungen eingetieft ist. Die Rinnensohle fällt mit 0,8 Promille nach Nordwesten ein. Die saalezeitliche Grundmoräne und die Sedimente der Kiessandzone sind randlich miteinander verzahnt. Es handelt sich also um zeitgleich entstandene Ablagerungen, die zwei verschiedene Faziesformen saalezeitlicher Glazialablagerungen darstellen. Die Kreuzschichtung sowie der horizontale und vertikale Materialwechsel kennzeichnen die Kiessande eindeutig als fluviatil bzw. fluvioglazial entstandenes, d.h. durch Schmelzwasser trans- portiertes und anschließend bei abnehmender Strömungsenergie abgelagertes, Sediment. Der Anteil des groben Materials nimmt innerhalb des Sedimentkörpers von Nordwesten nach Südosten ab. Somit wies einst die Strömung des abfließenden Schmelzwassers in südliche Richtung. Die nach Süden weisende Schüttungsrichtung steht im Gegensatz zur nordwärts gerichteten Neigung der Rinnensohle. Die Ablagerungen zeigen keine glaziären Störungen wie z.B. durch den Druck des Gletschereises entstandene Stauchungen.
Aus dem Bereich des Meßtischblattes Rheine beschreibt THIERMANN (1973) eine deutliche Zweiteilung der Sedimente des Kiessandzuges. Den Kern bilden kiesige Grobsande mit kopfgro- ßen Geschieben aus nordischem und lokalem Material sowie in gefrorenem Zustand transportierte Tongerölle, die heute zerfallen sind. Den nordischen Geschieben kommt eine besondere Bedeu- tung zu, weil sich unter ihnen sogenannte „Leitgeschiebe“ befinden, die Auskunft über die Her- kunftsgebiete und die Wanderwege des Inlandeises geben. Stellenweise sind auch Fein- und Mit- telsande eingeschaltet. Die Mächtigkeit dieser Schichten steigt auf Meßtischblatt Rheine bis auf 30m an. Darüber folgen gelbweiße, scharfe, teilweise tonige Mittelsande und Kiese ohne Geschie- beführung. Die Grobsande und -kiese des unteren Teils haben der Abtragung zum großen Teil widerstanden und überragen ihre Umgebung als Wallrücken. Die Schichten des oberen Teils sind teilweise bereits abgetragen und umgeben daher nur noch randlich die als Wallrücken herausra- genden tieferen Schichten. Diese Abtragung muß schon vor der Ablagerung der weichselzeitlichen Dünen und Flugdecksande erfolgt sein, weil diese den Kern schichten direkt aufliegen.
2. Theorien zur Entstehung
Die Rinne des Hauptkiessandzuges ist Teil eines eiszeitlichen Rinnensystems, durch das während der Saale-Kaltzeit die Schmelzwässer nach Süden zur Lippe-Urrinne und von dort nach Westen zum Rhein abfließen konnten.
Die Entstehung des Kiessandzuges hat bis heute keine abschließende Erklärung gefunden, ob- wohl seit über 100 Jahren darüber diskutiert wird. Schon VON DER MARCK und HOSIUS berich- teten 1858 bzw. 1872 über den auffälligen Wallrücken. THEODOR WEGNER deutete Anfang des 20. Jahrhunderts den Zug als „Münsterländer Endmoräne“. WOLFF (1928) hielt die Kiessandzone für eine kame- oder osartige Bildung. HANS SCHNEIDER (1938) entschied sich für eine alleinige Deutung als Os. Ein Os (Pl. Oser), auch Wallberg oder Esker genannt, ist ein schmaler (5 - 150m breiter), steilwandiger, bahndammähnlicher, zum Teil schwach gewundener Rücken, der am Grunde des Gletschers durch subglaziär abfließendes Wasser in einem Tunneltal aufgeschüttet wurde. Ein Kame (Pl. Kames) ist ein breiter (bis zu ca.1km), weniger steilwandiger Hügel, dessen Sedimente zwischen Toteisblöcken des abschmelzenden und zerfallenden Inlandeises abgelagert wurden. Kames zeichnen durch ihren Verlauf das ehemalige Kluft- und Spaltensystem nach, das entsprechend dem im Eis entwickelten Kräftefeld entweder parallel oder senkrecht zur Eis- schubrichtung gerichtet war.
Den Untersuchungen von LOTZE (1954) und BAECKER (1963) zufolge ist die Rinne des Kiessandzuges in ihrem südlichen Abschnitt bei Münster teilweise bereits vom elsterzeitlichen In- landeis eingetieft worden. In der anschließenden Holstein-Warmzeit verlegte ein von Süden kom- mender Fluß seinen Lauf streckenweise in diese Rinne. Nach der Überfahrung durch das saale- zeitliche Eis pauste sich die Rinne auf die Eisoberfläche durch und zog die Entwässerung der oberflächlich abfließenden Schmelzwässer an sich. In dieser Schmelzwasserrinne reicherten sich Sand und Kies durch Zusammenschwemmung von den Seiten her an und es entstand eine sehr viel mächtigere Ablagerung als unter den Eisflächen beiderseits. Das Eis taute schließlich ab und die zusammengeschwemmten Geröllmassen wurden dadurch auf der Sohle der Rinne abgesetzt, deren mächtige Sedimentfüllung als Wallrücken die beiderseitige Geschiebemergeldecke der Um- gebung überragte.
Im Gebiet des Kartenblattes Rheine dagegen ließ sich nach THIERMANN (1973) kein Nachweis für eine schon zu Beginn der Saale-Kaltzeit vorliegende Rinne finden. Hier scheint sie erst durch die Schmelzwässer im Toteis der Drenthe-Vereisung geschaffen zu sein, wobei die Klüfte im Eis den Wässern den Weg vorschrieben. Eine Erklärung für die Entstehung einer solchen langen Kluft fällt allerdings schwer. Durch das strömende Wasser wurde das Inlandeis schließlich durchschnit- ten, die Rinne in den Untergrund weiter eingetieft und dort die Schotterfracht abgelagert. Nach dem Abschmelzen des Eises blieb dann der Wallberg zurück. So deutet THIERMANN (1973) den Kiessandzug im Blattgebiet Rheine als Kame-Bildung. Allerdings schränkt auch THIERMANN ein, daß “Bei genauerer Betrachtung (...) die Entstehung jedoch noch komplexer zu sein (scheint) , denn nicht alle Beobachtungen über den Kiessandzug finden eine eingängige Erklärung“ . So ist z.B. südlich von Münster, zwischen Sendenhorst und Albersloh, die Rinne im Untergrund gegen- über dem Wallrücken mehrere hundert Meter nach Süden verschoben.
Häufig gestellte Fragen zum Münsterländer Hauptkiessandzug
Was ist der Münsterländer Hauptkiessandzug?
Der Münsterländer Hauptkiessandzug ist ein auffälliger Sedimentkörper aus Sanden und Kiesen im Münsterland. Er ist maximal 1 km breit, etwa 80 km lang und zieht sich vom Westfälischen Tiefland bei Schüttorf in südöstliche Richtung bis östlich von Ennigerloh am Nordrand der Beckumer Berge.
Wie ist der Münsterländer Hauptkiessandzug entstanden?
Die Entstehung des Münsterländer Hauptkiessandzuges ist komplex und noch nicht abschließend geklärt. Es gibt verschiedene Theorien, die ihn als Endmoräne, Kame oder Os deuten. Wahrscheinlich ist er abschnittsweise unterschiedlicher Genese und entstand während des Drenthe-Stadiums der Saale-Kaltzeit durch Schmelzwässer, die sich in einer Rinne sammelten und Sand und Kies anreicherten.
Wo befindet sich der Münsterländer Hauptkiessandzug?
Der Kiessandzug erstreckt sich durch das Münsterland, beginnend im Westfälischen Tiefland bei Schüttorf, über Ahlintel und Münster, bis östlich von Ennigerloh am Nordrand der Beckumer Berge. Er verläuft teilweise parallel zur Ems.
Welche Rolle spielte das Eiszeitalter bei der Entstehung des Kiessandzuges?
Der Münsterländer Hauptkiessandzug entstand im Pleistozän (Eiszeitalter), insbesondere während der Saale-Kaltzeit. Die Schmelzwässer des Inlandeises spielten eine entscheidende Rolle bei der Ablagerung der Sande und Kiese.
Was sind Oser und Kames im Zusammenhang mit dem Kiessandzug?
Ein Os ist ein schmaler, steilwandiger Rücken, der durch subglaziär abfließendes Wasser unter dem Gletscher aufgeschüttet wurde. Ein Kame ist ein breiterer, weniger steilwandiger Hügel, dessen Sedimente zwischen Toteisblöcken abgelagert wurden. Der Kiessandzug wurde unterschiedlich als Os oder Kame gedeutet, je nach Theorie zur seiner Entstehung.
Welche Sedimente sind im Kiessandzug enthalten?
Der Kiessandzug besteht hauptsächlich aus Sanden und Kiesen. Im unteren Teil finden sich kiesige Grobsande mit Geschieben aus nordischem und lokalem Material sowie Tongerölle. Im oberen Teil gibt es gelbweiße, scharfe Mittelsande und Kiese ohne Geschiebeführung.
Wie tief ist die Rinne, in der der Kiessandzug liegt?
Die Sedimente des Kiessandzuges liegen überwiegend in einer Rinne, deren Sohle stellenweise bis weit über 20 m in die oberkreidezeitlichen Ablagerungen eingetieft ist. Die Rinnensohle fällt mit 0,8 Promille nach Nordwesten ein.
Welche Bedeutung haben die nordischen Geschiebe im Kiessandzug?
Die nordischen Geschiebe sind wichtig, weil sich unter ihnen sogenannte „Leitgeschiebe“ befinden, die Auskunft über die Herkunftsgebiete und die Wanderwege des Inlandeises geben.
Wer hat sich mit der Erforschung des Münsterländer Hauptkiessandzuges beschäftigt?
Mehrere Geologen und Forscher haben sich mit dem Kiessandzug beschäftigt, darunter VON DER MARCK und HOSIUS, THEODOR WEGNER, WOLFF, HANS SCHNEIDER, LOTZE, BAECKER und THIERMANN.
Gibt es noch offene Fragen bezüglich der Entstehung des Kiessandzuges?
Ja, die genaue Entstehung des Kiessandzuges ist noch nicht vollständig geklärt. Auch die genaue zeitliche Einordnung seiner Entstehung im glazialen Zyklus des Drenthe-Stadiums der saalezeitlichen Vereisung ist noch nicht vollkommen geklärt.
- Quote paper
- Dr. Olaf Otto Dillmann (Author), 1997, Münsterländer Hauptkiessandzug, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125840