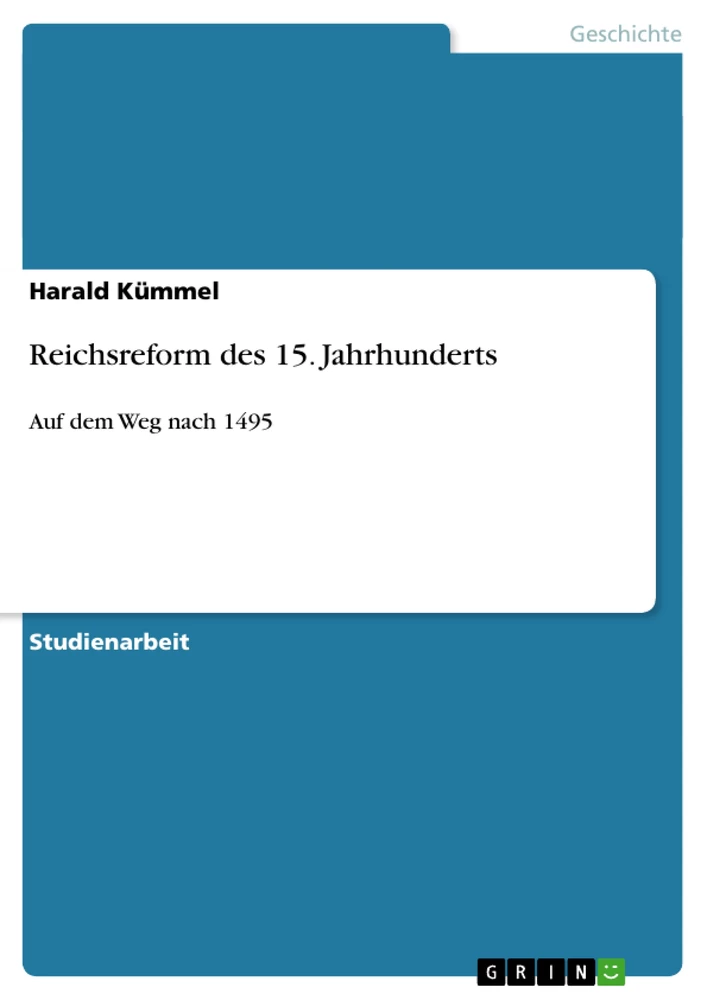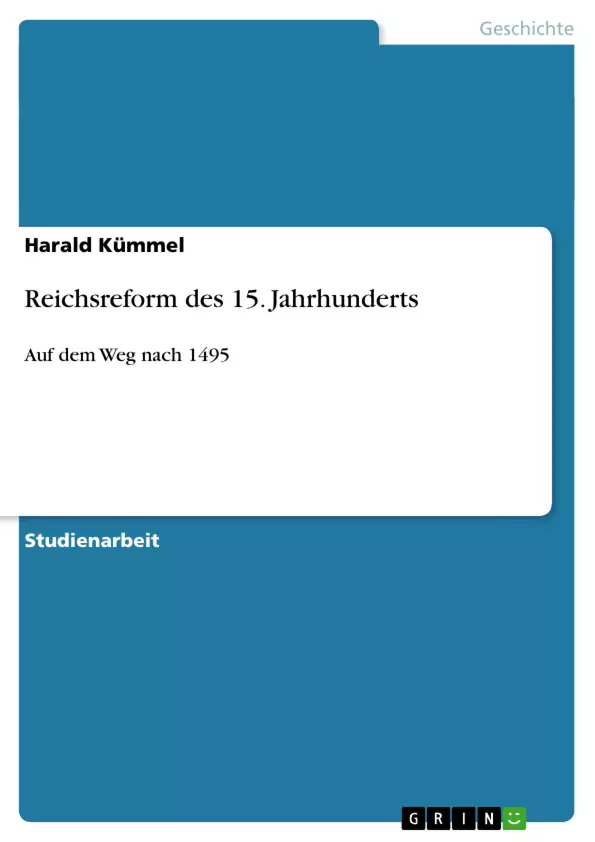Um sich dem Thema Reichsreform zu nähern, wird sich zu Beginn mit der Bedeutung der Zentralgewalt, also des Königs und seines Hofes, sowie der Großen des Reiches, vor allem der Kurfürsten, im 15. Jahrhundert beschäftigt. Außerdem wird auf die Veränderungen im Kleinadel eingegangen werden, die im 15. Jahrhundert schnell voranschritten. Im vierten Kapitel sollen dann die Ergebnisse des Reichstages von Worms 1495 vorgestellt werden. Dieser Reichstag markierte nicht den Abschluß der Entwicklungen. Immerhin hat das nächste Jahrhundert dem Begriff Reform seine Bezeichnung zu verdanken. Deshalb soll das abschließende fünfte Kapitel zum Problem Reichsreform auch einen Ausblick gewähren.
Inhalt
Einleitung
1. Die Bedeutung der Zentralgewalt
2. Die Bedeutung der Reicharistokratie, vor allem der Kurfürsten
3. „Adelsreform“ und Städte
4. Die Ergebnisse von Worms
Zusammenfassung: Zum Problem „Reichsreform“
Literaturverzeichnis
Einleitung
Karl IV. hatte es vollbracht, ein gefestigtes Königtum mit einer starken Hausmacht aufzubauen. Jedoch als Karl IV. 1378 starb, folgten zwei Könige auf dem deutschen Thron, die es nicht vermochten, ihre Herrschaft zu festigen. Der Sohn Karls, Wenzel, hatte eigentlich die besten Voraussetzungen mitbekommen, doch ihm fehlte die Zähigkeit und Zielstrebigkeit seines Vaters. Vor Wenzel standen große Aufgaben: Die Beendigung des kirchlichen Schismas, der Umgang mit der fürstlichen, vor allem der kurfürstlichen Opposition und die Befriedung des Reiches vor dem Hintergrund der ständig voranschreitenden Territorialisierung, die eine Vielzahl von Fehden, kleinen Kriegen und eigentlich verbotenen Bünden hervorbrachte. Bei allen drei großen Problemen konnte Wenzel keine nachhaltigen Erfolge erzielen. Außerdem nahm ihm seine Hausmachtpolitik dermaßen in Anspruch, daß das Reich darüber oft zu kurz kam. So sah er dem Einbruch eines französischen Heeres nach Deutschland untätig zu, die Durchführung des Egerer Landfriedens überließ er einem Kollegium von sechs Bevollmächtigten, kam 10 Jahre nicht mehr ins Reich und griff in dieser Zeit auch nur selten und ohne Nachdruck in die Reichspolitik ein. Das Schisma, die wohl wichtigste Frage der damaligen Zeit, vernachlässigte er, obwohl es seine Pflicht als Römischer König gewesen wäre, die Christenheit wieder zu vereinen. Vollends wurde Wenzels Ansehen durch seine Italienpolitik zerstört. Es gelang Wenzel nicht, französische Bestrebungen in Norditalien zu unterdrücken, und er erhob den Visconti, der bis dahin ein absetzbarer Reichsvikar für Italien war, zum Herzog. Dies war für die an der alten Reichsherrschaft über Italien festhaltenden westdeutschen Fürsten ein Skandal. Vor dem Hintergrund des Mißtrauens, das die westdeutschen Kurfürsten sowieso gegen das aufstrebende Hausmachtkönigtum im Osten des Reiches hatten, setzten sie Wenzel als Römischen König ab. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Geschichte.[1]
Neuer König wurde Ruprecht von der Pfalz. Er war als Landesfürst zu schwach, um tatsächlich effektiv regieren zu können. Hier zeigte sich sehr deutlich, auf welch schwachen Beinen der deutsche König stand, wollte er nur mit den Machtmitteln des Königtums auskommen. Sein Romzug wurde zum Debakel, da Ruprecht nicht in der Lage war, genug Finanzmittel aufzubringen. Nach Deutschland zurückgekehrt mischte er sich stark im Reich ein und war gewillt, alle seine Herrschaftsrechte wahrzunehmen. Nun beklagten die Fürsten bei Ruprecht, was sie bei Wenzel kritisiert hatten. Seine andauernde Geldnot weckte Befürchtungen bei den Städten, die auch seiner erfolgreichen Territorialpolitik wegen Mißtrauen gegen Ruprecht hegten. Sieben Jahre mußte der König darauf warten, bis Aachen ihm die Tore öffnete und er den Thron Karls des Großen besteigen konnte. Das Schismaproblem, dessen Erledigung Ruprecht durchaus am Herzen lag, verschlimmerte sich, als 1409 ein Konzil beide Päpste für abgesetzt erklärte und einen neuen Papst wählte. Da beide Päpste ihre Absetzung nicht anerkannten, waren nun aus zwei Päpsten drei geworden. Ruprecht hielt am römischen Papst fest, doch im übrigen Deutschland setzte die Kirchenspaltung jetzt erst richtig ein. In dieser Situation starb Ruprecht am 18.05.1410.
Streitigkeiten in der Schismafrage und über eigene territoriale Bestrebungen unter den Kurfürsten führten nun zu einer Doppelwahl. Zum einen wurde König Sigismund von Ungarn, der Bruder Wenzels, und zum anderen Jobst von Mähren gewählt. Nur der Tod von Jobst rettete Deutschland vor einem Doppelkönigtum.
Sigismund gelang es, wenn auch mit Mühen, seine Hausmacht Ungarn und Böhmen zu sichern. Auf dem Konzil zu Konstanz, dessen Einberufung er selbst vorangetrieben hatte, konnte er die Christenheit zu neuer Einheit führen. „Als wahrer Schirmherr der Kirche hat er der mittelalterlichen Idee des römischen Königs- und Kaisertums noch einmal kräftiges Leben eingehaucht und wenigstens für eine kurze Zeitspanne dem Reiche eine seiner älteren Glanzzeiten vergleichbare Geltung zurückgewonnen“, so Friedrich Baethgen[2]. Mit der Absetzung von Herzog Friedrich IV. von Österreich, der gegen den König intrigiert hatte, verschaffte sich Sigismund Respekt im Reich. Auch die Hinrichtung des böhmischen Predigers Jan Hus, so verhängnisvoll sie sich später auch herausstellte, gehört in diese Reihe der Machtdemonstrationen, die in der Literatur oft unterschätzt würden, so Heinrich Koller[3]. Sigismund konnte sein Ansehen und damit auch seine Macht ausbauen. Mit ihm gab es die Chance, das Reich endlich zu reformieren.
Das Thema Reichsreform ist in dieser Arbeit relativ breit gefaßt. Es wird ein Überblick über die Reichsrefom im 15. Jahrhundert gegeben ohne konkrete Einzelprobleme zu besprechen. Der Untertitel „Auf dem Weg nach 1495“ soll verdeutlichen, daß meine Betrachtungen mit dem Reichstag zu Worms 1495 enden werden.
Um mich dem Thema Reichsreform zu nähern, möchte ich mich zu Beginn mit der Bedeutung der Zentralgewalt, also des Königs und seines Hofes, sowie der Großen des Reiches, vor allem der Kurfürsten, im 15. Jahrhundert beschäftigen. Außerdem soll auf die Veränderungen im Kleinadel eingegangen werden, die im 15. Jahrhundert schnell voranschritten. Im vierten Kapitel sollen dann die Ergebnisse des Reichstages von Worms 1495 vorgestellt werden, wobei schon hier darauf hingewiesen sei, daß dieser Reichstag nicht den Abschluß der Entwicklungen markierte. Denn immerhin hat das nächste Jahrhundert dem Begriff Reform seine Bezeichnung zu verdanken. Deshalb soll das abschließende fünfte Kapitel zum Problem Reichsreform auch einen Ausblick gewähren.
Bei meinen Ausführungen stütze ich mich insbesondere auf die Veröffentlichungen von Heinrich Lutz, Hartmut Boockmann, Heinrich Koller, Michael Ranft und vor allem von Peter Moraw.
1. Die Bedeutung der Zentralgewalt
Sigismund veranlaßte Reformen am Hof. 1417 war ein Achtbuch angelegt worden, mit dessen Hilfe der Gerichtsbarkeit im Reich neue Bedeutung verschafft werden sollte. Wichtig beim Verfahren war die Vorladung, also die persönliche Anwesenheit des Beklagten am Hofgericht. Hielt sich der König und mit ihm der Hof nicht im Reich auf, konnte dies jedoch zum Problem werden. So bestimmte die Anwesenheit des Herrschers im Reich die Häufigkeit der Verfahren[4]. 1415 wurde erstmals das Kammergericht erwähnt. Es war nach Besetzung und Verfahren weniger eng an Formalien gebunden als das alte Hofgericht, so Peter Moraw[5].
Auch was die Finanzierung seines Hofes anging, führte Sigismund Reformen durch. Auf der Grundlage der Auffassung, daß ein Herrscher die Rechte seiner Lehensmänner nach seinem Regierungsantritt bestätigen solle oder müsse, wurde die Lehensbestätigung als Geldquelle benutzt. Der Hof stellte aus Anlaß der Bestätigung Urkunden aus, für die er Geld verlangte. Das Erzkämmereramt wurde dazu extra wieder eingeführt. So wurden die Urkunden immer aufwendiger, da man dann mehr kassieren konnte[6]. Die Erwartungen des Hofes wurden jedoch nicht erfüllt, da die Großen des Reiches auf solche Bestätigungen nicht mehr angewiesen waren. Die Reform des Urkundenwesens war so bereits 1418 gescheitert.
Sigismund zog sich nach Ungarn zurück, wo ihn die Aufgaben seines dortigen Königtums voll auslasteten. Die Türken hatten bereits Teile des Balkans erobert und drangen immer weiter nach Norden vor. Die alten Zwistigkeiten mit Venedig und Polen beanspruchten die Anwesenheit des Herrschers. Wie zu Zeiten Wenzels stand die Sicherung der Erbländer im Vordergrund der Politik des Königs und das Reich kam dabei zu kurz. Von 27 Regierungsjahren als römisch-deutscher König verbrachte Sigismund nur 6,5 Jahre im Reich. Davon muß man noch die Aufenthalte in Wien abziehen, die weniger den Reichsangelegenheiten als den Reisen zwischen Ungarn und Böhmen geschuldet waren[7]. Die Kenntnis dieser Tatsache ist für das Verständnis der verfassungspolitischen Veränderungen im Reich von außerordentlicher Bedeutung[8].
Das Reich manifestierte sich nach alt hergebrachter Vorstellung im Königtum. Der Herrscher und sein Hof bildeten den Repräsentationsmittelpunkt des Reiches. Die Hofkanzlei, die wichtigste Institution des Hofes, galt als Sprachrohr des Herrschers und seiner Ambitionen. Sie war das Instrument der Kommunikation mit den Untertanen, so Ivan Hlavacek[9]. Der König hielt einen täglichen Hoftag ab, bei dem sich die Untertanen an den König wenden konnten. Zu besonderen Anlässen wurden die Großen des Reiches zu Hoftagen eingeladen, auf denen die Angelegenheiten des Reiches verhandelt wurden. Das Hofgericht stellte die höchste Gerichtsbarkeit im Reich dar. Der Herrscher mußte nach seiner Wahl ein Beziehungsgeflecht zwischen seinem Hof und den Reichsgliedern aufbauen. Er konnte nicht, wie Peter Moraw verdeutlichte, wie Caesar oder Bismarck aus der Mitte eines schon bestehenden Beziehungssystems wirken, sondern mußte sich dieses
mühselig schaffen[10]. Nur dann versprach seine Herrschaft wirklich erfolgreich zu sein. Der König blieb die letzte Legitimierungsinstanz im Reich, die auch dringend gebraucht wurde. Peter Moraw hat nach dem „Ausmaß an Bedarfsbefriedigung“ nach Herrschaft gefragt. Er stellte fest, daß ein „bestimmtes Maß von Herrschaft notwendig war“[11]. Doch Sigismund, der „Kronensammler“[12], mußte diese Aufgabe für drei Reiche wahrnehmen, weshalb ihn Peter Moraw als „Prototyp des überforderten Königs“[13] bezeichnete.
Wollte ein Würdenträger mit dem König in Kontakt treten, so mußte er in den Osten des Reiches reisen. Vor allem bei Verfahren vor dem Hofgericht war die Anwesenheit zumindest des Klägers vorteilhaft, um zum Erfolg zu gelangen. So kam es vor, daß Würdenträger dem König bis nach Ungarn folgen mußten, denn der Hof war nun mal an den König gebunden. Reisen waren jedoch eine teure und nicht ungefährliche Angelegenheit, vor allem in Zeiten des Krieges. So nahmen die Kontakte zwischen Hof und Reich ab, je weiter entfernt sich der König aufhielt. Für eine adelige Gesellschaft, deren Beziehungen noch immer auf persönlichem Kontakt beruhten und die Urkunden nur als Beleg für eine Rechtshandlung nicht aber als Rechtshandlung selbst betrachtete, war diese Situation unbefriedigend. Hinzu kamen Sprachprobleme, da immermehr Tschechen und Ungarn am Hofe Sigismunds beschäftigt waren, was die Kommunikation zusätzlich erschwerte. Die Bedeutung des Hofes als Integrationsmittelpunkt des Reiches nahm so stetig ab und der Hoftag wurde entlegitimiert. Dabei wurde gerade zu diesem Zeitpunkt Herrschaft dringend benötigt, da an das Reich neue Herausforderungen gestellt wurden.
Sigismunds Nachfolger, Albrecht II., war zu kurz auf dem Thron, um nachhaltige Veränderungen vorzunehmen. Friedrich III., ein Habsburger, setzte jedoch die Reformen am Hof fort, um die Effizienz seiner Herrschaft zu erhöhen. Heinrich Koller berichtet, daß Friedrich versucht hatte, in Vorderösterreich, d.h. in der Nähe der rheinischen Kurfürsten und der alten Reichsterritorien, ein neues Herrschaftszentrum aufzubauen. Seine zelebrierte Österreichideologie sei für diesen Raum im Südwesten des Reiches konzipiert gewesen, so Koller. Da das Konzil von Basel noch aktiv war, sei dies logisch gewesen[14].
In seinen ersten zehn Regierungsjahren war Friedrich ein aktiver Herrscher. 1440, kurz nach seinem Regierungsantritt, begann er mit einer Kanzleireform. Die Urkunden wurden grundsätzlich vereinfacht, um den Empfängern mit dem Preis entgegenzukommen. Friedrich selbst verwahrte seine Siegel, was die Stellung der Notare zurückdrängte. 1442 wurde endgültig die Schriftlichkeit in allen Verfahren am Hofgericht durchgesetzt. Seit 1470 wurden sogar die Konzepte von Urkunden aufbewahrt. Hier zeigten sich „Ansätze zu einer ‚modernen Verwaltung‘“, so Heinrich Koller[15].
Seine Österreichpolitik jedoch stieß im Reich auf wenig Gegenliebe. „Damit hat er wohl viele verärgert“, meinte Koller[16]. Immerhin fanden die Kriege, auch mit den Eidgenossen, in der Nähe des Konzils von Basel statt und Friedrich hatte, seinem Namen schuldend, als Friedenskönig andere Erwartungen geweckt. Als dann seine Bemühungen scheiterten, zog er sich nach Wien an den Rand des Reiches zurück. Folge dieses neuerlichen „Randkönigtums“[17] war der endgültige Zusammenbruch des Hofgerichts 1451. Dafür gewann das Kammergericht an Bedeutung. Die zunehmende Verschriftlichung führte dazu, daß Urkunden immer stärker als Argumente in Prozessen angewandt wurden. Daher wurden sie für den Empfänger immer wichtiger, was die Bedeutung der Hofkanzlei für das Reich stärkte. Diese Entwicklung ließ Friedrich glauben, er könne das Reich von Wien aus regieren[18].
[...]
[1] bei den Ausführungen der Einleitung folge ich Friedrich Baethgen: Schisma und Konzilszeit-Reichsreform und Habsburgs Aufstieg, München 1999 (Gebhardt-Handbuch der deutschen Geschichte, Band 6 der Taschenbuchausgabe)
[2] siehe Anm. 1, S. 56
[3] Heinrich Koller: Der Ausbau königlicher Macht im Reich des 15. Jahrhunderts, in: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, herausg. von Reinhard Schneider, Sigmaringen 1987, S. 436-440 (Vorträge und Forschungen-Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Band 32)
[4] siehe Anm. 3, S. 443
[5] Peter Moraw: Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung-Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490, in: Propyläen Geschichte Deutschlands, Frankfurt am Main/Berlin 1985, S. 366
[6] siehe Anm. 3, S. 444-446
[7] nach Ivan Hlavacek: Sigismund von Luxemburg und sein Anteil an der Reichsreform, in: Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz und Basel, herausg. von Ivan Hlavacek u. Alexander Patschovsky, Konstanz 1996, S. 70
[8] Peter Moraw: Über König und Reich-Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, herausg. von Rainer Christoph Schwingers, Sigmaringen 1995, S. 83
[9] siehe Anm. 7, S. 66
[10] Peter Moraw: Königliche Herrschaft und Verwaltung im spätmittelalterlichen Reich (ca. 1350-1450), in: Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich, herausg. von Reinhard Schneider, Sigmaringen 1987 (Vorträge und Forschungen-Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Band 32), S. 189-190
[11] siehe Anm. 10, S. 190
[12] siehe Anm. 5, S. 362
[13] Ebd.
[14] siehe Anm. 3, S. 429f.
[15] siehe Anm. 3, S. 454
[16] siehe Anm. 3, S. 455
[17] siehe Anm. 5, S. 379
[18] siehe Anm. 3, S. 457
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Reichsreform im 15. Jahrhundert?
Das Ziel war die Festigung der Zentralgewalt des Königs, die Befriedung des Reiches angesichts fortschreitender Territorialisierung und die Modernisierung der Institutionen wie des Gerichtswesens.
Welche Rolle spielte König Sigismund bei der Reform?
Sigismund veranlasste wichtige Reformen am Hof und im Gerichtswesen (z.B. Kammergericht), war jedoch als „überforderter König“ oft durch seine anderen Reiche (Ungarn, Böhmen) vom Reich abwesend.
Was geschah auf dem Reichstag zu Worms 1495?
Der Reichstag von 1495 markierte einen wichtigen Meilenstein der Reformbemühungen, unter anderem mit der Einführung des Ewigen Landfriedens und des Reichskammergerichts.
Warum wurde König Wenzel abgesetzt?
Wenzel wurde 1400 von den Kurfürsten abgesetzt, weil er das kirchliche Schisma nicht beendete, die Reichsinteressen gegenüber seiner Hausmachtpolitik vernachlässigte und jahrelang nicht im Reich präsent war.
Was war die Bedeutung der Kurfürsten in dieser Zeit?
Die Kurfürsten bildeten die mächtigste Opposition zur Zentralgewalt und versuchten, ihre eigenen territorialen Interessen zu sichern, während sie gleichzeitig die Wahl und Absetzung des Königs kontrollierten.
Wie finanzierte der König seinen Hof im 15. Jahrhundert?
Neben Einkünften aus den Erbländern wurden Reformen wie die gebührenpflichtige Lehensbestätigung versucht, die jedoch oft am Widerstand der Großen des Reiches scheiterten.
- Quote paper
- Harald Kümmel (Author), 2000, Reichsreform des 15. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125910