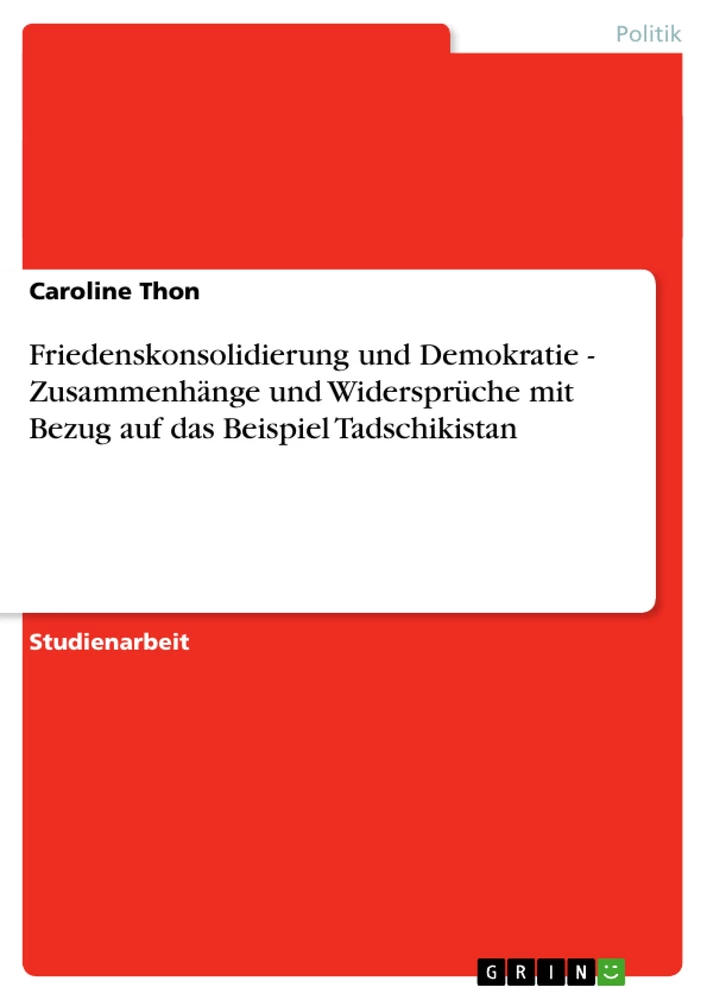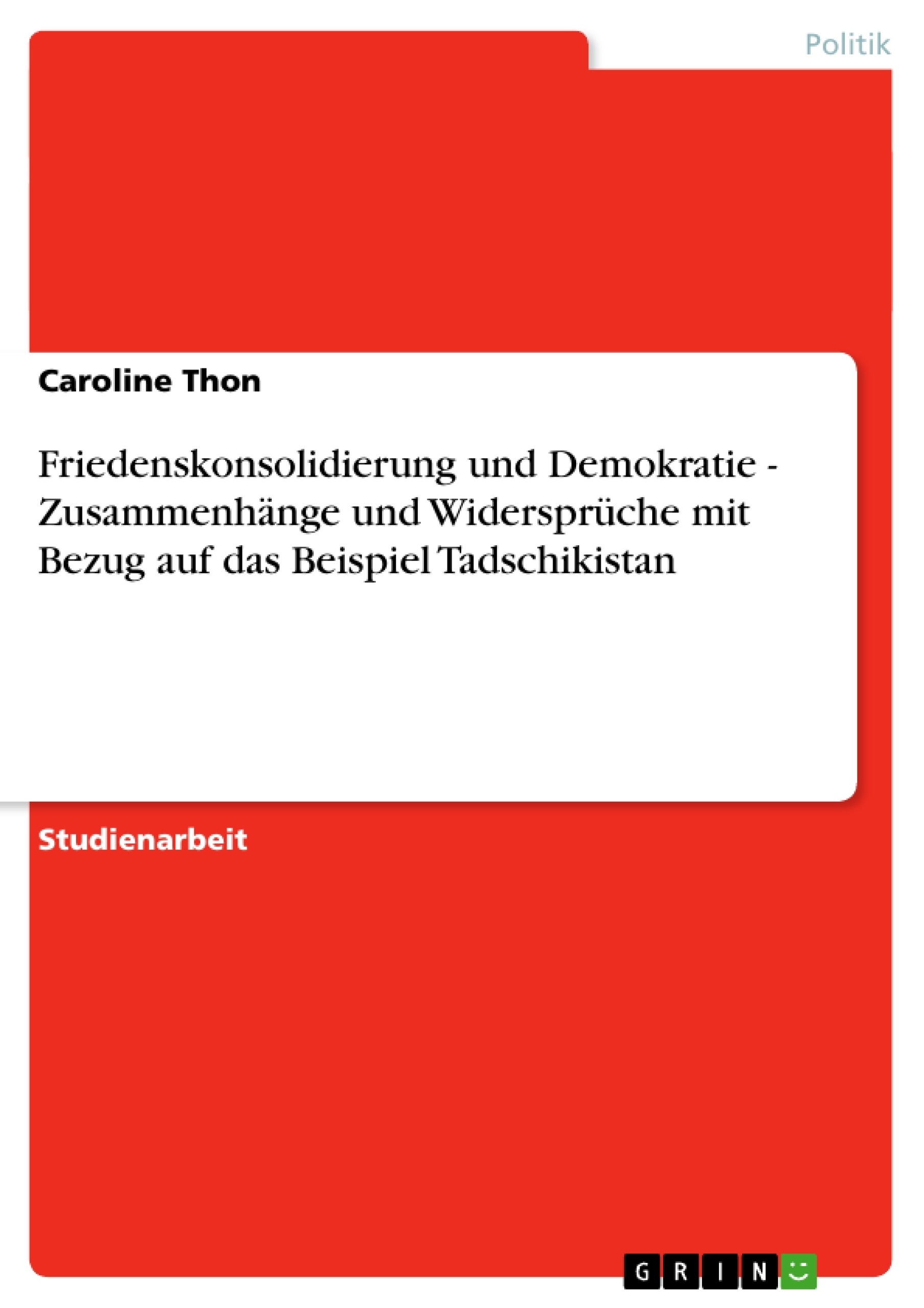Bedeutet Demokratie gleich Frieden? Braucht Friede eine demokratische Entwicklung? Und wie friedfertig sind demokratische Systeme? Diesen kontroversen Fragen kritisch nachzugehen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Nach einer Erörterung der theoretischer Grundlagen wird anhand des Krieges in Tadschikistan aufgezeigt, wie dort demokratische Prozesse und konfliktäre Entwicklungen miteinander zusammenhingen und welche Aussichten es auf einen "demokratischen Frieden" geben kann.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 DIE IDEE DER FRIEDENSKONSOLIDIERUNG
2.1. ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DEMOKRATIE / DEMOKRATISIERUNG UND FRIEDEN
2.2. DER DEMOKRATIEBEGRIFF
2.3. DEMOKRATISIERUNG – MAßNAHMEN UND STRATEGIEN DER FRIEDENSKONSOLIDIERUNG
3 DAS FALLBEISPIEL TADSCHIKISTAN
3.1. STATUSQUO VON DEMOKRATIE UND KONFLIKTTRÄCHTIGKEIT IN TADSCHIKISTAN
3.2. RAHMENBEDINGUNGEN
3.3. KONFLIKT – URSACHEN , GENESE , NEUE MACHTKONSTELLATIONEN
3.4. TADSCHIKISTANS FRIEDEN OHNE DEMOKRATIE – EINE FRAGE DER ZEIT ODER „KULTUR “
4. FAZIT
5. BIBLIOGRAPHIE
5.1. PRINTLITERATUR
5.2. INTERNETLITERATUR
1. Einleitung
„Demokratie = Frieden" ist heutzutage im politischen und medialen Diskurs eine schnell gemachte Gleichung. Der Weg zu Frieden, Freiheit und Sicherheit, so die Rhetorik, liegt in der Demokratisierung. Dies gilt besonders fir Staaten, die sich durch interne Konflikte und/ oder Zerfallssymptome auszeichnen. Auch in den wissenschaftlichen Konzepten der Friedenskonsolidierung wird Demokratie als Endziel bzw. auch als Instrument des Friedensprozesses genannt. Kann man davon ausgehen, dass Demokratie und Frieden kausal zusammenhängen? Oder gilt diese Bindung nur unter bestimmten Bedingungen? Hat Demokratie tatsächlich per se eine krisenpräventive Wirkung? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Uberspitzt gefragt: Ist Demokratisierung das Allheilmittel einer von Kriegen zermörbten Welt?
In dieser Arbeit soll diskutiert werden, inwieweit Demokratie als Instrument der Befriedung bzw. als Fundament einer friedlichen Gesellschaft funktionieren kann. Far den Realitätsbezug werde ich auf der Grundlage des wissenschaftlichen Diskurses untersuchen, wie Demokratie und Frieden im Falle der jüngsten Geschichte Tadschikistans zusammenhängen. In Tadschikistan hat nach dem Zerfall der UdSSR ein von der westlichen Offentlichkeit kaum bemerkter Krieg stattgefunden, der als Krieg gegen das alte kommunistische System eingeordnet wurde. Dabei handelte es sich um den gewaltsamen Ausdruck eines gesellschaftlichen und politischen Transformationskonflikts, der vor seiner Eskalation u.U. auch eine endogene Demokratieentwicklung hätte bedeuten können. Das Ergebnis des Friedensprozesses, der von der UNO und der OSZE und weiteren externen politischen Akteuren mitgestaltet wurde, ist jedoch ein Rückfall in autoritäre Verhältnisse. In dieser Arbeit werde ich nicht diese Wirksamkeit dieser MaBnahmen evaluieren, sondern versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten,
1) in welchem Verhältnis die demokratische Entwicklung zum gesellschaftlichen Frieden stand
2) welche innergesellschaftlichen Prä- und Postkonfliktbedingungen die demokratische Entwicklung beeinflussten bzw. behinderten
3) welche Konsequenzen sich aus diesem Fallbeispiel fir Demokratieförderung als Bestandteil der Friedenskonsolidierung ergeben.
Die Arbeit ist wie folgt konzipiert: zunächst wird es eine knappe Einleitung in das Prinzip der Friedenkonsolidierung geben. In den weiteren Abschnitten werde ich Demokratisierung als Instrument der Friedenskonsolidierung vorstellen und daffir auf die Zusammenhänge zwischen Frieden und Demokratie bzw. Demokratisierung und den Demokratiebegriff eingehen. Des Weiteren soll ein Einblick in DemokratisierungsmaBnahmen im Konzept der Friedenskonsolidierung gegeben werden. AnschlieBend werde ich anhand einiger Rahmendaten schlaglichtartig Tadschikistan vorstellen und im Anschluss den jetzigen Status Tadschikistans bezfiglich seiner demokratischen Entwicklung und der innergesellschaftlichen Konfliktträchtigkeit beleuchten. Daraufhin werde ich die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Rahmenbedingungen aufzeigen sowie den komplizierten Konflikt, seinen Verlauf und seine Ergebnisse gekfirzt behandeln. Auf dieser Grundlage werde ich schlussfolgern, wie die spezifischen Bedingungen und Umstände eine Demokratisierung im Sinne des Friedens beeinflussten.
2. Die Idee der Friedenskonsolidierung
Bevor ich auf das Fallbeispiel Tadschikistan eingehen werde, möchte ich in diesem Kapitel auf die Rolle von Demokratie bzw. Demokratisierungsbemfihungen in der Konfliktbearbeitung eingehen. Dabei werde ich nicht gesondert das Konzept der Friedenskonsolidierung diskutieren, sondern nur in Kfirze darstellen, was deren spezifischen Ziele und MaBnahmen sind. Da der begriffliche Apparat der Konfliktbearbeitung noch nicht als einheitlich differenziert und definiert gelten kann (siehe Reimann, 2004: 42), fiberschneiden sich einige grundlegenden Aspekte des Konzepts der Friedenskonsolidierung z.B. mit dem der Krisenprävention1 oder Konflikttransformation. Daher werde ich solche auch in die Darstellung miteinbeziehen.
Friedenskonsolidierung wurde als außenpolitisches Konzept erstmals 1992 in der „Agenda ffir den Frieden" von dem damaligen UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali benannt (vgl. Ferdowsi/ Matthies: 2003: 32). Das Ziel der Friedenskonsolidierung geht fiber einen negativen Frieden2 im Sinne eines dauerhaften Waffenstillstands auf der Basis eines Friedensabkommens hinaus: da als tieferliegende Ursachen eines Konfliktes in der Regel strukturelle Faktoren erkannt werden, kann nachhaltiger Frieden nur geschaffen werden, wenn diese gewaltträchtigen Verhältnisse fundamental zu friedensfähigen transformiert werden. Langfristig sollen also soziale und politische Regulierungsstrukturen etabliert werden, fiber die Konflikte und Konfliktpotenziale gewaltfrei (auf)gelöst werden können (vgl. Ferdowsi/ Matthies, 2003: 18/32). Insofern hat der angeleitete strukturelle, politische und gesellschaftliche Wandel das Ziel, möglichen neuen Konfliktpotenzialen gegentiber präventiv zu wirken (siehe ibid., 2003: 32)3. Dieser Transformationsprozess muss holistisch angelegt sein, d.h. er muss in allen konfliktrelevanten Dimensionen stattfinden. Das wären laut Ferdowsi und Matthies sowohl die sicherheitspolitische und politische, als auch die ökonomische, soziale und psychosoziale Dimensionen (vgl. ibid., 2003: 33). Ferdowsi und Matthies betonen dazu, dass es sich hierbei um ein „politisches und gesellschaftliches Projekt" und nicht um technische oder materielle Aufbauhilfe handelt (Ferdowsi/ Matthies, 2003: 35). Das impliziert auch mitunter, dass Frieden gesellschaftlich ausgehandelt werden muss und nicht mit der Implementierung von Programmen schlicht "geschaffen" wird.
2.1. Zusammenhänge zwischen Demokratie/ Demokratisierung und Frieden
Ein wichtiges oder gar das wichtigste Element in einem transformativen Friedensprozess ist die Demokratisierung (vgl. Reiber, 2005: 3). Laut Bächler ist man sich im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend einig, dass nachhaltiger Frieden nur in einer demokratisch legitimierten und pluralistischen politischen Ordnung garantiert ist (vgl. Bächler, 2004: 276/277; siehe Matthies, 2000: 107)4. Dieses fir die westliche Welt gilltige Paradigma, dass demokratische Strukturen und Prinzipien die Garanten des Friedens sind, hat seit Beginn der 1990er Jahre auch fir diese und die internationale Gemeinschaft eine Schlasselrolle in der AuBenpolitik inne (vgl. Berg/ Kreikemeyer, 2006: 9; vgl. Ottaway, 2006: 1):
„In the strategy of the western world for pursuing the goal of peace and conflict resolution at the global level, coalition with democracies and push for transforming non-democratic systems into democracies has been given an important place." (Muni, 2003: 212).
Spiegelbildlich zu den hier genannten Annahmen fiber die Beziehung zwischen konsolidierten Demokratien und friedlicher Konfliktaustragung steht auch die Analyse der Konfliktursachen gegenwärtiger gewalttätiger Auseinandersetzungen:
„das Ungleichgewicht politischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Beteiligungs- und Entfaltungschancen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, eine illegitime, undemokratische und ineffiziente, [...] schlechte Regierungsf•hrung, fehlende institutionelle Verfahren fur einen friedlichen Ausgleich von divergierenden Gruppeninteressen sowie die Abwesenheit einer aktiven organisierten Zivilgesellschaft." (Ferdowsi/ Matthies, 2003: 18/19).
Soweit entsprechen Ursachenbefunde und Transformationsziel weitestgehend der europäischen Erfahrung, dass liberal demokratische Ordnungen — zumindest nach ihrer Konstitution und Konsolidierung — externe und interne Konflikte am effektivsten vermeiden bzw. schlichten können. Demokratisierung ist somit zum einen die historische (eurogene) Antwort auf die so genannten „root causes". Zum anderen spricht fir die Etablierung von demokratischen Institutionen, dass sie an sich konfliktreiche gesellschaftliche Prozesse friedvoll katalysieren. Sie lösen Widerspriiche und Machtfragen nicht endgültig auf, sondern organisieren den gesellschaftlichen Konflikt (vgl. Ottaway, 2006: 2).
Es stellt sich jedoch die Frage, ob es tatsächlich einen objektiven, historisch und kulturell unabhängigen Zusammenhang zwischen Demokratie und Frieden gibt, wie er traditionellerweise im seit Kant weitergetragene Diktum des Friedens zwischen Demokratien und z.B. Senghaas' Modell des Friedens als Zivilisierungsprojekt (1994)5 dargestellt wird. Die Frage nach der Validität von Kants Theorem wird bisher sehr unterschiedlich beantwortet, jedoch kann man zunächst von einer Korrelation ausgehen (siehe bspw. Muni, 2003: 195ff.; vgl. Czempiel, 1995: 20/21; vgl. Nielebock, 1996: 352/353). Zudem muss nach Ansicht der Autorin bedacht werden, dass Kants Prämisse der Staatlichkeit der Akteure in den heutigen Konflikten und Kriegen immer seltener auf beiden Seiten gegeben ist (siehe dazu Mönkler, 2002: 10/11). Angesichts der wachsenden Zahl von Kriegsparteien, die keine politische Verfasstheit repräsentieren und somit auBerhalb der Kategorien „Demokratie" oder „Nicht-Demokratie" stehen, lässt sich also fragen, ob die Relevanz der These in der heutigen Kriegsszenerie nicht doch stark eingeschränkt ist. Das Senghaas'sche Modell, das Merkmale eines „bürgerlich-demokratischen Staates westlicher Prägung" als Voraussetzung für innergesellschaftlichen Frieden erhebt, ist nicht zuletzt hinsichtlich der eurozentristischen, aber Universalisierbarkeit beanspruchenden Perspektive6 sowie der Idealisierung und Verleugnung der „krisenhaften Zivilisationsentwicklungen bzw. —paradoxien westlicher (,postmoderner') Gesellschaften am Ende des 20. Jahrhunderts" stark zu hinterfragen (Vogt, 1996: 102, 104, 106).
Auch wenn allein aus der historischen Erfahrung die Vorannahme gesetzt wird, dass konsolidierte Demokratie Friedfertigkeit bedeutet, ist die Ableitung, dass Demokratisierung in friedliche Verhältnisse führt, sehr strittig. Vielmehr wird Demokratisierung, also eine komplexe Systemtransformation (vormals) undemokratisch strukturierter, kriegsgeschädigter Gesellschaften, als eine Phase mit enormen Risiken anerkannt. SchlieBlich muss „eine Umverteilung und Begrenzung von Macht" zwischen ehemaligen bzw. durch den Krieg hervorgegangenen Polit- und Wirtschaftseliten (z.B. Warlords und andere Profiteure des Krieges auf staatlicher wie nichtstaatlicher Seite) stattfinden sowie eine Reformierung oder gar Zerstörung undemokratischer Institutionen und Strukturen (Dauderstädt/ Lerch, 2005: 1; vgl. Mair, 1997: 37, zit. in Matthies, 2000: 86). Solche Eingriffe in die politischen und ökonomischen Machtbalancen einer Gesellschaft bzw. eines Staates wirken zunächst destabilisierend. Sie können - besonders wenn dieser Prozess von externen Kräften gefördert wird und keine endogene Entwicklung darstellt - in stark (z.B. ethnisch oder konfessionell) fragmentierten Gesellschaften zu durchaus katastrophalen Ergebnissen führen (vgl. Matthies, 2000: 40).
SchlieBlich zeigt sich in der Ubergangsphase auch der Charakter der Demokratie selbst als problematisch. Demokratische Prozesse basieren auf und fördern „conflict and competition" (Reiber, 2005: 8). Der Effekt demokratischer Strukturen und Aushandlungs- prozesse als gesellschaftlicher und politischer Konfliktkatalysator kommt laut Ottaway aber erst in konsolidierten Demokratien zum Tragen; fehlen also die regulierenden Institutionen für den "demokratischen Konflikt", so ist Demokratisierung als „tool for consolidating peace" nicht geeignet (Ottaway, 2006: 2/3). Ein offensichtliches Beispiel für eine solche Fehlzündung eines demokratischen Systems ist der Status Quo im Irak. Von dem Risiko der Transitionsphase an sich abgesehen, stellt sich desweiteren die Frage, ob überhaupt das angestrebte Ziel erreicht wird. SchlieBlich handelt es sich um einen tiefgreifenden und durchaus langwierigen Wandel, der — wie sich empirisch anhand der Entwicklung der Transformationsländer der letztens 30 Jahre zeigt - keineswegs automatisch in demokratischen Systemen münden (Haynes, 2001: 1/2). Stattdessen verbleiben diese Staaten in einem hybriden Stadium der Quasi-Demokratie, die nur formal die demokratischen Insignien trägt (siehe auch Ottaway, 2006: 8).
Auch kritische Stimmen zur von AuBen eingeleiteten Demokratisierung von Post-Konfliktgesellschaften wie Marina Ottaway bestreiten nicht, dass Demokratie das „long term goal" in der Friedenskonsolidierung bleiben muss (Ottaway, 2006: 20). Als Vertreterin der staatszentrierten Position im Demokratisierungs-Diskurs argumentiert sie, dass bestimmte Prämissen erfüllt sein müssen, damit Demokratisierung ein sinnvolles und bedeutsames Projekt für die jeweilige Gesellschaft sein kann: nämlich ein funktionierendes staatliches Gewaltmonopol und eine gemeinsame (nationale) Identität der Gesellschaft, also vollzogene Staats- und Nationenbildung (vgl. Ottaway, 2006: 1). So müssen demokratische Instrumente soweit ausgebildet oder angelegt sein, dass sie nicht selbst konfliktfördernd wirken (z.B. in Form von Marginalisierung von Minderheiten, die durch majoritär orientierte demokratische Entscheidungsbildung forciert werden kann) (siehe Ottaway, 2006: 2). Hinzukommt auch, dass der Staat für eine Konsolidierung demokratischer Verhältnisse einer soliden ökonomischen Basis bedarf; diese muss nicht nur den Erhalt seiner administrativen und sozialen Funktionsfähigkeit und seines Gewaltmonopols ermöglichen, sondern auch die Finanzierung der demokratischen Institutionen (siehe Ottaway, 2006: 4, 11; siehe auch Mehler, 1998: [o.S.] zit. in Matthies, 2000: 181). Diese Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie berücksichtigend, könnte sie immer nur das langfristige Ziel der Friedensarbeit sein, nicht aber ihr Mittel — besonders nicht, wenn sie von externen Akteuren implementiert wird (vgl. Ottaway, 2006: 3).
Stimmen des institutionalistisch-prozessualen Demokratisierungsansatzes betonen dagegen, dass schon die Entwicklung in eine friedvolle und stabile Gesellschaft pluralistisch und partizipatorisch gestaltet sein muss (siehe Bächler, 2004: 274; siehe auch Ferdowsi/ Matthies, 2003: 34/35). Beruht also der Wiederaufbau von Staat und Gesellschaft nicht auf solchen gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, droht fehlende Legitimität den Staat zu schwächen (siehe Bächler, 2004: 274). Zudem liegt es — gemäB der Argumentation im Sinne der Strukturtransformation - nahe, dass der nicht-partizipative Friedensprozess u.U. durch die Verfestigung von (alten) Ungleichheiten scheitern bzw. neue krisenanfällige Strukturen schaffen wird. Diese Debatte weist auf eine zentrale Problematik der ganzheitlich orientierten Konflikttransformation hin: die Zielsetzungen in den verschiedenen Dimensionen stehen sich oftmals diametral gegenlber und fordern eine Entscheidung lber die Prioritätensetzung. So auch im Falle des Verhältnisses zwischen politischer Stabilität und demokratischer Entwicklung (siehe Ferdowsi/ Matthies, 2003: 35).
Eine Grundvoraussetzung flr das Funktionieren einer Demokratie ist jedoch immer — bereits aufgrund ihrer Herrschaftsform -, dass der jeweilige demos seinen Sinn und seine Funktionsweise versteht und seine Rolle auszuflhren weiB (vgl. Massing/ Breit, 2004: 7). Wenn in der politischen Kultur keine demokratischen Prinzipien oder Werte verankert sind und keine Erfahrungen mit demokratischen Prozessen vorliegen, so Reiber, ist eine Durchsetzung solcher also denkbar schwierig (vgl. Reiber, 2005: 9). Von der anderen Seite wird dagegen argumentiert, dass demokratische Werte und Normen mit der Einflhrung der Demokratie praktisch von selbst etablieren werden (vgl. Bächler, 2004: 274; vgl. Bloomfield/ Reilly, 1998: 17 zit. in Reiber, 2005: 8). Diese Erwartung, so werde ich anhand der Entwicklung in Tadschikistan zeigen, ist jedoch äuBerst optimistisch. Was jedoch als gemeinsamer Nenner dieser Ansichten gelten kann, ist, dass Demokratisierung weit mehr als eine politische Strukturreform ist, nämlich ein Modus des gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Angesichts der hier erörterten Zusammenhänge zwischen Frieden und Demokratie kann Demokratisierung als Instrument und/oder Endziel eines transformativen Friedensprozesses nicht allein auf philosophischen oder normativen Annahmen oder gar eurozentrischem Wunschdenken beruhen. Ebenso wenig macht es nach Ansicht der Autorin Sinn, nach pauschalen Rezepten zur Prioritätensetzung (erst Aufbau von Staatlichkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt, dann Demokratisierung und vice versa) zu suchen. In so einem sensiblen Kontext wie einer Nachkriegszeit stellt sich nicht die Frage nach einem universellen Demokratisierungskatalog a la „one fits it all". Es lässt sich also aus der obigen Darstellung schlieBen, dass zunächst eine breite und tiefgehende Analyse der (Post-) Konfliktsituation (z.B. Machtverhältnisse, Interessensgruppen etc.) und der allgemeinen Rahmenbedingungen far ein demokratisches System (kulturelle und historische Voraussetzungen und Erfahrung in Bezug auf Demokratie bzw. politische Kultur, gemeinsame Identität der Bevölkerung, Stärke des staatlichen Gewaltmonopols sowie ökonomische Leistungsfähigkeit des Staates etc.) stattfinden muss (siehe hierzu auch OECD/ DAC, 2005: 1ff.; siehe Ottaway, 2006: 11ff.). Nur auf einer solchen Grundlage kann letztlich eingeschätzt werden, inwieweit und in welchem MaBe Demokratisierung als Friedens-konsolidierung sinnvoll sein kann und ob oder wie demokratisierende MaBnahmen in der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Kultur und der spezifischen Nachkriegssituation greifen kann. Eine solche akribische Analyse in Bezug auf Tadschikistan kann in dieser Arbeit nicht stattfinden. Vielmehr werde ich in Kapitel Drei lediglich unter Berucksichtigung der meiner Meinung nach zentralsten Faktoren im Groben aufzeigen, mit welchen Harden eine externe Demokratieförderung konfrontiert wird.
2.2. Der Demokratiebegriff
Strategien der internationalen Gemeinschaft wie auch anderer politischer Akteure zur Friedenskonsolidierung und transformativen Konfliktbearbeitung konzentrieren sich, wie erwähnt, stark auf das Konzept der Demokratisierung (vgl. Reiber, 2005: 3). Jedoch lässt sich fragen, was das konkrete Resultat eines Demokratisierungsprozesses sein soll. Gibt es ein prototypisches Demokratiemodell, das verwirklicht werden soll, bzw. welche Eigenschaften muss ein Regierungssystem aufweisen, damit es als demokratisiert gelten kann? Was ist mit Demokratisierung gemeint? Betrachtet man die unterschiedlichen Typen von real-existierenden Demokratien, so kann man mit Muni feststellen, dass es keine „ideal, prescribed or fixed structure of democracy" gibt (Muni, 2003: 194). Moderne liberal-demokratische Systeme weisen sehr unterschiedliche institutionelle Arrangements hinsichtlich Gewaltenteilung und Entscheidungsverfahren auf (vgl. Merkel, 1999: 32). Dementsprechend wenig feste Substanz hat auch der Demokratiebegriff in der wissenschaftlichen Debatte.
Generell kann man in der wissenschaftlichen Debatte jedoch zwei verschiedene Ansätze der Demokratiedefinitionen unterscheiden: zum einen den rein prozessorientierten und zum anderen den inhaltlich-institutionellen Ansatz. Ersterer sieht weitestgehend freie und faire Wahlen als das Hauptdefinitionselement von Demokratien (vgl. z. B. Schumpeter, 1947:
269 und Riker, 1986: 25 zit. in Reilly, 2001: 3). Diese wird oftmals als die Minimaldefinition des Demokratiebegriffes bezeichnet. Der andere Ansatz, z.B. vertreten durch Robert A. Dahl, sieht ein demokratisches System erst bestätigt, wenn der Bevölkerung eine Reihe institutioneller Garantien (z.B. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc.) gewährleistet werden (vgl. Dahl, 1971 zit. in Merkel, 1999: 31). Hier wird der Demokratiebegriff also normativ aufgefasst und zieht je nach Autor eine Reihe weiterer gesellschaftlicher Merkmale ein. Betrachtet man Positionen im wissenschaftlichen Diskurs oder aber auch die öffentliche, mediale Darstellung7 von Demokratisierungsprozessen, so wird Wahlen als Zeichen flr die erfolgreiche Implementierung demokratischer Strukturen und Werte eine Schlusselposition beigemessen (siehe z.B. Reilly, 2001: 2). Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass Wahlen als punktuelles und abgrenzbares Ereignis besser evaluiert werden können als Fortschritte in den institutionellen Garantien. An ihnen kann auch eher geklärt werden, inwiefern das grundsätzliche Merkmal demokratischer politischer Prozesse und Entscheidungen, nämlich ihre generelle Ergebnisoffenheit, erf•llt wird (siehe hierzu Merkel, 1999: 32). Andere Evaluationen wie die von der non-profit Organisation Freedom House erheben dagegen die Wahrung der politischen und burgerlichen Rechte, also inhaltliche Aspekte der Demokratie, zu den ausschlaggebenden Kriterien flr die Ermittlung des Demokratisierungsgrads (siehe Freedom House (a), [o.J.]: Internetquelle). Schwierig zu untersuchen ist jedoch, inwieweit die Demokratisierung fiber eine Veränderung in der Bildung und Durchführung von politischen Entscheidungen hinausgeht. Solche ist meist relativ schnell und durch Reformen zu erreichen. Jedoch ist die Verankerung demokratischer Prinzipien in der politischen Kultur, also die Demokratisierung auf der gesellschaftlichen Ebene, eine der wichtigsten Prämissen einer nachhaltigen Demokratieentwicklung (siehe Kapitel 2.1.), aber ungleich langwieriger (siehe Nielebock, 1996: 344). Die Beurteilung, ob eine Gesellschaft bzw. eine politische Ordnung demokratisch zu nennen ist, ist also mithin abhängig von der Perspektive und der angewandten Parameter.
[...]
1 Die englische Ubersetzung „peacebuilding" umfasst so ungesehen der unterschiedlichen Konfliktstufen und deren Auswirkung Primärprävention und Friedenskonsolidierung (siehe z.B. Smith, 2004: 10 und auch Matthies, 2000: 33ff.). Was alle dieser Ansätze jedoch eint, ist die Konzentration auf strukturorientierte Strategien zur Konfliktbewältigung.
2 In dieser Arbeit soll unterschieden werden zwischen einem negativen Frieden, der lediglich die Abwesenheit von direkter Gewalt meint, und einem positiven Frieden, der die Abwesenheit indirekter Gewalt mit einschlieSt. 3Ausführliche Uberlegungen dazu, wann eine Gesellschaft eine strukturell friedliche Gesellschaft sein kann, in der sich fur gesellschaftliche Konfliktaustragungen zivile Regelungsmechanismen gebildet haben, hat Dieter Senghaas (1994) in seinem Zivilisatorischen Hexagon vorgestellt. (Siehe dazu Kapitel 2.1)
3 Ausführliche Uberlegungen dazu, wann eine Gesellschaft eine strukturell friedliche Gesellschaft sein kann, in der sich fur gesellschaftliche Konfliktaustragungen zivile Regelungsmechanismen gebildet haben, hat Dieter Senghaas (1994) in seinem Zivilisatorischen Hexagon vorgestellt. (Siehe dazu Kapitel 2.1)
4 Es finden sich jedoch in der Realität immer wieder Gegenbeispiele zu dieser These. So ist zum Beispiel Kuba seit nunmehr einem halben Jahrhundert unter Einparteienherrschaft, aber in sich stabil und friedlich.
5 Während sich nach Kant Demokratien nach AuBen pazifistisch verhalten, argumentiert Senghaas, dass eine demokratische, pluralistische Ordnung u.a. auch Voraussetzung fur den Frieden innerhalb der (modernen bzw. modernisierten) Gesellschaft ist (siehe Muni, 2003: 195ff.; vgl. Senghaas, 1994: 18ff.).
6 Senghaas begründet die Pauschalisierbarkeit seines zivilisatorischen Hexagons damit, dass die gesellschaft-lichen Konfliktpotenziale, die aus der Modernisierung einer Gesellschaft resultieren (und auch hier geht er vom Modernisierungsmodell und —erfahrung der westlichen Gesellschaften aus), nur durch eine — letztlich — liberal-demokratische Ordnung gebändigt werden können. Die Universalisierbarkeit leitet er lapidar dadurch ab, dass auch andere Gesellschaften der so genannten Dritten Welt auf dem Wege der Modernisierung sind und somit gleiche Bedürfnisse entwickeln müssen (vgl. Senghaas, 1994: 30). Diese sehr evolutionistisch anmutende These schlieSt somit kurzerhand aus, dass Modernisierungsprozesse sehr vielfältig verlaufen und durchaus diverse Ergebnisse haben können. So konstatiert Zineker, dass die spezifische Konstellation des ökonomischen und politischen Modernisierungsprozesse des Westen einen „Sonderweg" darstellt, der „im heutigen Süden nicht mehr gangbar ist" (Zineker, 2003: 4).
7 Dies zeigt sich bspw. in der immensen Aufmerksamkeit, die der OSZE-Wahlberichterstattung zu Wahlen in nicht-demokratischen Regimen gezollt wird. Die Freiheit und Fairness der Wahlen sind oftmals der Priifstein, anhand dessen Entscheidungen fur oder gegen Sanktionen gegen die jeweiligen Regime gefällt werden. Dies galt jiingst z.B. fur WeiBrussland und Sanktionen der EU. Verletzungen der politischen und bürgerlichen Rechte innerhalb der Amtsperioden sind dagegen seltener der Auslöser fur solche Debatten.
Häufig gestellte Fragen
Führt Demokratisierung zwangsläufig zu Frieden?
Die Arbeit untersucht diesen Zusammenhang kritisch und stellt fest, dass Demokratie zwar langfristig Frieden sichern kann, der Prozess der Demokratisierung selbst jedoch oft konfliktträchtig ist.
Was war die Ursache des Krieges in Tadschikistan?
Nach dem Zerfall der UdSSR kam es zu einem gewaltsamen gesellschaftlichen und politischen Transformationskonflikt zwischen dem alten System und neuen Kräften.
Welche Rolle spielten die UNO und OSZE in Tadschikistan?
Diese Organisationen gestalteten den Friedensprozess mit, wobei das Ergebnis jedoch ein Rückfall in autoritäre Verhältnisse statt einer stabilen Demokratie war.
Was bedeutet 'strukturelle Friedenskonsolidierung'?
Es geht darum, gewaltträchtige gesellschaftliche Verhältnisse fundamental in friedensfähige Strukturen zu transformieren, um neue Konflikte präventiv zu verhindern.
Ist Frieden ohne Demokratie in Tadschikistan nachhaltig?
Die Arbeit hinterfragt, ob der aktuelle 'Frieden' ohne demokratische Teilhabe nur eine Frage der Zeit oder kultureller Besonderheiten ist, und beleuchtet die Risiken autoritärer Stabilität.
- Quote paper
- Caroline Thon (Author), 2006, Friedenskonsolidierung und Demokratie - Zusammenhänge und Widersprüche mit Bezug auf das Beispiel Tadschikistan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126029