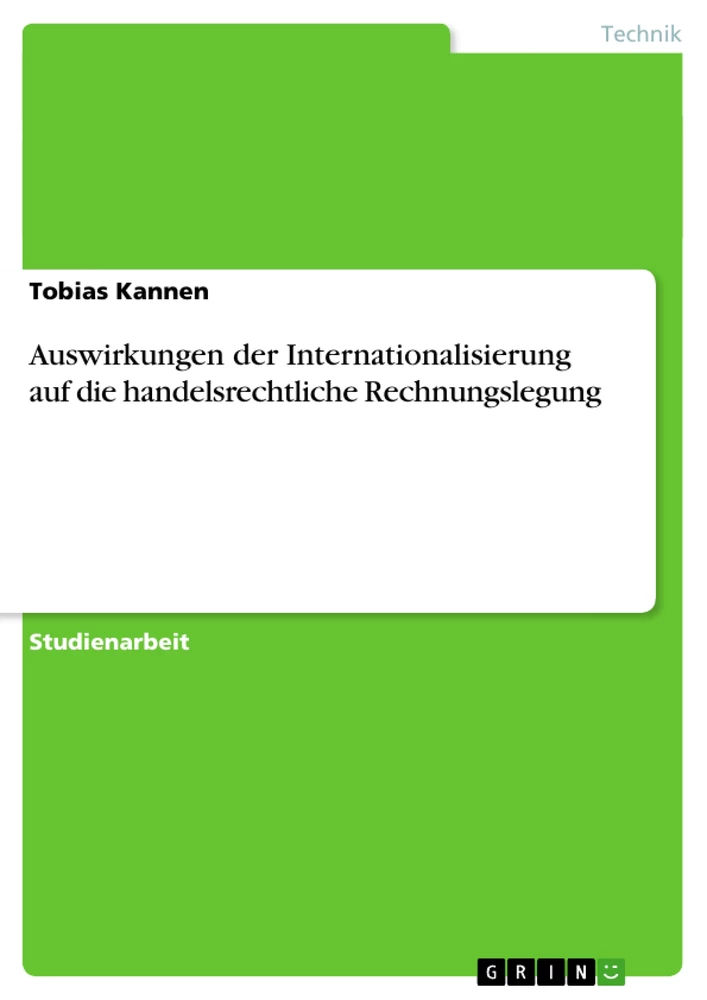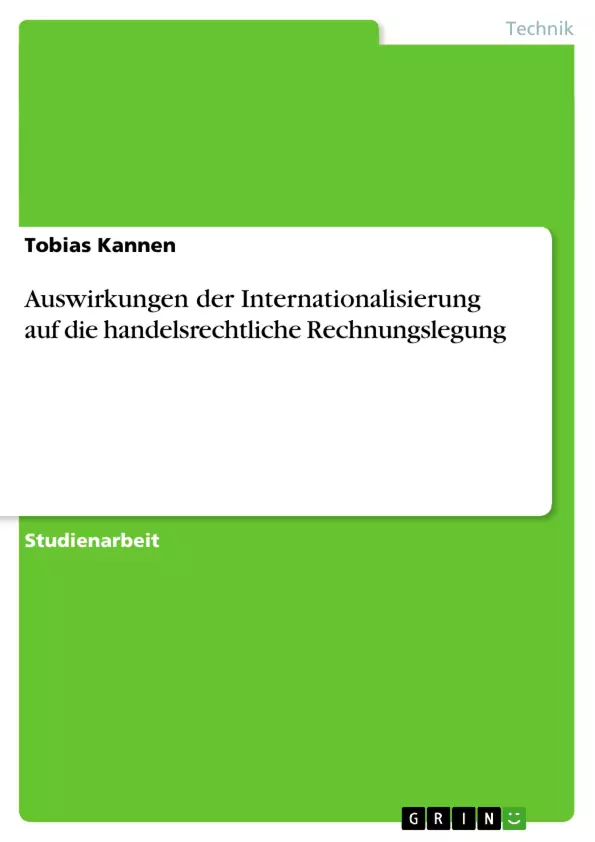Momentan herrscht bei den Rechnungslegungsadressaten deutscher Unternehmen aufgrund der Anwendung verschiedener Rechnungslegungssysteme ein regelrechtes „Bilanzierungswirrwarr.
Die handelsrechtliche Rechnungslegung steht in Deutschland im Wettbewerb mit den internationalen sowie den US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften.
Beispielhaft seien hier die 30 Dax-Unternehmen genannt, die alle ihren Konzernabschluss nach einem der beiden international anerkannten Bilanzierungsstandards US-GAAP (US-Generally Accepted Accounting Principles) oder den in Europa stärker verbreiteten International Financial Reporting Standards (IFRS) ermitteln bzw. mit dem Bericht zum ersten Halbjahr 2003 aufstellen werden. Grund dieser Entwicklung ist die Internationalisierung der Kapitalmärkte, die seit Beginn der neunziger Jahre auch deutsche Unternehmen, die ausländische Kapitalmärkte durch Emission von Aktien oder Anleihen als Instrumente der Kapitalbeschaffung in Anspruch nehmen, oder deren Wertpapiere an ausländischen Börsen gehandelt werden, dazu veranlasst hat, ihre Konzernrechnungslegung den international anerkannten Rechnungslegungsstandards anzupassen. Diese Tendenz wird heute üblicherweise als „Internationalisierung der Rechnungslegung" bezeichnet.
Nach der Einleitung sollen im zweiten Teil der Arbeit zunächst die Grundstrukturen der für Deutschland relevanten Rechnungslegungssysteme HGB, US-GAAP und IFRS dargestellt werden. Hieran anschließend werden im dritten Kapitel der Ursprung der heute weitreichenden Internationalisierung sowie die bisherigen Internationalisierungsphasen deutscher Rechnungslegung bis zum Ende des letzten Jahrzehnts aufgezeigt. Daraufhin sollen die derzeitige Rechnungslegungspraxis und deren aktuelle Rahmenbedingungen in Deutschland dargestellt werden. Im vierten Kapitel geht es um die am 19.06.2002 verabschiedete EG-Verordnung betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards und deren Auswirkungen auf den Konzern- und Einzelabschluss deutscher Unternehmen sowie um die geplante Änderung der EU-Bilanzrichtlinien. Im letzten Teil werden schließlich die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen handelsrechtlicher Rechnungslegung gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- Problemstellung
- Vorgehensweise
- 2 Ziele und Grundsätze verschiedener Rechnungslegungssysteme
- 2.1 HGB
- 2.2 US-GAAP
- 2.3 IAS
- 2.4 Zusammenfassung
- 3 Grundzüge der Internationalisierung in Deutschland
- 3.1 Motive
- 3.2 Bisherige Internationalisierungsphasen
- 3.3 Gegenwärtige Rechnungslegungspraxis in Deutschland
- 3.3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 3.3.1.1 Kapitalaufnameerleichterungsgesetz (KapAEG)
- 3.3.1.2 Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG)
- 3.3.2 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC)
- 3.3.3 Bilanzierungshandhabung deutscher Unternehmen
- 3.3.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 4 EG-Verordnung Nr. 1606/2002
- 4.1 Kurzdarstellung
- 4.2 Auswirkungen auf den Konzernabschluss
- 4.2.1 Konzernabschluss börsennotierter Unternehmen
- 4.2.2 Konzernabschluss nicht börsennotierter Unternehmen
- 4.3 Auswirkungen auf den Einzelabschluss
- 4.3.1 Eignung der IAS für den Einzelabschluss
- 4.3.2 Rückwirkungen des internationalisierten Konzernabschlusses
- 4.4 EU-Vorschlag für eine „Modernisierung“ der Bilanzrichtlinien als Reaktion auf die IAS-Verordnung
- 5 Schlussbetrachtung und Ausblick
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Vertiefende Literaturhinweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Internationalisierung auf die handelsrechtliche Rechnungslegung in Deutschland. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Rechnungslegungssysteme, die für Unternehmen relevant sind, und analysiert die Motive und Phasen der Internationalisierung in Deutschland. Darüber hinaus wird die EG-Verordnung Nr. 1606/2002 und deren Auswirkungen auf den Konzernabschluss und den Einzelabschluss untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die Reaktion der EU auf die IAS-Verordnung und den Vorschlag zur "Modernisierung" der Bilanzrichtlinien.
- Rechnungslegungssysteme im Vergleich (HGB, US-GAAP, IAS)
- Motive und Phasen der Internationalisierung in Deutschland
- Die EG-Verordnung Nr. 1606/2002 und ihre Auswirkungen
- Die Reaktion der EU auf die IAS-Verordnung
- Die "Modernisierung" der Bilanzrichtlinien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Internationalisierung der handelsrechtlichen Rechnungslegung dar und skizziert die Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt die Ziele und Grundsätze der verschiedenen Rechnungslegungssysteme (HGB, US-GAAP und IAS). Kapitel 3 beleuchtet die Grundzüge der Internationalisierung in Deutschland, einschließlich der Motive, der bisherigen Internationalisierungsphasen und der gegenwärtigen Rechnungslegungspraxis. In Kapitel 4 wird die EG-Verordnung Nr. 1606/2002 und deren Auswirkungen auf den Konzernabschluss und den Einzelabschluss analysiert. Der Abschluss der Arbeit befasst sich mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Internationalisierung, Rechnungslegungssysteme (HGB, US-GAAP, IAS), EG-Verordnung Nr. 1606/2002, Konzernabschluss, Einzelabschluss, Bilanzrichtlinien und "Modernisierung". Weitere wichtige Begriffe sind Kapitalaufnameerleichterungsgesetz (KapAEG), Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG) und Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC).
Häufig gestellte Fragen
Warum stellen viele deutsche Unternehmen auf IFRS oder US-GAAP um?
Hauptgrund ist die Internationalisierung der Kapitalmärkte. Unternehmen, die ausländisches Kapital suchen oder an internationalen Börsen gelistet sind, müssen vergleichbare Standards nutzen.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen HGB und IFRS?
Das HGB ist stark vom Gläubigerschutz und dem Vorsichtsprinzip geprägt, während IFRS und US-GAAP primär auf die Informationsvermittlung für Investoren (Fair Value) abzielen.
Welche Bedeutung hat die EG-Verordnung Nr. 1606/2002?
Diese Verordnung verpflichtet börsennotierte Unternehmen in der EU, ihre konsolidierten Abschlüsse nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzustellen.
Was ist das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC)?
Das DRSC ist das nationale Standardisierungsgremium, das Empfehlungen zur Anwendung von Rechnungslegungsstandards erarbeitet und Deutschland in internationalen Gremien vertritt.
Wie wirkt sich die Internationalisierung auf den Einzelabschluss aus?
Während der Konzernabschluss oft nach IFRS erfolgt, bleibt der Einzelabschluss wegen der Verbindung zur Steuererklärung und Gewinnausschüttung in Deutschland meist beim HGB.
- Quote paper
- Tobias Kannen (Author), 2003, Auswirkungen der Internationalisierung auf die handelsrechtliche Rechnungslegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12613