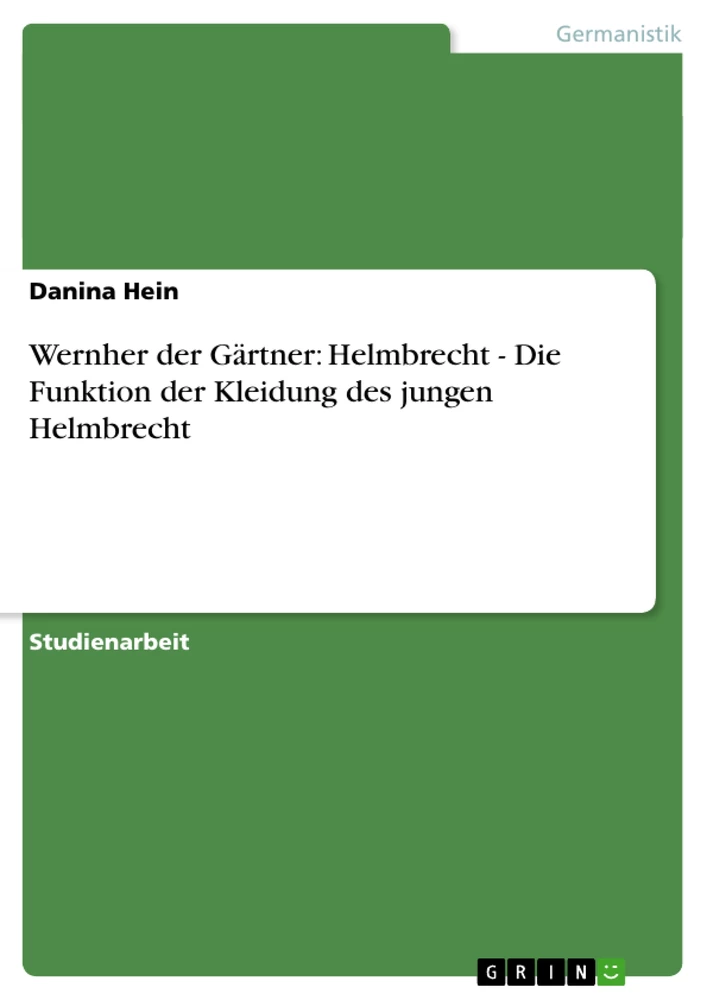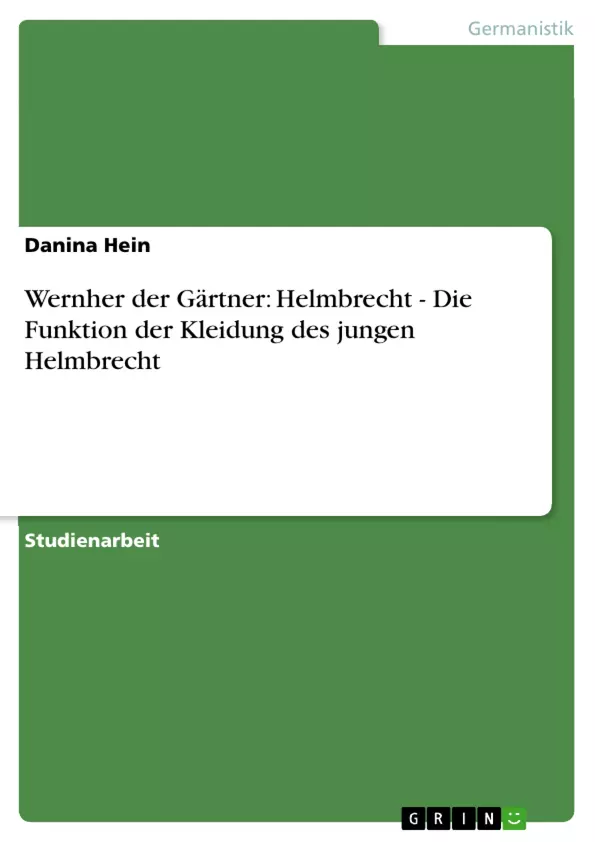Kleidung – in ihrer ursprünglichen Funktion diente Kleidung dem Menschen als Schulz vor Kälte, Sonne und sonstigen Umwelteinflüssen. Diese schützende Funktion rückte in den Hintergrund und der Kleidungsbegriff vollzog einen Wandel, denn Kleidung bietet Menschen die Möglichkeit, ihren sozialen Status nonverbal darzustellen. Dieses Phänomen kann man nicht erst seit dem 21. Jahrhundert beobachten, sondern schon die Menschen im Mittelalter verstanden Kleidung als soziale Ausdrucksform. Es geht nicht mehr primär um die Schutzfunktion von Kleidung, sondern Mode und das äußere Erscheinungsbild werden zu einem bestimmenden Element des menschlichen Lebens. Die Wirkung und Wahl von Kleidung spielt besonders in einer Ständegesellschaft eine wichtige Rolle, denn hier bestimmt Kleidung auf den ersten Blick die Zugehörigkeit zu einem definierten Stand. Diese Wirkung von Kleidung ist auch dem jungen Bauernsohn Helmrecht in der gleichnamigen Erzählung „Helmbrecht“, von Wernher dem Gärtner, bewusst. Helmbrecht fühlt sich zu einem höheren Stand berufen, nachdem ihn Mutter und Schwester mit nicht standesgemäßer Kleidung ausgestattet haben. In der vorliegenden Hausarbeit werde ich auf die Funktionen der Kleidung des jungen Helmbrecht näher eingehen. In meinen Ausführungen beschäftige ich mich zunächst mit der Kleiderordnung des Mittelalters im Allgemeinen, des Weiteren beschäftige ich mich mit der Frage, was Kleidung ausdrücken kann und werde diesbezüglich mein Hauptaugenmerk auf die Interpretation der inhaltlichen Bedeutung bezüglich des zu behandelnden Gegenstandes, Helmbrecht, legen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kleiderordnungen im Mittelalter
- Bedeutungsaspekte von Kleidung
- Die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht in der Erzählung Wernhers des Gärtners
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht in Wernhers des Gärtners Erzählung. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Kleidung im Mittelalter und beleuchtet, wie die Kleidung Helmbrechts seine soziale Aspiration und seinen Konflikt mit seiner bäuerlichen Herkunft symbolisiert.
- Kleiderordnungen im Mittelalter
- Symbolische Bedeutung von Kleidung
- Soziale Aspirationen Helmbrechts
- Die Rolle der Kleidung in der Erzählung
- Helmbrechts Konflikt mit seiner Herkunft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht in der Erzählung. Sie skizziert den Wandel des Kleidungsbegriffs von reinem Schutz vor Umwelteinflüssen hin zu einem Mittel der sozialen Repräsentation und betont die besondere Bedeutung von Kleidung in einer Ständegesellschaft wie dem Mittelalter. Die Arbeit kündigt den methodischen Aufbau an, der die Kleiderordnungen des Mittelalters, die Bedeutungsaspekte von Kleidung im Allgemeinen und schließlich die spezifische Rolle der Kleidung Helmbrechts analysiert.
Kleiderordnungen im Mittelalter: Dieses Kapitel beschreibt die Kleiderordnungen des Mittelalters, insbesondere die Vorschriften für die Kleidung der bäuerlichen Bevölkerung im 12. und 13. Jahrhundert. Es wird auf die gesetzlichen Regelungen eingegangen, die die Kleidung der verschiedenen Stände differenzierten und so die soziale Ordnung sichtbar machten. Die Beschränkungen in Bezug auf Farbe, Material und Länge der Kleidung für Bauern werden detailliert dargestellt und anhand von Beispielen aus historischen Quellen (z.B. Bayrischer Landfrieden) veranschaulicht. Der Fokus liegt auf der klaren Unterscheidung zwischen der einfachen Kleidung der Bauern und der aufwendigeren Kleidung des Adels.
Bedeutungsaspekte von Kleidung: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Bedeutungsaspekte von Kleidung im Mittelalter. Es werden verschiedene Funktionen der Kleidung wie soziale Verweisfunktionen, Prestige- und Signalfunktionen sowie Werbefunktionen erläutert. Der Fokus liegt dabei auf der nonverbalen Kommunikation, die durch Kleidung vermittelt wird und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand oder soziale Stellung ausdrückt. Die Kapitel erläutert, wie Kleidung im Mittelalter nicht nur Schutz bot, sondern auch Status, Reichtum und gesellschaftliche Position sichtbar machte, was für die Interpretation von Helmbrechts Kleidung entscheidend ist.
Die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht in der Erzählung Wernhers des Gärtners: Dieses Kapitel analysiert die Kleidung des jungen Helmbrecht im Kontext der Erzählung. Die detaillierte Beschreibung der Kleidung Helmbrechts zu Beginn der Erzählung wird als Ausgangspunkt genommen. Die aufwendige und für einen Bauern ungewöhnliche Kleidung wird im Detail beschrieben und mit den zuvor dargestellten Kleiderordnungen des Mittelalters verglichen. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie die Kleidung Helmbrechts seine soziale Aspiration und seinen Bruch mit seiner bäuerlichen Herkunft symbolisiert und als zentrales Element der Erzählung dient.
Schlüsselwörter
Helmbrecht, Wernher der Gärtner, Mittelalter, Kleidung, Kleiderordnung, Ständegesellschaft, soziale Repräsentation, nonverbale Kommunikation, soziale Aspiration, Bauernsohn, Adel.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht in der Erzählung Wernhers des Gärtners"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrechts in Wernhers des Gärtners Erzählung. Sie analysiert die Bedeutung von Kleidung im Mittelalter und beleuchtet, wie Helmbrechts Kleidung seine sozialen Aspirationen und seinen Konflikt mit seiner bäuerlichen Herkunft symbolisiert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Kleiderordnungen im Mittelalter, die symbolische Bedeutung von Kleidung, Helmbrechts soziale Aspirationen, die Rolle der Kleidung in der Erzählung und Helmbrechts Konflikt mit seiner Herkunft. Sie untersucht die Kleidung nicht nur als Schutz, sondern als Mittel der sozialen Repräsentation und nonverbalen Kommunikation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Kleiderordnungen im Mittelalter, Bedeutungsaspekte von Kleidung, Die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrechts in der Erzählung Wernhers des Gärtners und Fazit (nicht explizit im HTML, aber implizit vorhanden). Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den methodischen Aufbau. Die weiteren Kapitel behandeln die Kleiderordnungen, die Bedeutung von Kleidung im Mittelalter und die Analyse von Helmbrechts Kleidung im Kontext der Erzählung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf historische Quellen, wie z.B. den Bayrischen Landfrieden, um die Kleiderordnungen des Mittelalters zu veranschaulichen. Die genaue Quellenangabe ist im HTML nicht enthalten, aber die Arbeit verweist auf historische Quellen zur Untermauerung ihrer Argumentation.
Welche Bedeutung hat die Kleidung im Mittelalter?
Im Mittelalter hatte Kleidung verschiedene Bedeutungsaspekte: soziale Verweisfunktionen, Prestige- und Signalfunktionen sowie Werbefunktionen. Sie diente nicht nur dem Schutz, sondern auch der nonverbalen Kommunikation, die soziale Zugehörigkeit und Stellung ausdrückte. Die Kleidung spiegelte den sozialen Status wider und ermöglichte eine klare Unterscheidung der Stände.
Wie wird Helmbrechts Kleidung analysiert?
Helmbrechts Kleidung wird detailliert beschrieben und mit den Kleiderordnungen des Mittelalters verglichen. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie seine ungewöhnliche, für einen Bauern aufwendige Kleidung seine sozialen Aspirationen und den Bruch mit seiner Herkunft symbolisiert und als zentrales Element der Erzählung dient.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Helmbrecht, Wernher der Gärtner, Mittelalter, Kleidung, Kleiderordnung, Ständegesellschaft, soziale Repräsentation, nonverbale Kommunikation, soziale Aspiration, Bauernsohn, Adel.
- Quote paper
- Danina Hein (Author), 2009, Wernher der Gärtner: Helmbrecht - Die Funktion der Kleidung des jungen Helmbrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126182