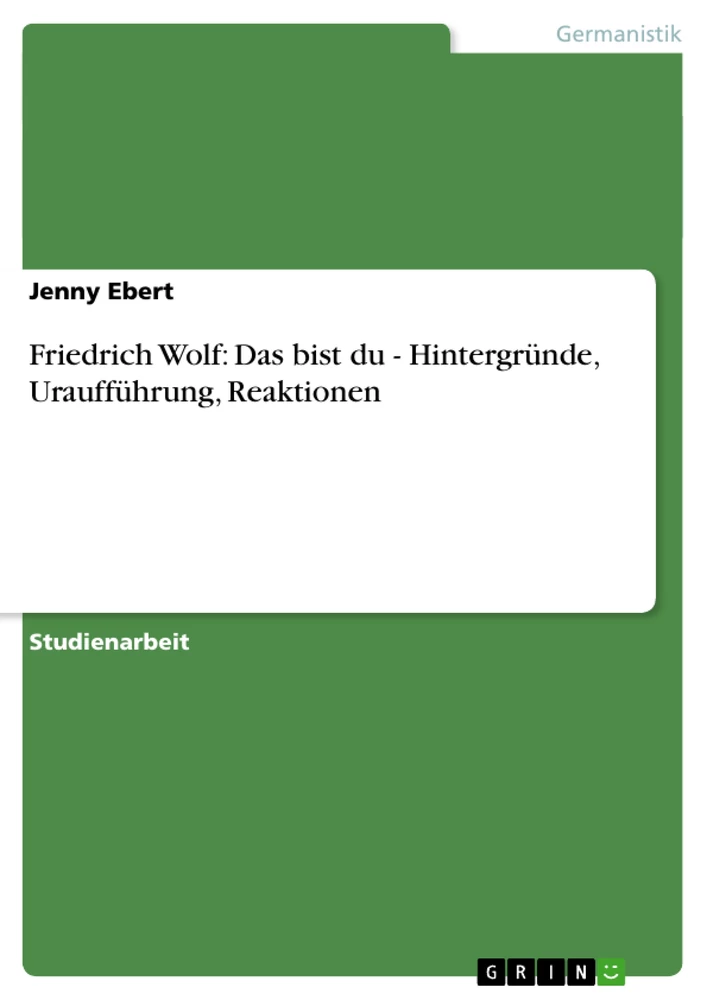Das bist du - Tat twam asi. Diese buddhistische Glaubensformel hat der Autor Friedrich Wolf
in seinem Drama „Das bist du” zum Thema gemacht. Aus dieser Religion kommt der Glaube,
daß jeder Mensch schon einmal gelebt hat. Daß jeder mit jedem verwandt ist beziehungsweise
einmal verwandt war. „Wir erleben nichts anderes als irgendwann einmal als Tat von uns
selbst ausgegangen ist.”1 Die Anhänger des buddhistischen Glaubens sehen daher in
unbekannten Menschen keine Fremden, weil man sich aus einem früheren Leben kennt: „Das
bist du noch einmal, gestalt-gewordene eigene Vergangenheit, gestalt-gewordene eigene
Tat.”2 Jeder ist also immer „früherer Folge Folge”.3 Warum hat Friedrich Wolf diese
buddhistische Lehre in seinem Drama verwendet? Gelangte solch ein Werk überhaupt zu
einer Aufführung auf der Bühne? Und falls ja, was schrieben die Kritiker? Hinzu kommt, daß
Friedrich Wolf sich in mehreren Artikeln gegen die naturalistische Bühnengestaltung
ausgesprochen hat.4 Wie hat er aber dann eine Aufführung von seinem Drama „Das bist du”
realisiert? Mußten da nicht notgedrungen Kompromisse eingegangen werden? Oder fand
Wolf Unterstützung bei ähnlich Denkenden?
In dieser Arbeit werde ich diese Fragen zu beantworten versuchen. Der Schwerpunkt wird
dabei auf den Fragen der Realisierung des Bühnenbildes und den Pressestimmen liegen.
Warum aber ist meine Wahl nun eigentlich ausgerechnet auf das Drama „Das bist du”
gefallen? In der Sekundärliteratur wird diesem Drama oftmals nur ein kurzer Absatz, eine
Erwähnung zugestanden.5 Jedoch wichtig im literarischen Schaffen Friedrich Wolfs ist dieses
Werk insofern, daß es das erste dramatische Werk des Autors ist.6 Ebenso das erste
Schauspiel7, zeigt also Wolfs Schritt zur Bühne. Die Möglichkeiten der Gestaltung eines
Bühnenbildes wurden bei der Uraufführung stark erweitert, revolutioniert. Auf diesen Punkt
werde ich später genauer eingehen. In der heutigen Zeit jedoch scheint das Drama keine große
Rolle zu spielen, denn es war mir nicht möglich, heutige Aufführungen oder Aufführungsorte
von „Das bist du” zu finden.
1Internet: http://www.uni-marburg.de/dir/GRUPPEN/interku/ejgr_dialogerituale.html
2Internet: http://www.uni-marburg.de/dir/GRUPPEN/interku/ejgr_dialogerituale.html
3Wolf: Das bist du. S. 99.
4vgl. zum Beispiel Friedrich Wolf: Die expressionistische Bühne. Eine Forderung.
5vgl. zum Beispiel Schriftsteller der Gegenwart. S. 84.
6vgl. Pollatschek: Friedrich Wolf. S. 48.
7vgl. Schriftsteller der Gegenwart. S. 84.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Thesenformulierung
- Forschungssituation
- Der Weg zur Aufführung
- Die Kunstdebatte zwischen Friedrich Wolf und Berthold Viertel
- Die Entwürfe Conrad Felixmüllers zu „Das bist du“
- Uraufführung und Pressereaktionen
- Die kritisierenden Stimmen
- Beseitigung der naturalistischen Elemente?
- Kurze Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Friedrich Wolfs Drama „Das bist du“, insbesondere mit der Frage, wie es zur Realisierung der Aufführung kam und welche Reaktionen es in der Presse erhielt. Dabei wird der Schwerpunkt auf den Bühnenentwürfen von Conrad Felixmüller und den kritischen Stimmen liegen.
- Die Bedeutung des buddhistischen Glaubens in Wolfs Werk
- Die Herausforderungen bei der Inszenierung des Stücks
- Die Kunstdebatte um die naturalistische Bühnengestaltung
- Die Zusammenarbeit zwischen Wolf und Felixmüller
- Die Rezeption des Stücks durch die Presse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Thesenformulierung
Die Einleitung stellt das Drama „Das bist du“ und seine Thematik – die buddhistische Glaubensformel „Tat twam asi“ – vor. Der Autor stellt Fragen zur Realisierung der Bühnenadaption und zur Rezeption des Werks.
Forschungssituation
Der zweite Abschnitt behandelt die Schwierigkeit, Literatur zur Bühnenpräsenz und -darstellung des Expressionismus zu finden, insbesondere zu Wolfs „Das bist du“. Die Suche nach Rezensionen, Interpretationen und Informationen über den Autor erweist sich als schwierig. Die Biographiesituation zu Friedrich Wolf wird als unzureichend und sozialistisch geprägt beschrieben.
Der Weg zur Aufführung
Dieser Abschnitt beschreibt die Ablehnung des Stücks durch das Sächsische Landestheater, die Kritik an seiner Unaufführbarkeit. Er beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen Friedrich Wolf und Conrad Felixmüller, die beide eine anaturalistische Bühnenform forderten. Wolf präsentiert sein Stück Felixmüller, der sofort Skizzen für ein Bühnenbild entwirft. Die Entwürfe überzeugen die Verantwortlichen des Staatsschauspiels Dresden, „Das bist du“ in ihr Programm aufzunehmen.
Schlüsselwörter
Friedrich Wolf, „Das bist du“, Expressionismus, Bühnenbild, Conrad Felixmüller, Naturalismus, Uraufführung, Pressereaktionen, Kunstdebatte, buddhistische Glaubensformel, "Tat twam asi".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Friedrich Wolfs Drama „Das bist du“?
Das Drama thematisiert die buddhistische Glaubensformel „Tat twam asi“ (Das bist du), die besagt, dass jeder Mensch mit jedem verwandt ist und Taten aus der Vergangenheit die Gegenwart bestimmen.
Welche Rolle spielte Conrad Felixmüller für das Stück?
Der Künstler Conrad Felixmüller entwarf das revolutionäre Bühnenbild. Seine anaturalistischen Entwürfe überzeugten das Staatsschauspiel Dresden, das zuvor als „unaufführbar“ geltende Stück zu inszenieren.
Warum lehnte das Sächsische Landestheater das Stück zunächst ab?
Es wurde als „unaufführbar“ kritisiert, da die expressionistische Form und die Anforderungen an die Bühne nicht mit der damals vorherrschenden naturalistischen Tradition vereinbar schienen.
Was war die Kernfrage der Kunstdebatte zwischen Wolf und Viertel?
Es ging um die Abkehr vom Naturalismus hin zu expressionistischen Bühnenformen. Wolf forderte eine Gestaltung, die über die bloße Abbildung der Realität hinausgeht.
Wie reagierte die Presse auf die Uraufführung?
Die Reaktionen waren gemischt. Die Arbeit analysiert sowohl die lobenden als auch die kritischen Stimmen, die sich besonders mit der religiösen Thematik und der neuartigen Inszenierung befassten.
Welche Bedeutung hat das Werk für Friedrich Wolfs Schaffen?
Es ist Wolfs erstes dramatisches Werk und markiert seinen Schritt zur Bühne sowie den Beginn seines literarischen Weges im Expressionismus.
- Arbeit zitieren
- Jenny Ebert (Autor:in), 2001, Friedrich Wolf: Das bist du - Hintergründe, Uraufführung, Reaktionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12624