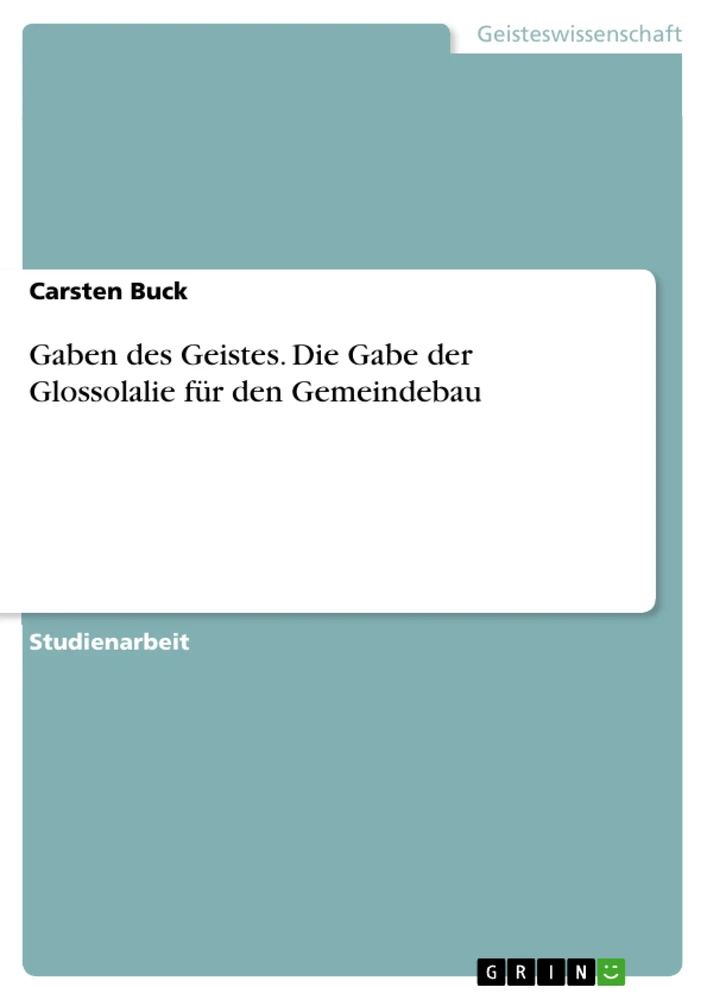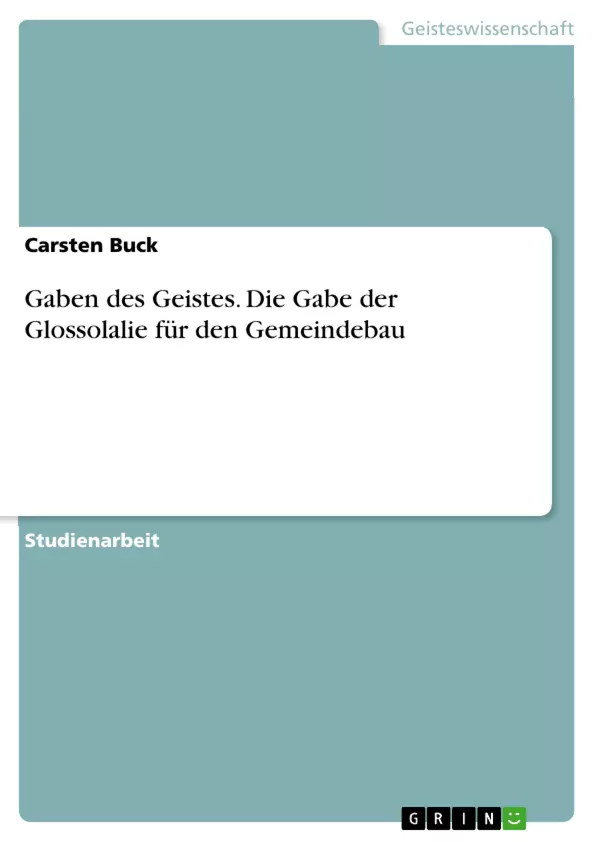Die Gabe der Glossolalie gehört zu den Gaben, die der Heilige Geist den Gläubigen schenkt. In dieser Kursabschlussarbeit werde ich die Aussagen des Neuen Testamentes untersuchen und der Frage nachgehen, welche Rolle diese Gabe für die Entwicklung einer Gemeinde spielt.
Nach einer Übersicht der Bibelstellen werde ich untersuchen, wie der Begriff „Auferbauung“ konkret zu füllen ist. Im Weiteren geht es um zwei Aussagen des Apostels Paulus, die einen Widerspruch darstellen, zumindest auf den ersten Blick.
Im abschließenden Fazit und Ausblick lege ich einige Anschlussgleise, die zur weiteren Reflexion für den Gemeindebau dienen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1 Die Gabe der Glossolalie im Neuen Testament
- 1.1 γλωσσα im NT
- 1.2 Synonyme Ausdrücke
- 2 Was bewirkt die Gabe der Glossolalie?
- 3 Widerspricht Paulus sich?
- 3.1 Die widersprüchlichen Aussagen
- 3.2 Ein Lösungsweg
- 4 Die Gabe der Glossolalie in der privaten Anwendung
- 5 Die Gabe der Glossolalie in der öffentlichen Anwendung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Kursabschlussarbeit untersucht die Gabe der Glossolalie im Neuen Testament, insbesondere ihre Rolle für den Gemeindebau. Der Fokus liegt auf der Analyse von Bibelstellen und der Interpretation der Aussagen des Apostels Paulus. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Begriffs "Auferbauung" im Kontext der Glossolalie sowie die scheinbar widersprüchlichen Aussagen des Apostels Paulus über diese Gabe.
- Die Bedeutung der Glossolalie im Neuen Testament
- Die Rolle der Glossolalie für den Gemeindebau
- Die Interpretation des Begriffs "Auferbauung" im Kontext der Glossolalie
- Die scheinbar widersprüchlichen Aussagen des Apostels Paulus über die Glossolalie
- Praktische Implikationen der Glossolalie für die Gemeinde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung gibt einen Überblick über die Thematik und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet die Bedeutung des Begriffs Glossolalie im Neuen Testament und analysiert verschiedene synonyme Ausdrücke. Kapitel 2 untersucht die Auswirkungen der Glossolalie auf die Gemeinde. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den scheinbar widersprüchlichen Aussagen des Apostels Paulus über die Gabe der Glossolalie und erörtert mögliche Lösungswege. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Anwendung der Glossolalie in der privaten und öffentlichen Sphäre.
Schlüsselwörter
Glossolalie, Gemeindebau, Neues Testament, Apostel Paulus, Auferbauung, Geistesgaben, Sprachenrede, Zungenrede, Synonyme Ausdrücke, Widersprüche, Praktische Anwendung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Glossolalie im christlichen Kontext?
Glossolalie, auch als Sprachenrede oder Zungenrede bekannt, ist eine vom Heiligen Geist geschenkte Gabe, bei der Gläubige in unverständlichen oder fremden Sprachen sprechen.
Welche Rolle spielt die Glossolalie für den Gemeindebau?
Die Arbeit untersucht, wie diese Gabe zur „Auferbauung“ der Gemeinde beitragen kann, wobei zwischen privater Erbauung und öffentlichem Nutzen unterschieden wird.
Widerspricht sich der Apostel Paulus beim Thema Zungenrede?
Paulus macht scheinbar widersprüchliche Aussagen über den Wert der Zungenrede im Vergleich zur Prophetie. Die Arbeit bietet Lösungswege an, wie diese Aussagen harmonisiert werden können.
Was ist der Unterschied zwischen privater und öffentlicher Anwendung?
Die private Anwendung dient der persönlichen Erbauung des Gläubigen, während die öffentliche Anwendung im Gottesdienst laut Paulus eine Auslegung erfordert, um die gesamte Gemeinde zu erbauen.
Welche Bedeutung hat der Begriff „Auferbauung“?
Auferbauung bezeichnet im Neuen Testament das geistliche Wachstum und die Stärkung des Glaubens, sowohl des Einzelnen als auch der gesamten Gemeinschaft.
- Citation du texte
- Carsten Buck (Auteur), 2016, Gaben des Geistes. Die Gabe der Glossolalie für den Gemeindebau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1262697