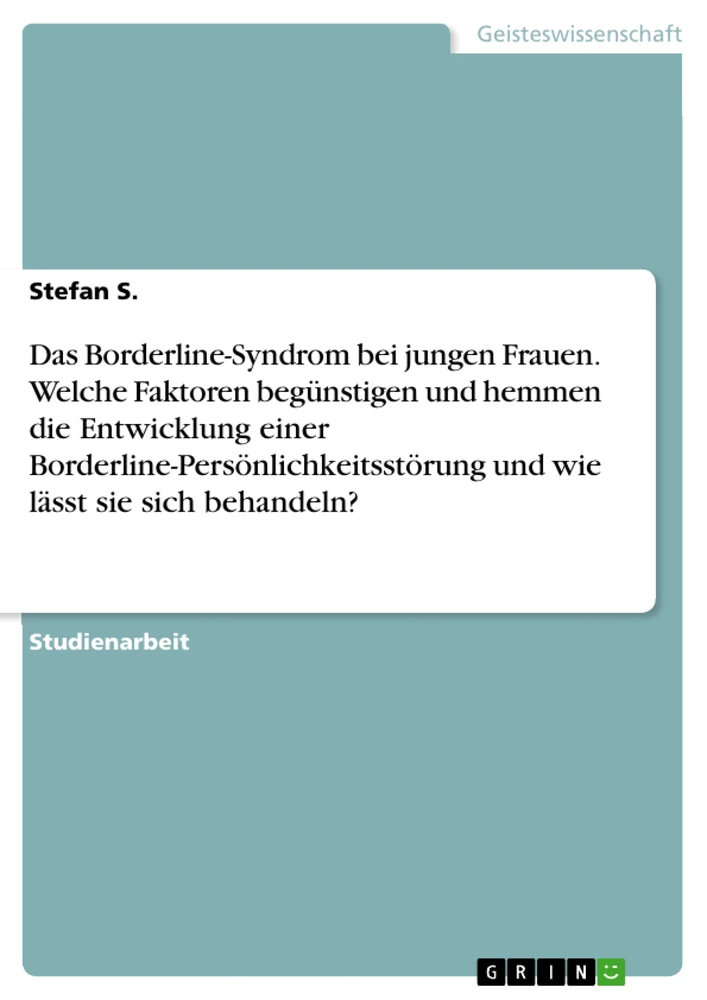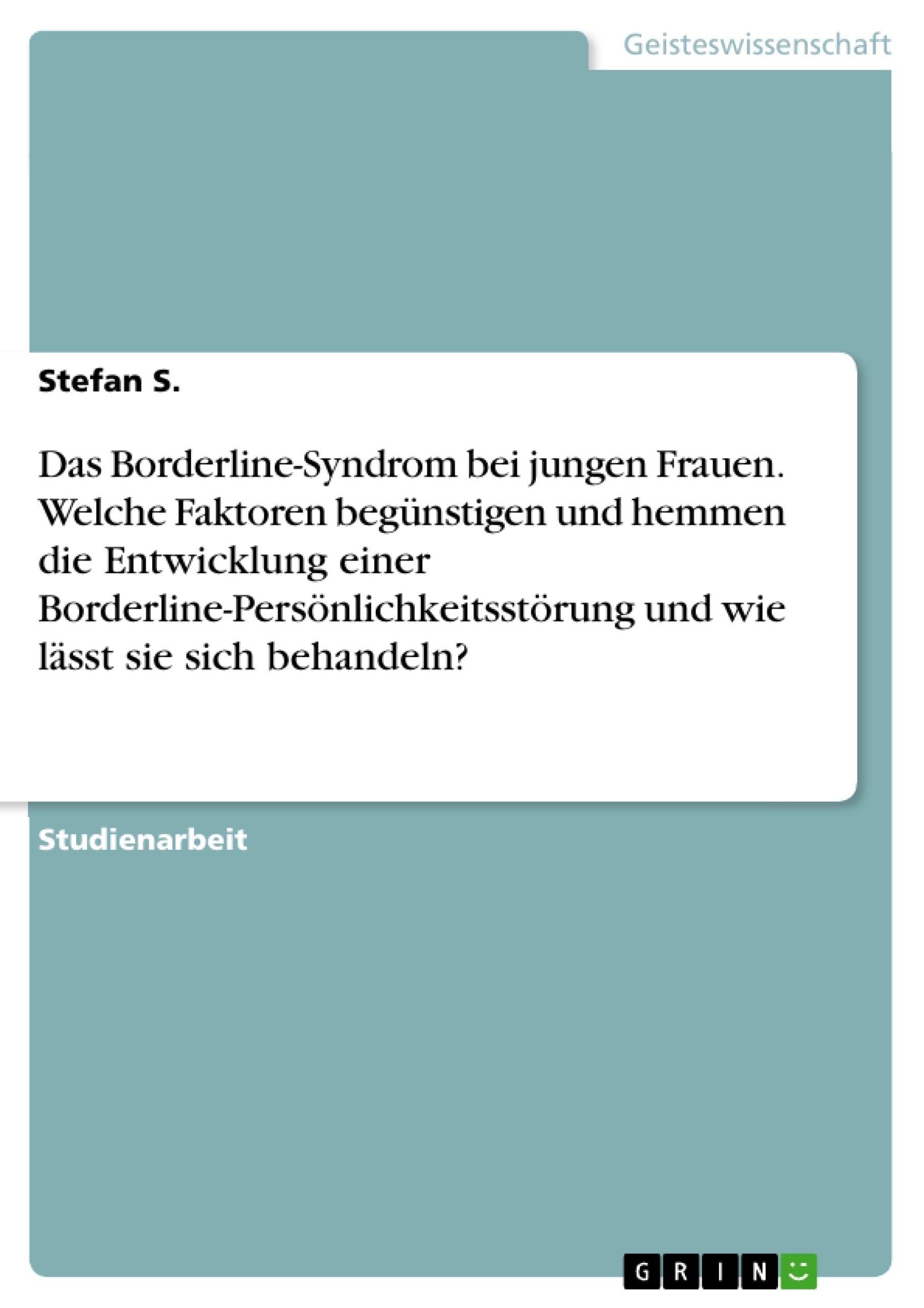Die hier vorliegende Arbeit ist aufgrund eines beispielhaften therapeutischen Erstgespräches mit der Borderline-Patientin Frau S. entstanden. Ziel ist es, mithilfe der konkreten Leidensgeschichte von Frau S. ein fundiertes Verständnis über die BPS zu erlangen. Dabei ist zu klären, welche Faktoren die Entwicklung und Vorbeugung der Störung bestimmen und mit welchen therapeutischen Strategien sie sich behandeln lassen.
Hierfür werden in Kapitel zwei zunächst die wichtigsten theoretischen und empirischen Grundlagen zur BPS dargestellt. Angefangen mit der offiziellen diagnostischen Klassifizierung nach dem ICD-10 in Unterkapitel 2.1. Daraufhin werden in Unterkapitel 2.2 die Symptome und komorbiden Erkrankungen der Störung thematisiert. Unterkapitel 2.3 befasst sich dann mit den verschiedenen, in der Kindheit angesiedelten Entstehungsursachen. Die theoretischen Fakten zur Epidemiologie und Prävalenz werden mithilfe von wissenschaftlichen Studien in Unterkapitel 2.4 aufgeführt, wobei geklärt werden soll, ob Frauen häufiger an Borderline erkranken als Männer.
Bevor der theoretische Teil dieser Arbeit in Kapitel drei abschließend zusammengefasst werden kann, wird in Unterkapitel 2.5 sowohl der Verlauf als auch die Therapierbarkeit der Störung thematisiert. In Kapitel vier soll beispielhaft anhand des Falls von Frau S. eine Fallkonzeption erstellt werden. Hierfür wird in Unterkapitel 4.1 zuerst die Fallkonzeptualisierung erarbeitet, welche sich aus einer Makroanalyse nach dem biopsychosozialen Krankheitsmodell und einer Mikroanalyse nach dem "SORKC"-Modell zusammensetzt. Während die Verhaltensanalyse auf Makroebene der therapeutischen Grundorientierung und dem Verständnis des generellen Störungsbildes dient, soll die Mikroanalyse spezifische Verhaltensinformationen für die Anwendung konkreter Behandlungsmethoden liefern.
Daraufhin wird in Unterkapitel 4.2 die Therapieplanung für Frau S. eingeleitet, bevor abschließend in Unterkapitel 4.3 eine Zusammenfassung der gesamten Fallkonzeption in tabellarischer Form aufgeführt wird. Das fünfte Kapitel setzt sich dann in Form einer Diskussion aus einer kritischen Reflexion des Praxisteils und einer Auflistung von Empfehlungen zur Prävention der BPS zusammen. Die Arbeit wird mit einem Fazit in Kapitel sechs abgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Diagnose nach dem ICD-10
- Symptomatic und komorbide Erkrankungen
- Entstehungsursachen
- Epidemiologie und Prävalenz
- Verlauf und Therapie
- Zusammenfassung des Theorieteils
- Fallkonzeption: Die Borderline-Patientin Frau S.
- Fallkonzeptualisierung
- Makroanalyse: Die vertikale Verhaltensanalyse nach dem biopsychosozialen Krankheitsmodell
- Mikroanalyse: Die horizontale Verhaltensanalyse nach dem „SORKC“-Modell
- Therapieplanung
- Zusammenfassender Überblick
- Fallkonzeptualisierung
- Diskussion
- Eine kritische Reflexion
- Empfehlungen zur Prävention von Borderline
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zu vermitteln, indem die Leidensgeschichte einer Patientin namens Frau S. als Beispiel herangezogen wird. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Faktoren, die die Entstehung und Vorbeugung der Störung beeinflussen, sowie auf der Erörterung geeigneter therapeutischer Strategien.
- Definition und Diagnostik der BPS nach ICD-10
- Symptome, komorbide Erkrankungen und Entstehungsursachen der BPS
- Epidemiologie und Prävalenz der BPS, insbesondere im Hinblick auf geschlechtsspezifische Unterschiede
- Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten der BPS
- Anwendungsbeispiele der vertikalen und horizontalen Verhaltensanalyse im Kontext der BPS
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ein und beleuchtet die Bedeutung dieser Erkrankung im klinischen Bereich. Die Schwierigkeit der Behandlung von BPS-Patienten, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, wird hervorgehoben.
Kapitel 2 bietet eine detaillierte Darstellung der BPS, beginnend mit der diagnostischen Klassifizierung nach dem ICD-10. Anschließend werden die Symptome und komorbiden Erkrankungen, die Entstehungsursachen sowie die epidemiologischen und prävalenten Aspekte der Störung behandelt. Abschließend wird der Verlauf und die Therapierbarkeit der BPS beleuchtet.
Kapitel 3 fasst die theoretischen Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und bildet so eine Grundlage für die anschließende Fallkonzeption.
Kapitel 4 widmet sich der konkreten Fallkonzeption von Frau S. Hier wird die Leidensgeschichte der Patientin mithilfe der vertikalen und horizontalen Verhaltensanalyse analysiert, um die Entstehung und Aufrechterhaltung ihrer BPS zu verstehen. Die Therapieplanung wird ebenfalls vorgestellt und ein zusammenfassender Überblick über den Fall gegeben.
Kapitel 5 präsentiert eine kritische Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse und beinhaltet Empfehlungen zur Prävention von BPS.
Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung, ICD-10, Symptomatik, komorbide Erkrankungen, Entstehungsursachen, Epidemiologie, Prävalenz, Verlauf, Therapie, vertikale Verhaltensanalyse, horizontale Verhaltensanalyse, biopsychosoziales Krankheitsmodell, „SORKC“-Modell, Fallkonzeption, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmerkmale einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS)?
Typisch sind Instabilität in Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie eine ausgeprägte Impulsivität.
Wie wird Borderline nach ICD-10 diagnostiziert?
Die Diagnose erfolgt unter der Kategorie F60.31 (emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ) anhand spezifischer klinischer Kriterien.
Welche Faktoren begünstigen die Entstehung von Borderline?
Häufig spielen traumatische Kindheitserlebnisse, genetische Dispositionen und ein invalidierendes soziales Umfeld eine entscheidende Rolle.
Sind Frauen häufiger von Borderline betroffen als Männer?
In klinischen Stichproben werden Frauen deutlich häufiger diagnostiziert, wobei die Forschung auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Symptomausprägung diskutiert.
Was ist das biopsychosoziale Krankheitsmodell?
Es ist ein Erklärungsmodell, das biologische, psychologische und soziale Faktoren in ihrer Wechselwirkung bei der Entstehung von Krankheiten berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Stefan S. (Autor:in), 2022, Das Borderline-Syndrom bei jungen Frauen. Welche Faktoren begünstigen und hemmen die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und wie lässt sie sich behandeln?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1263703