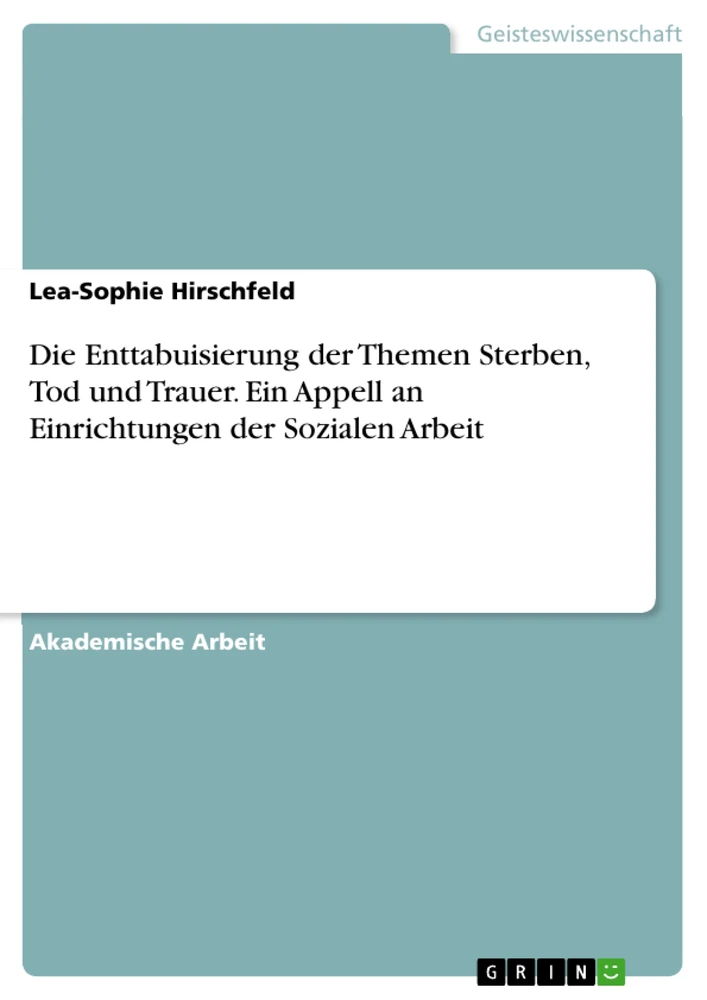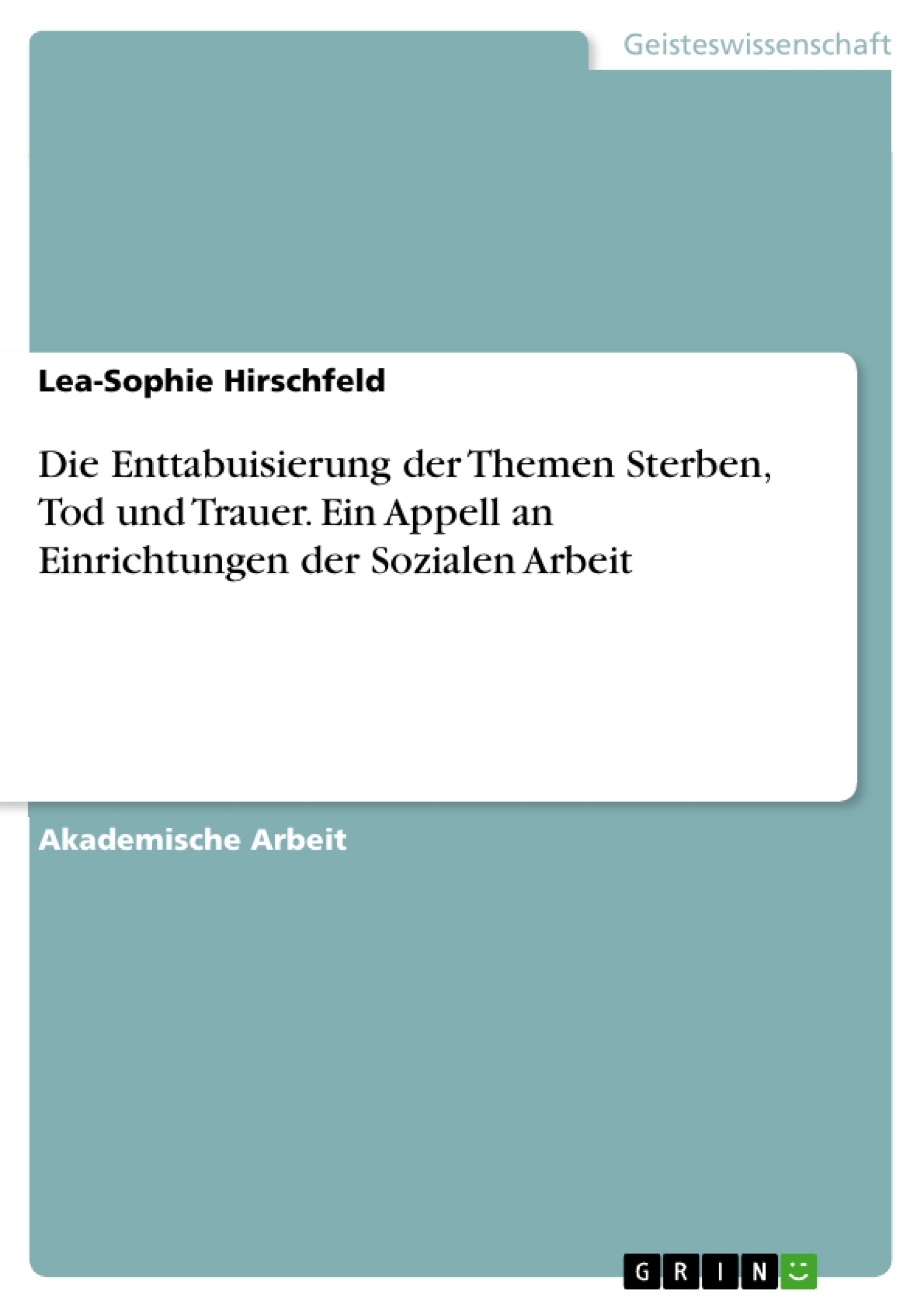In meiner theoriegeleiteten Facharbeit werde ich mich daher mit der Hypothese: "Jeder Mensch ist unabhängig von kognitiven Fähigkeiten in der Lage, zu trauern, den Tod zu begreifen und das sollte ihm nicht vorenthalten werden." auseinandersetzen.
Ein differenziertes Fazit soll insbesondere sozialen Einrichtungen ein Appell zur Enttabuisierung des Themenkomplexes "Sterben, Tod und Trauer" sein und eventuelle Lösungsansätze zur Sensibilisierung in Hinblick auf die Arbeit, beziehungsweise den Umgang mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen und der Beschäftigung mit dem Lebensende aufzeigen.
Einleitend werde ich die Begriffe "Tod" und "Behinderung" in Hinblick auf ihre gesellschaftliche Tabuisierung erklären, um dann genauer auf ihren hier thematisierten Zusammenhang einzugehen und darüber das Motiv der Facharbeit deutlich zu machen.
Darauf wird eine umfangreichere Erörterung folgen, die, gestützt auf dem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung nach Piaget und dem Todeskonzept nach Wittkowski, anhand von jeweils passenden Praxisbeispielen in Form von teilnehmenden Beobachtungen darlegen soll, dass Menschen verschiedenster kognitiver Fähigkeiten in der Lage sind, "Tod" wahrzunehmen und zu begreifen.
Zusätzlich möchte ich erörtern, inwieweit die eigene Angst vor der Auseinandersetzung mit dem Tod und eventuell weitere Faktoren Mitarbeitende sozialer Einrichtungen und Angehörige zu der benannten Zurückhaltung gegenüber der Klientel bewegen. Darüber möchte ich unter anderem mit der Arbeit von Franke den individuellen sowie gesellschaftlichen Gewinn der weiteren Enttabuisierung begründen. Abschließend werde ich meine Erkenntnisse bezüglich des Veränderungsbedarfs in der Haltung zum Thema Tod in der sozialen Arbeit zusammenfassen und mögliche Lösungsansätze aufzeigen.
Schlussendlich soll die Facharbeit als Appell an den Leser und insbesondere an soziale Einrichtungen der Behindertenhilfe dienen, den persönlichen und professionellen Umgang mit dem Themenkomplex "Sterben, Tod und Trauer" zu hinterfragen und dazu einladen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, um einen bewussteren Umgang zu erlangen und so Menschen mit kognitiven Einschränkungen gezielt und individuell auch am und in Hinblick auf das Lebensende unterstützen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Ausgangspunkt: Die Unterstellung des "Nichtverstehens".
- 2. Wenn "Tabus" sich treffen: Tod und Behinderung
- 2.1. Begriffserklärung in Hinblick auf gesellschaftliche Tabuisierung
- 2.2. Entwicklungstheorie und Todeskonzept: Von Piaget zu Wittkowski
- 2.2.1. Mögliche Verknüpfung beider Konzepte
- 2.3. Drei Praxisbeispiele: Menschen, die den Tod verstehen.
- 2.3.1. Der Tod eines Bruders
- 2.3.2. Die Trauer einer Tochter
- 2.3.3. Der Tod eines Vogels und die eigene Sterblichkeit
- 2.4. Die Hybris der Bewahrung.
- 3. Das Ende - Ein Fazit..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Tabuisierung von Tod und Trauer in der Arbeit mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen und plädiert für einen offenen Umgang mit diesen Themen. Sie setzt sich mit der Hypothese auseinander, dass jeder Mensch unabhängig von seinen kognitiven Fähigkeiten in der Lage ist, Trauer und den Tod zu begreifen.
- Analyse der gesellschaftlichen Tabuisierung von Tod und Behinderung
- Untersuchung der kognitiven Entwicklung in Bezug auf das Todesverständnis anhand des Stufenmodells von Piaget und dem Todeskonzept von Wittkowski
- Präsentation von Praxisbeispielen, die die Fähigkeit von Menschen mit verschiedenen kognitiven Fähigkeiten belegen, den Tod zu verstehen und zu verarbeiten
- Kritik an der Zurückhaltung von Mitarbeitenden in sozialen Einrichtungen im Umgang mit dem Tod und Trauer bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen
- Argumentation für die Enttabuisierung des Themas und die Förderung einer sensibleren Arbeitsweise in sozialen Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation, die durch das Verschweigen und Leugnen des Themas Tod in der Arbeit mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen geprägt ist. Das zweite Kapitel widmet sich den Begriffen "Tod" und "Behinderung" im Kontext ihrer gesellschaftlichen Tabuisierung. Es werden die historischen Entwicklungen des Umgangs mit dem Tod in der westlichen Welt sowie die Tabuisierung des Themas Behinderung betrachtet. Das zweite Kapitel analysiert auch die kognitiven Entwicklungsstufen von Piaget und das Todeskonzept von Wittkowski, um die Fähigkeit von Menschen mit verschiedenen kognitiven Fähigkeiten zum Verständnis des Todes aufzuzeigen. Zudem werden Praxisbeispiele vorgestellt, die das Verständnis von Tod und Trauer bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen verdeutlichen. Das dritte Kapitel wird sich mit den Auswirkungen der Zurückhaltung von Mitarbeitenden im Umgang mit dem Thema Tod beschäftigen, die auf Angst und Unsicherheit beruhen könnten. Es soll auch auf die Bedeutung der Enttabuisierung des Themas Tod in der Arbeit mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen hingewiesen werden.
Schlüsselwörter
Tabuisierung, Tod, Trauer, Behinderung, kognitive Entwicklung, Praxisbeispiele, Enttabuisierung, Sensibilisierung, soziale Einrichtungen, Lebensende, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Können Menschen mit kognitiven Einschränkungen den Tod begreifen?
Ja, die Arbeit vertritt die Hypothese, dass jeder Mensch unabhängig von kognitiven Fähigkeiten in der Lage ist, zu trauern und den Tod wahrzunehmen.
Welche Theorien werden zur Erklärung des Todesverständnisses herangezogen?
Die Arbeit nutzt das Stufenmodell von Piaget und das Todeskonzept nach Wittkowski.
Warum wird das Thema Tod in sozialen Einrichtungen oft tabuisiert?
Häufig führen eigene Ängste der Mitarbeitenden und die fälschliche Unterstellung des „Nichtverstehens“ zur Zurückhaltung gegenüber den Klienten.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit genannt?
Es werden Fälle wie der Tod eines Bruders, die Trauer einer Tochter und die Reaktion auf den Tod eines Vogels beschrieben.
Was ist das Ziel dieses Appells an soziale Einrichtungen?
Ziel ist die Enttabuisierung und Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit Sterben und Trauer in der Behindertenhilfe.
- Quote paper
- Lea-Sophie Hirschfeld (Author), 2022, Die Enttabuisierung der Themen Sterben, Tod und Trauer. Ein Appell an Einrichtungen der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1264195